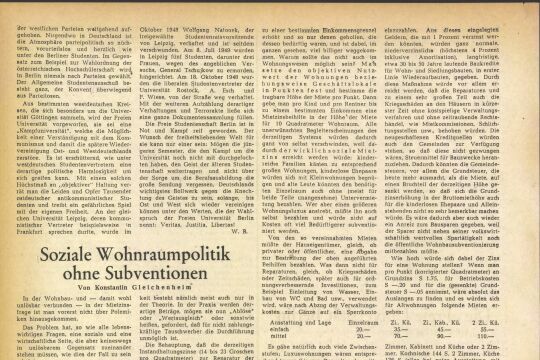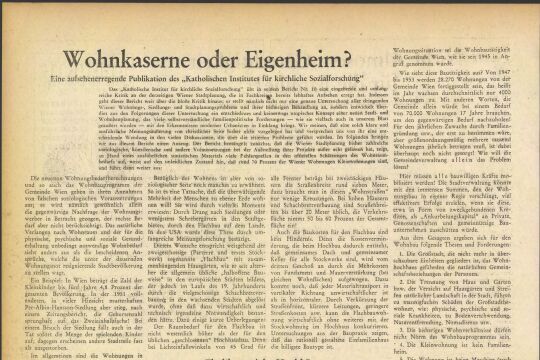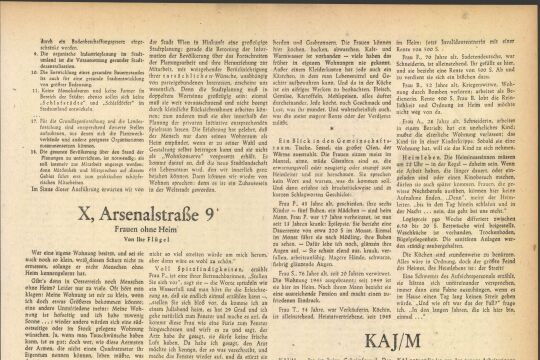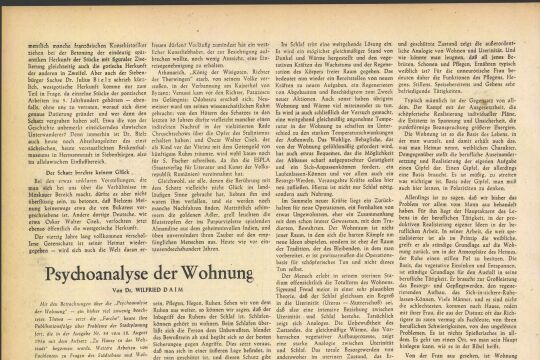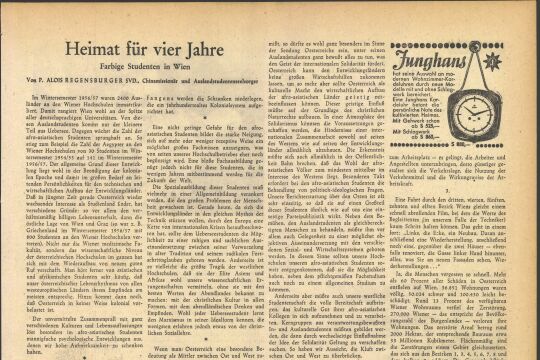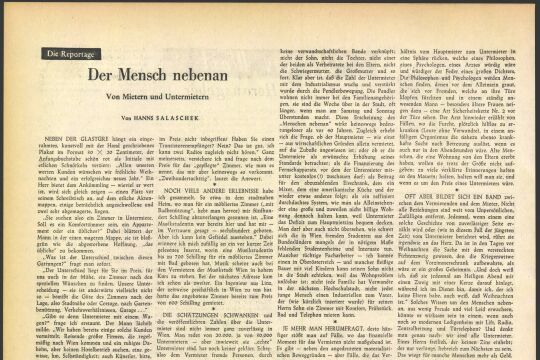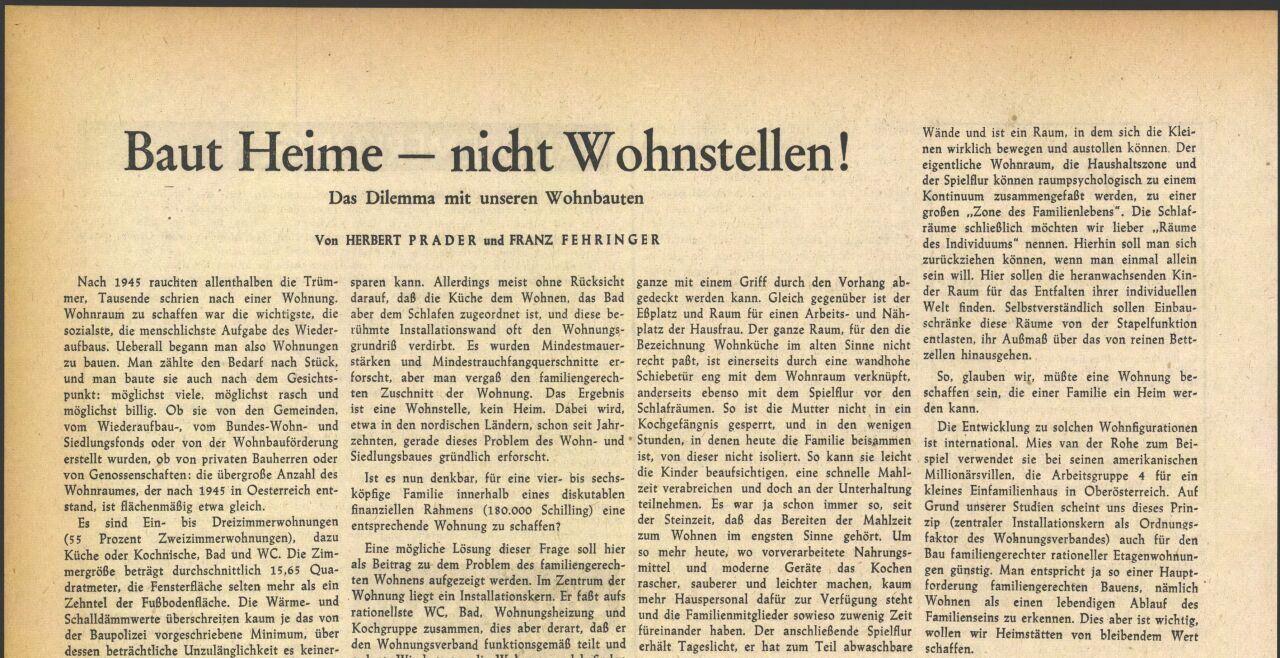
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Baut Heime- nicht Wohnstellen!
Nach 1945 rauchten allenthalben die Trümmer, Tausende schrien nach einer Wohnung. Wohnraum zu schaffen war die wichtigste, die sozialste, die menschlichste Aufgabe des Wiederaufbaus. Ueberall begann man also Wohnungen zu bauen. Man zählte den Bedarf nach Stück, und man baute sie auch nach dem Gesichtspunkt: möglichst viele, möglichst rasch und möglichst billig. Ob sie von den Gemeinden, vom Wiederaufbau-, vom Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds oder von der Wohnbauförderung erstellt wurden, ob von privaten Bauherren oder von Genossenschaften: die übergroße Anzahl des Wohnraumes, der nach 1945 in Oesterreich entstand, ist flächenmäßig etwa gleich.
Es sind Ein- bis Dreizimmerwohnungen (55 Prozent Zweizimmerwohnungen), dazu Küche oder Kochnische, Bad und WC. Die Zimmergröße beträgt durchschnittlich 15,65 Quadratmeter, die Fensterfläche selten mehr als ein Zehntel der Fußbodenfläche. Die Wärme- und Schalldämmwerte überschreiten kaum je das von der Baupolizei vorgeschriebene Minimum, über dessen beträchtliche Unzulänglichkeit es keinerlei Debatten gibt.
Sind diese Wohnungen richtig? Wurde da den Familien ein Heim geschaffen? Darauf ist die Antwort ein klares Nein! Die Ausbildung dieses heute noch gebräuchlichen Wohnungstyps ist nur zu verstehen aus der Mentalität der ersten Nachkriegsjahre, möglichst vielen ein Dach über dem Kopf zu bieten, sei es beschaffen wie auch immer. So verständlich, notwendig und verdienstvoll die Schaffung derartigen Notwohnraumes in den ersten Nachkriegsjahren war, scheint doch endlich der Zeitpunkt gekommen, Heimstätten bleibenden Wertes zu schaffen. Mehr und mehr ergibt sich dabei die Gefahr einer ungeheuren Fehlinvestition von Volksvermögen, das in die Errichtung von Wohnstellen gepumpt wird, denen bereits im Augenblick der Fertigstellung der Charakter von Slums anhaftet.
Jetzt aber bestehen noch immer 55 Prozent der gebauten Wohnungen aus der bekannten Zuordnung von zwei etwa 15,5 Quadratmeter großen Zimmern, Kochnische und Bad. Gerade dieser Typ ist in Wirklichkeit ziemlich unbrauchbar. Für eine Junggesellenwohnung ist so eine Wohnung schlecht zugeschnitten, fast zu groß. Für eine Familie mit auch nur einem Kind ist sie prinzipiell zu klein. Wir wollen diese Behauptung an Hand des Beispiels eines jungen Ehepaares analysieren. Ein Wohnraum soll folgendes leisten: Essen (mindestens fünf Quadratmeter), gemütliches Beisammensitzen (mindestens sechs Quadratmeter), Nähen, Schreiben, diverse Schrankstellflächen (zusammen , vier Quadratmeter) und Bewegungsfläche (sieben Quadratmeter). Summe 22 Quadratmeter. Und in Wirklichkeit steht dann in diesem Zimmer nicht mehr als ein Eßtisch mit vier Sesseln, eine Sitzgruppe mit zwei Fauteuils “und eine Sitzbank, ein Ofen, ein Schreibplatz, ein Bücherregal und eine Anrichte.
Das Schlafzimmer muß Raum bieten für zwei Betten (vier Quadratmeter), Schrankfläche (zwei Quadratmeter), Ankleideplatz und Bewegungsraum (sieben Quadratmeter), zusammen 13 Quadratmeter.
Diese beiden jungen Leute benötigen an Wohn- und Schlafraum 35 Quadratmeter, und dabei ist noch nicht an ein Kind gedacht. Trotzdem bieten gut die Hälfte der gebauten Wohnungen nicht einmal das. Die sture Auffäde-lung gleichgroßer Zimmer, über deren funktionell ganz verschiedene Widmung kaum nachgedacht wird, ist die Regel. Bei der Möblierung ergeben sich dann die größten Schwierigkeiten. Man vergißt eben, daß Wohnen ein lebendiger Ablauf und nicht ein totes Aufbewahrtsein ist. Ein Kind etwa braucht von Anfang an Platz; wenn es größer wird, eigenen Raum zur Entfaltung seines Wesens. Buben und Mädel sollen getrennt schlafen können. Viel zu selten besteht auch die Möglichkeit, die Wohnung entsprechend der geänderten Familiengröße zu wechseln. Wenn man weiß, daß die größte Gemeinde Oesterreichs noch heute vierbettige Typenwohnungen baut, deren Hauptwohnraum 14 Quadratmeter mißt, ständig durchschritten werden muß und außerdem durch vier Türen, Ofen und Fenster belastet ist, so kann man eine solche Bauweise nur als familienfeindlich betrachten. Leider sind aber die mit Fondshilfe gebauten Wohnungen nicht wesentlich besser. Es wurden langwierige Linter-suchungen angestellt, wie man durch raffiniertes Zusammenlegen von Küche und Bad das eine oder andere Meter Abfallrohr einsparen kann. Allerdings meist ohne Rücksicht darauf, daß die Küche dem Wohnen, das Bad aber dem Schlafen zugeordnet ist, und diese berühmte Installationswand oft den Wohnungs-grundriß verdirbt. Es wurden Mindestmauer-stärken und Mindestrauchfangquerschnitte erforscht, aber man vergaß den familiengerechten Zuschnitt der Wohnung. Das Ergebnis ist eine Wohnstelle, kein Heim. Dabei wird, etwa in den nordischen Ländern, schon seit Jahrzehnten, gerade dieses Problem des Wohn- und Siedlungsbaues gründlich erforscht.
Ist es nun denkbar, für eine vier- bis sechsköpfige Familie innerhalb eines diskutablen finanziellen Rahmens (180.000 Schilling) eine entsprechende Wohnung zu schaffen?
Eine mögliche Lösung dieser Frage soll hier als Beitrag zu dem Problem des familiengerechten Wohnens aufgezeigt werden. Im Zentrum der Wohnung liegt ein Installationskern. Er faßt aufs rationellste WC, Bad, Wohnungsheizung und Kochgruppe zusammen, dies aber derart, daß er den Wohnungsverband funktionsgemäß teilt und ordnet. Wir betreten die Wohnung und befinden uns in einer Pufferzone. Hier wird der Postmann, Gaskassier und so weiter abgefertigt. Hier ist Kleiderablage, WC, Abstellraum zugänglich gemacht und einerseits der Wohnraum, anderseits der Spielflur vor den Schlafräumen erschlossen. Der ausreichend große Wohnraum geht in eine Wohnloggia über. Der Wohnraum ist der Ort des Beisammenseins der ganzen Familie, hier werden Gäste empfangen, Feste gefeiert, hier herrscht eine Atmosphäre der Ordnung und Ruhe. Verbunden mit dem Wohnraum ist eine Zone, die im besonderen das Reich der Hausfrau ist. Gegen den Installationskern zu ist hier (natürlich mit Dunstabzug) Herd, Abwasch, Kühlschrank, Küchenschränke und Arbeitspult dermaßen zusammengefaßt, daß das ganze mit einem Griff durch den Vorhang abgedeckt werden kann. Gleich gegenüber ist der Eßplatz und Raum für einen Arbeits- und Nähplatz der Hausfrau. Der ganze Raum, für den die Bezeichnung Wohnküche im alten Sinne nicht recht paßt, ist einerseits durch eine wandhohe Schiebetür eng mit dem Wohnraum verknüpft, anderseits ebenso mit dem Spielflur vor den Schlafräumen. So ist die Mutter nicht in ein Kochgefängnis gesperrt, und in den wenigen Stunden, in denen heute die Familie beisammen ist, von dieser nicht isoliert. So kann sie leicht die Kinder beaufsichtigen, eine schnelle Mahlzeit verabreichen und doch an der Unterhaltung teilnehmen. Es war ja schon immer so, seit der Steinzeit, daß das Bereiten der Mahlzeit zum Wohnen im engsten Sinne gehört. Um so mehr heute, wo vorverarbeitete Nahrungsmittel und moderne Geräte das Kochen rascher, sauberer und leichter machen, kaum mehr Hauspersonal dafür zur Verfügung steht und die Familienmitglieder sowieso zuwenig Zeit füreinander haben. Der anschließende Spielflur erhält Tageslicht, er hat zum Teil abwaschbare Wände und ist ein Raum, in dem sich die Kleinen wirklich bewegen und austollen können. Der eigentliche Wohnraum, die Haushaltszone und der Spielflur können raumpsychologisch zu einem Kontinuum zusammengefaßt werden, zu einer großen „Zone des Familienlebens“. Die Schlafräume schließlich möchten wir lieber „Räume des Individuums“ nennen. Hierhin soll man sich zurückziehen können, wenn man einmal allein sein will. Hier sollen die heranwachsenden Kinder Raum für das Entfalten ihrer individuellen Welt finden. Selbstverständlich sollen Einbauschränke diese Räume von der Stapelfunktion entlasten, ihr Außmaß über das von reinen Bettzellen hinausgehen.
So, glauben wir, müßte eine Wohnung beschaffen sein, die einer Familie ein Heim werden kann.
Die Entwicklung zu solchen Wohnfigurationen ist international. Mies van der Rohe zum Beispiel verwendet sie bei seinen amerikanischen Millionärsvillen, die Arbeitsgruppe 4 für ein kleines Einfamilienhaus in Oberösterreich. Auf Grund unserer Studien scheint uns dieses Prinzip (zentraler Installationskern als Ordnungsfaktor des Wohnungsverbandes) auch für den Bau familiengerechter rationeller Etagenwohnungen günstig. Man entspricht ja so einer Hauptforderung familiengerechten Bauens, nämlich Wohnen als einen lebendigen Ablauf des Familienseins zu erkennen. Dies aber ist wichtig, wollen wir Heimstätten von bleibendem Wert schaffen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!