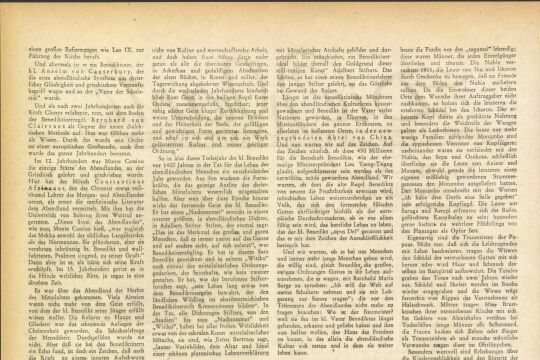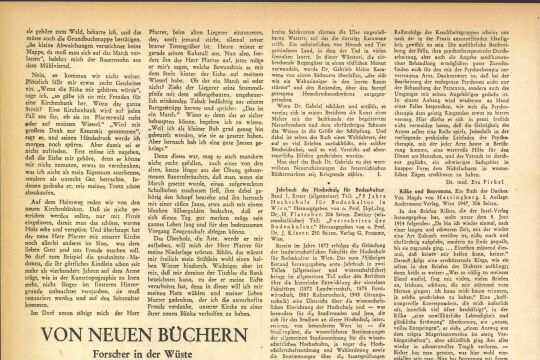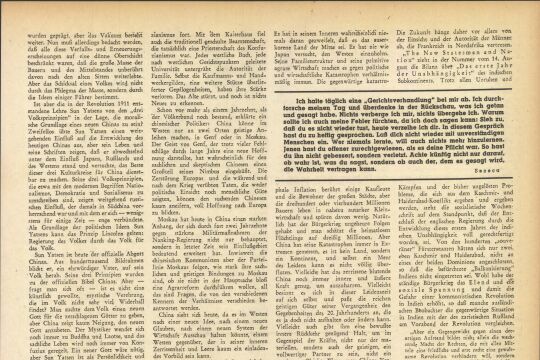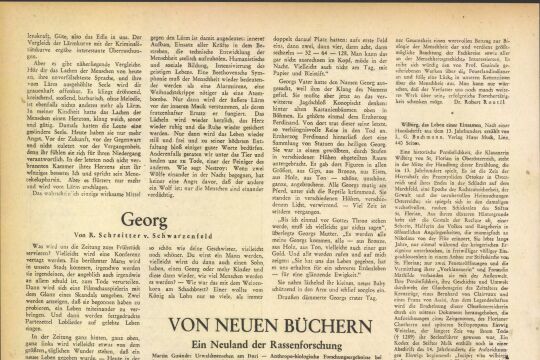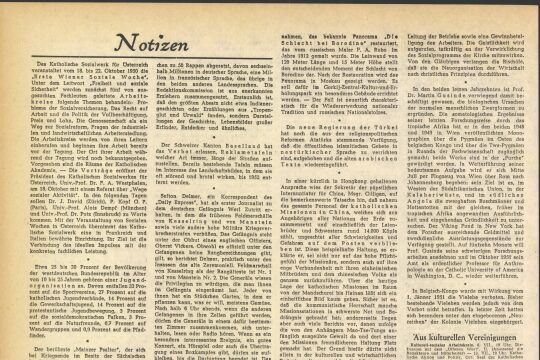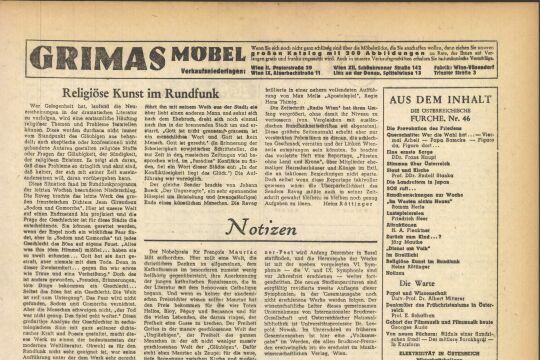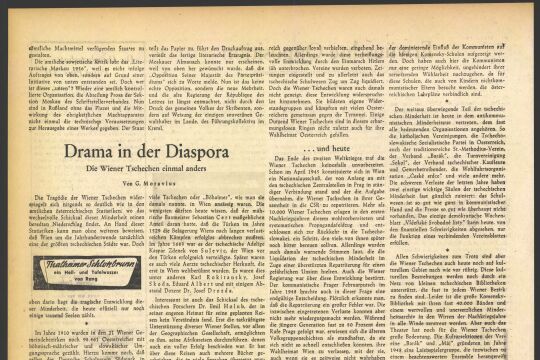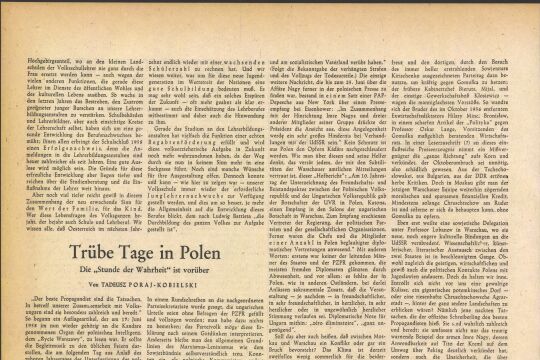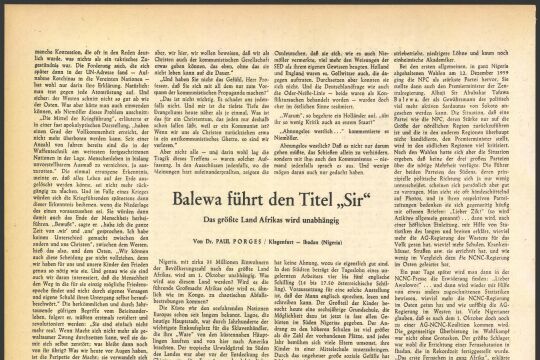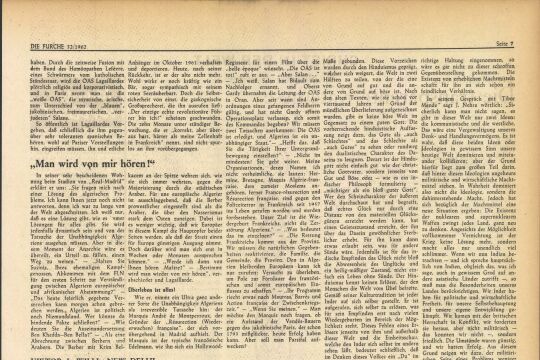Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Woder Pfeffer wächst
Auf der Nanzan-Universität in Nagoya, Japan, die vor zehn Jahren von St.-Gabrieler Missionären begründet wurde, ist derzeit der weltbekannte Pygmäenforscher P. Gusinde mit ehrenvollen Aufgaben betraut. P, Gusinde hat am 19. November v. J. im Flugzeug Wien verlassen und am 23. November „Zwischenstation” in Bombay gemacht — auf drei Monate, um genetische Zusammenhänge zwischen indischen Bergstämmen und den Uraustraliern zu überprüfen. Ueber diese aufsehenerregenden Feststellungen berichtet der folgende, am 21. Februar 1959 in Kalkutta an die „Furche” geschriebene Brief. „Die Furche”
Im Staate Madya Pradės und den ostwärts anschließenden zentralindischen Staaten Orissa, Bihar und Bengal lebt eine zusammengeballte Masse primitiver Eingeborener, noch dichter gedrängt als anderswo. Ihnen galt mein längerer Besuch. Die meisten von ihnen betreiben Ackerbau, verbunden mit bescheidener Viehzucht; sie folgen dabei noch heute einfachsten und wenig rentablen Methoden, deren viele frühere Generationen sich bedient haben. Die Lebenshaltung dieser etwa vier Millionen Menschen (Munda, Oraon, Santali, Mundari u. a. m.) ist nahezu gleichförmig, ebenso zeigt ihr Körpertypus weitgehende Annäherung. Da und dort haben sich „Kriminelle” dazwischengeschoben; eine Bezeichnung für Volksstämme, die, außerhalb jeder Kaste stehend, neben zeitweiliger Wildbeuterei mit einem primitiven Feldbau ihr Leben fristen (Korku, Bhil, Birhor und andere mehr, vorwiegend der Dravida- Sprachgruppe angehörig). Zur Trockenzeit lassen sich diese und andere im Dschungel hausenden Volksstämme mit einem Jeep oder Ochsenkarren von Missionsstationen her erreichen; dieser Umstand erleichtert völkerkundliche und rassenkundliche Forschungen in diesem Raum.
Zum vordringlichen Gegenstand meiner Beobachtungen hatte ich die sogenannten Hill Tribes (Bergstämme) in der wüsten Berglandschaft der westlichen Ghats gewählt. Die westlichen Ghats verlaufen parallel zur Malabarund Gochin-Küste im südwestüchen tadfen; dorti - also? „wo dümPfeffer wädist sich seit der ersten Landung der Portugiesen auszudrücken pflegt. Jene Eingeborenen gehören in überwiegender Mehrheit zur Tamil-, Marathan- bzw. Malayalam-Sprachgruppe; sie betreiben Feldbau in ausgedehnten, offenen Landflächen. Zwischen sie eingeschoben stehen mehrere Bergstämme (Muthuvan, Ulladam u. a. m.) als eine andersgeartete Siedlerschicht da. Ihre ältesten Vorfahren waren aus nördlichen Bereichen in dieses sehr schwer gangbare Rückzugsgebiet abgeschoben worden, sie selbst blieben hier ihrer eigenen Sprache und gewohnten Daseinswejse als Wildbeuter treu. Einzelne dieser Stämme (Kadar, Urali, Irula u. a. m.), heute nur mehr in geringer Kopfzahl anzutreffen, werden überraschenderweise von benachbarten Eingeborenen als „negerhaft” bezeichnet; zwar weniger wegen ihrer schwarzbraunen Hautfarbe, als vielmehr wegen ihrer niedrigen Körperhöhe und seltsamen Gesichtsbildung. Darin habe ich eindeutig australische Züge .erkannt; weswegen ich — außer anderen Gründen mehr — diese Primitiven jener uralten Bevölkerung anschließen möchte, die als Erst- besiedler des weiten südöstlichen Asien angesprochen werden dürfen. Nach dieser Erkenntnis, die ich als den wertvollsten wissenschaftlichen Ertrag meiner Indienreise veranschlagen möchte, läßt sich wohl ein genetischer Zusammenhang einiger altertümlicher Hill Tribes im Staate Kerala mit den A 11 a u s t r a 1 i e r n einschließlich der Ayom-Pygmäen herstelle n, deren Entdeckung auf den Schrader-Bergen in Neuguinea mir Mitte 1956 gelungen ist.
Unbeschreiblich mühsam und entkräftend war das Wandern und Klettern über die bewaldeten Gebirgszüge hinweg, wo die erwähnten Hill Tribes vor langen Jahrhunderten ihr sicheres Geborgensein gefunden haben. Eine ausreichende Genugtuung für alle Anstrengungen gewährte mir das Erleben richtiger, in weiten Tälern aufgestellter Dolmen (kelt. „Steintische”, Megalithgräber), die zu vielen Hunderten auch die Bergwände selbst bis 1200 Metei- hinauf anfüllen. Eine kopfzahlreiche Bevölkerung seßhafter Lebensweise muß sie zwecks der sogenannten zweiten Beerdigung errichtet haben. Niemand weiß, welchem Rassentypus sie an gehört hat. Dort sah ich, wie die Straßenbauer jetzt Hunderte jener schweren Steinplatten zu Schotter zermalmen und diesen einstampfen. Auch anderswo in Indien gibt es dergleichen Megalithbauten; alle von wesentlich gleicher Bauanlage und wahrscheinlich von Leuten aus der Drawida - Sprachgruppe zusammengefügt. Noch gelang es nicht, die Zeitperiode festzulegen, wann jene Megalithkultur, die vermutlich zwischen 700 und 400 vor Christi Geburt im südlichen Indien eingedrungen und von dort nach Norden vorgeschoben worden ist, sich endgültig auflöste.
Als eine sehr dringende Aufgabe für die indischen Linguisten erachte ich, die isolierten Sprachen jener uralten Bergstämme methodisch und vollständig aufzunehmen. Auch jene Eingeborenen werden jetzt Jahr um Jahr fortschreitend intensiver in die Zivilisierungsbestrebun- gen der indischen Behörden einbezogen; allerdings, so scheint es mir, betreibt man diesen Umschulungsprozeß auch der Urbevölkerung viel zu hastig.
Ziel solcher gigantischen Bemühungen ist nicht etwa ein Ueberführen des bodenständigen Indertums in die Lebensart des „Westens”. Wie die hinduistische Weltanschauung früher im titanenhaften Ringen mit der Riesenmacht des Islam nach Jahrhunderten schließlich doch als Sieger hervorgegangen ist, stenant sie sich gegenwärtig gegen ein grundsätzliches „Ver- westlichen” mit ihrer lebendigen Abwehrkraft in allen Sparten des öffentlichen und privaten Lebens; sogar bei den „Adibasis” (Urbevölkerung) wurde neuestens eine geschulte Truppe hinduistischer Missionäre eingesetzt. Ein Mitteleuropäer, dpr, Indien überfliegend, sich in Bombay-Stadt eine Woche aufgehalten hat, schrieb kürzlich (vgl. „Die Furche”, Nr. 49, 1958), „daß das Kastenwesen mehr und mehr zusammenbricht …, daß ganze Rinderherden zum Geschlachtetwerden in Bombay hineingetrieben” werden. Nun, schon die britische Verwaltung hatte gebilligt, in Bombay und Kalkutta Rindvieh zu schlachten; was bis heute beibehalten wird. Daß kürzlich, obwohl noch erfolglos, die Hindu-Gruppe eine Gesetzesvorlage gegen die erwähnte Konzession eingebracht hat, rückte ein Erstarken des Hindutums deutlich ins Tageslicht. So auch das ernste Ringen, die englische Sprache im ganzen Lande durch ein obligatorisches Hindi zu ersetzen u. a. m. Mag es auch im schweren Gebälk des indischen Kastenwesens da ufiid dort knistern; wer so viele Gelegenheiten findet — wie sie sich mir geboten haben —, um hinter die Fassade zu schauen, wird überzeugend dessen bewußt werden, mit welch hohem Grade von Selbstsicherheit das Hindutum sich seit der Landesunabhangiąkeit behauptet und auswirkt.
Gegenwärtig betätigen die zentralen und die einzelstaatlichen Behörden ein vielseitiges Bemühen, die Lebensform und Existenzbedingungen der etwa 20 Millionen Adibasis zu heben beziehungsweise schnellstens zu vervollkommnen; eben, weil sie Landeskinder sind. Für dieses grundsätzlich humanitäre Ziel werden ansehnliche Geldsummen ausgeworfen. Zahlreiche Dienststellen erstehen noch immer, deren Beamten sich der allgemeinen wie individuellen Betreuung der Eingeborenen widmen. So stehen für die Aufbesserung der altmodischen land- und viehwirtschaftlichen Praktiken geschulte Sachberater zur Verfügung; in ein modernes Selbstverwaltungswesen werden selbst die primitivsten Volksstämme eingestellt, deren ursprüngliche Gesellschaftsform überhaupt keine Gliederung oder Schichtung oder Berufsgruppen in ihrer Gemeinschaft kennt. Tausende Jugendliche beiderlei Geschlechts erhalten völlig kpstenlose Schulung und individuelle Beratung ii§ Kollegien und, technischen -BildungsStätteh.
Man hat ein eigenes „System of reservations for tribal applicants” eingerichtet, durch dessen Vermittlung alle jugendlichen Eingeborenen, kaum, daß sie ihre dreijährige oder längere Ausbildung beendet haben, eine angemessene Anstellung bzw. Berufsbeschäftigung erlangen. Volksschulen für Kleinkinder gibt es jetzt nahezu überall dort, wo eine nennenswerte - Volksgruppe siedelt. Bestens beeindruckt hat mich das „Tribal Social Education Organisers Training Center” in Ranchi (Staat Bihar), das einzige seiner Art, wo Beamte für die vielfältige Betreuung der Adibasis herangebildet werden. Dorthin wurde ich zu einem Vortrag gerufen, damit ich mich zu den Methoden dieses Training Center beratend äußere, auf Grund meines langjährigen Zusammenseins mit Eingeborenen in anderen Kontinenten. In der gleichen Stadt Ranchi besteht außerdem seit kurzem ein „Tribal Research Institute” unter Leitung des mir langjährig befreundeten Doktor B. S. Guha; es bildet Ethnologen und Linguisten aus, die beim ständig anwachsenden Akkulturationsprozeß als Sachberater mitwirken sollen. Wie ersichtlich, bemüht sich die indische Regierung außerordentlich rege zum Vorteil ihrer Urbevölkerung.
Der hier kurz gekennzeichnete Umschulungsprozeß bringt es unausweichlich mit sich, daß altüberliefertes Kulturgut der Eingeborenen zutiefst umgeformt oder völlig ausgelöscht wird und deshalb unerreichbar untergeht. Vieles davon in methodischer Forschung rasch aufzunehmen, ist ein ernstes Gebot der Stunde; handelt sich ja unbestreitbar um Geiste güte von höchstem und oft einmaligem Eigenwert für die Geschichte der frühen Menschheit. Dessen sind sich die anthropologischen Fachkreise in Indien wohl bewußt.
Dabei helfen auch einige Oesterreicher erfolgreich mit. Nennen möchte ich wenigstens P. Dr. Stephan Fuchs SVD., in Graz gebürtig und ein guter Kenner der zentralen Primitivstämme; er War mir ein hilfsbereiter Begleiter beim Wandern durch die Western Ghats. Außerdem Dr. Ehrenfels, langjähriger Professor für Ethnologie an der Universität zu Madras. Dort fand ich überdies manche Anregung und Hilfe von seiten Doktor Oberhammers von Indologischen Institut der Universität Wien, der kommenden Mai einen zweijährigen Studienaufenthalt in Indien beschließen wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!