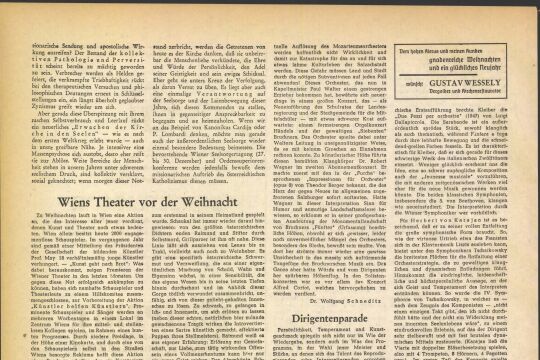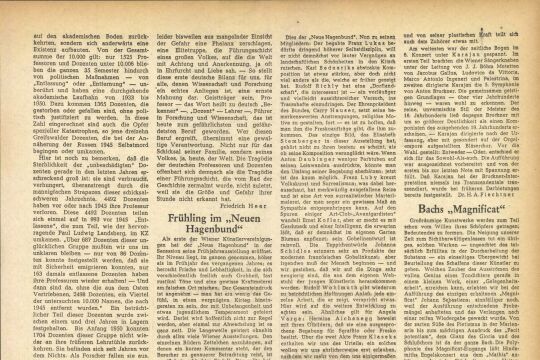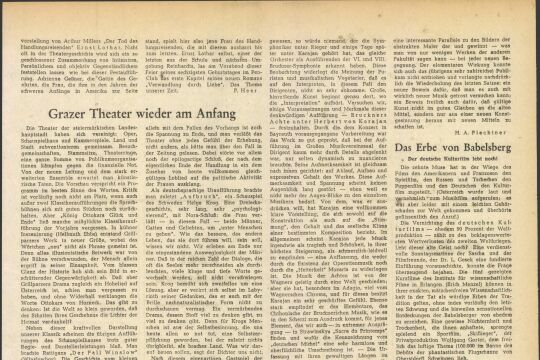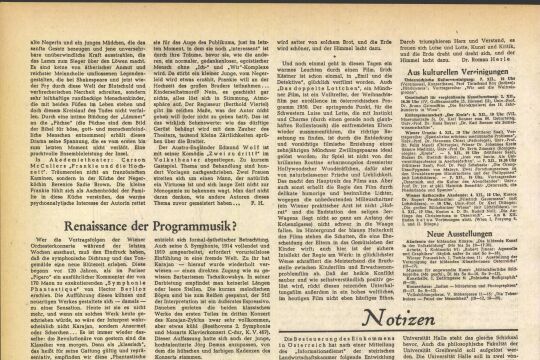Am 5. April wäre der Dirigent 100 Jahre alt. Ein Porträt von Walter Dobner
Ahnte Herbert von Karajan, dass es zu Ende ging? Von seiner letzten Tournee mit den Wiener Philharmonikern im Februar 1989 in New York wird berichtet, dass er nach einer umjubelten "Achten Bruckner" gesagt haben soll, dieses Stück habe nicht er, sondern ein anderer dirigiert. Am 23. April traf er mit den "Wienern" nochmals zusammen: für Bruckners "Siebente", die er auch für Platte einspielte. Ein packendes, erschütterndes Dokument.
Davor lag sein letzter Auftritt mit "seinen" Berliner Philharmonikern: am 21. und 27. März das Verdi-Requiem bei den Salzburger Osterfestspielen. Aber schon davor bat Karajan Riccardo Muti, für ihn dieses Requiem im Sommer bei den Festspielen in Salzburg zu dirigieren, weil er mit seinem Berliner Orchester nicht mehr auftreten wolle. Muti sagte schließlich zu, nicht wissend, dass diese beiden Aufführungen zu Karajans eigenem Requiem werden würden. Denn dazwischen, am 16. Juli, verstarb er, inmitten eines Gesprächs mit zwei Sony-Managern, darunter seinem Freund Norio Ohga.
Die Musikwelt war geschockt, in Salzburg musste man handeln. Die Festspiele suchten nach Muti für eine Aufführung des Mozart-Requiems zum Andenken an Karajan. Besetzt werden musste auch die Oper, die sich Karajan für diesen Festspielsommer reserviert und die er zuvor nie dirigiert hatte: Verdis "Un ballo in maschera". Die Platteneinspielung konnte er noch vollenden, nicht aber die Probenarbeit. Schließlich dirigierte Sir Georg Solti.
Der neue König
"Le roi est mort, vive le roi!", stand auf einem anonymen Telegramm, das Karajan Ende November 1954 in Rom erreichte. "Mein Sekretär Mattoni ging eine Zeitung kaufen. Darin stand: Furtwängler ist tot", schilderte Karajan seinem Biografen Ernst Hauesserman diese Situation. Der Rest ist Geschichte: Im Nachfolgekampf um den Chefposten bei den Berliner Philharmonikern ging Karajan als Sieger hervor. Chefdirigent auf Lebenszeit hatte er sich ausbedungen, und einen solchen, heute unvorstellbaren Vertrag hat er auch erhalten.
Aber nicht alles lässt sich planen. Das musste auch der "Generalmusikdirektor Europas" - wie man Karajan nannte, während der Zeit, als er von einer Musikmetropole zur anderen jettete - zur Kenntnis nehmen. Spätestens als sich das Orchester gegen die Aufnahme der Klarinettistin Sabine Meyer wehrte, sodass sie aus eigenen Stücken ging, war das Band zwischen dem Chef und seinen Musikern so gut wie zerrissen. Karjan trat die Flucht nach vorne an. Als ihn Ende April 1989 die damals neu im Amt befindliche Berliner Kultursenatorin Anke Martiny in Anif aufsuchte, um mit ihm über seine künftigen Berliner Aktivitäten zu reden, überreichte er ihr jenen Brief, indem er mitteilte, dass er seine "Arbeit als künstlerischer Leiter und ständiger Dirigent des Berliner Philharmonischen Orchesters beende". Mit "heutigem Tag": das war der 24. April 1989.
War es ein bewusstes Durchtrennen dieses auf Dauer angelegten Bandes? Wollte Karajan, wie sein Intendant Wolfgang Stresemann in seinen Karajan-Erinnerungen mutmaßt, einfach nur gebeten werden? Hatte er künftig anderes vor?
Was bleibt von Karajan?
Schon Stresemann wirft in seinem Erinnerungsband "Ein seltsamer Mann" die Frage auf, was von Karajan bleiben wird. Ist er für die einen mit Toscanini und Furtwängler der wichtigste Dirigent des vorigen Jahrhunderts, gilt er anderen als Wahrer einer längst überholten Ästhetik, der sich bis zuletzt hartnäckig dagegen wehrte, die Tür der Salzburger Festspiele einem interpretatorischen Antipoden zu öffnen wie Nikolaus Harnoncourt, den er einst als Chefdirigent der Wiener Symphoniker persönlich (!) für die Cellogruppe des Orchesters engagiert hatte.
Kaum einer beherrschte so wie er die Kunst einer natürlichen Phrasierung, die freilich stets das Resultat harter Arbeit war, beschreibt Riccardo Muti eines der Charakteristika des Interpreten Karajan. Christa Ludwig wird bis heute nicht müde, Karajan mit Bernstein und Böhm als ihre idealen Dirigenten zu nennen, weil alle drei um die Kunst des Begleitens wussten.
Kaum einer der Dirigenten, die heute zwischen 50 und 75 sind, denen Karajan nicht durch gezielte Einladungen zu den Berliner Philharmonikern und nach Salzburg erst den entscheidenden Karrieresprung ermöglichte. Nicht zu vergessen, wie sehr er sich um die finanziellen Belange seiner Berliner Philharmoniker kümmerte, die dank Platten und Videos zum bestbezahlten Orchester der Welt aufstiegen.
Ebenso groß ist Karajans Verdienst, was die Schaffung einer Orchesterakademie angeht, aus der nicht nur die "Berliner" ihren Nachwuchs rekrutieren können, und überhaupt sein Interesse für die Förderung des solistischen Nachwuchses. Man braucht nur an seine Lieblingsgeigerin der letzten Jahre, Anne-Sophie Mutter, oder den Solisten seines letzten Berliner Silvesterkonzerts, den Pianisten Jewgeni Kissin, zu denken. Mit seinem ausdrücklichen Bestemm, Opern grundsätzlich in der Originalsprache aufzuführen, hat Karajan bis heute die internationale Opernszene geprägt.
Nur ein Klangesoteriker?
Genug, was von Karajan bleibt, und doch: Wie steht es um den Interpreten Herbert von Karajan? "Karajan prägte das Musikleben, wahrscheinlich auch das der Zukunft, aber nicht die Musik", resümiert Rainer Bischof, langjähriger Generalsekretär eines einstigen Karajan-Orchesters, der Wiener Symphoniker, in seinem Essay zu einem von Erich Lessing zu Karajans Geburtstag herausgekommenen, aufschlussreichen Fotoband. "Man warf ihm vor, nur der Schönheit der Musik sich verpflichtet zu fühlen, nicht aber dem Wahrheitsgehalt, dem, was an existentieller Bedrohung, Angst, Lebenskampf, Trauer, Schmerz, in und hinter den Noten steht, also die Schattenseiten des Lebens zu verdeutlichen", resümiert Bischof die schon zu Karajans Lebzeiten zuweilen geäußerte Kritik. Und der Berliner Musikkritiker Peter Uehling formuliert in "Karajan. Eine Biographie": "Indem Karajan Rhythmus und Klang in den Mittelpunkt stellt und dem Melos, das Ausdruck und Motivik in erster Linie trägt, geringere Bedeutung zuweist, erhalten seine Interpretationen ein gleichsam abstraktes Gepräge."
Ein Ansatz, der Karajans Modernität beweisen soll, vom Autor aber ohne die nötige Stringenz weitergeführt wird. Zu wenig fundiert fallen die Vergleiche mit Furtwängler, Toscanini, Boulez und Harnoncourt aus, nie formuliert Uehling den Maßstab, nach dem er bewertet. Zudem: Wie lässt sich dieses Urteil mit dem exemplarischen Puccini- und Richard Strauss-Interpreten Karajan in Einklang bringen?
Eine Dissonanz
Mythos oder Verklärung? Auch zu Karajans 100. Geburtstag werden die Diskussionen über diesen ersten Jet-Setter am Dirigentenpult, der wie kein anderer zuvor die technischen Möglichkeiten nutzte, um Musik allen zugänglich zu machen, nicht aufhören. Die romantische Ästhetik, in der er erzogen wurde, hat er zu höchster Perfektion gesteigert. Mit plattem Schönklang hat dies nichts zu tun. So reüssieren kann nur, wer sein Metier bis ins Detail beherrscht. "Eine Dissonanz ist noch lange keine Entschuldigung für scheußliche oder unsaubere Töne", sagte Karajan in einem Interview. Was er damit meinte, hat er spätestens mit seiner beispielhaften Einspielung von Werken der Zweiten Wiener Schule dokumentiert. Solche Resultate lassen sich nur erzielen, wenn man auch die Struktur der Werke bis ins Detail versteht.
Man braucht Karajan weder zum Mythos zu stempeln noch zu verklären. Sein Lebenslauf und die vielfachen, gerade zu diesem Geburtstag edierten Tondokumente beweisen, dass auch für ihn gilt, was einst auf seinen Berliner Vorgänger Furtwängler gemünzt war: ein Maßstab, den man heute schmerzlich vermisst. Mit allen Widersprüchen in seiner Person und auch in seinem zuweilen unbeugsamen Beharren in überkommenen Traditionen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!