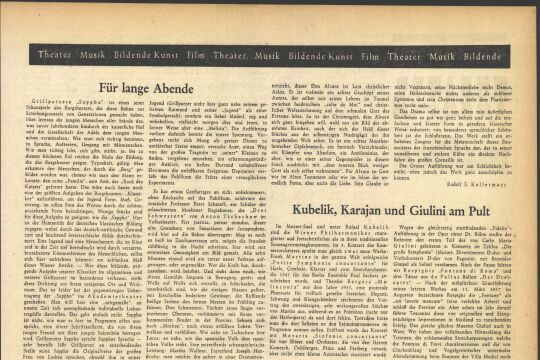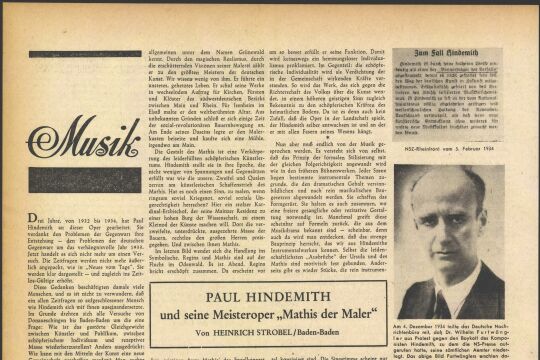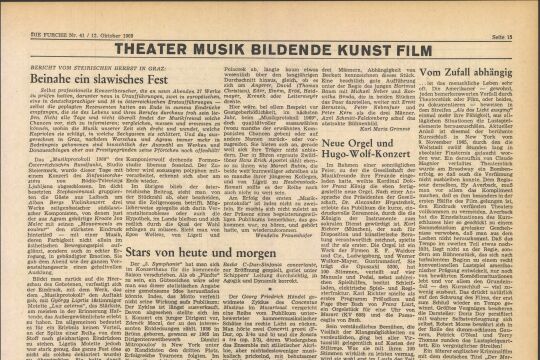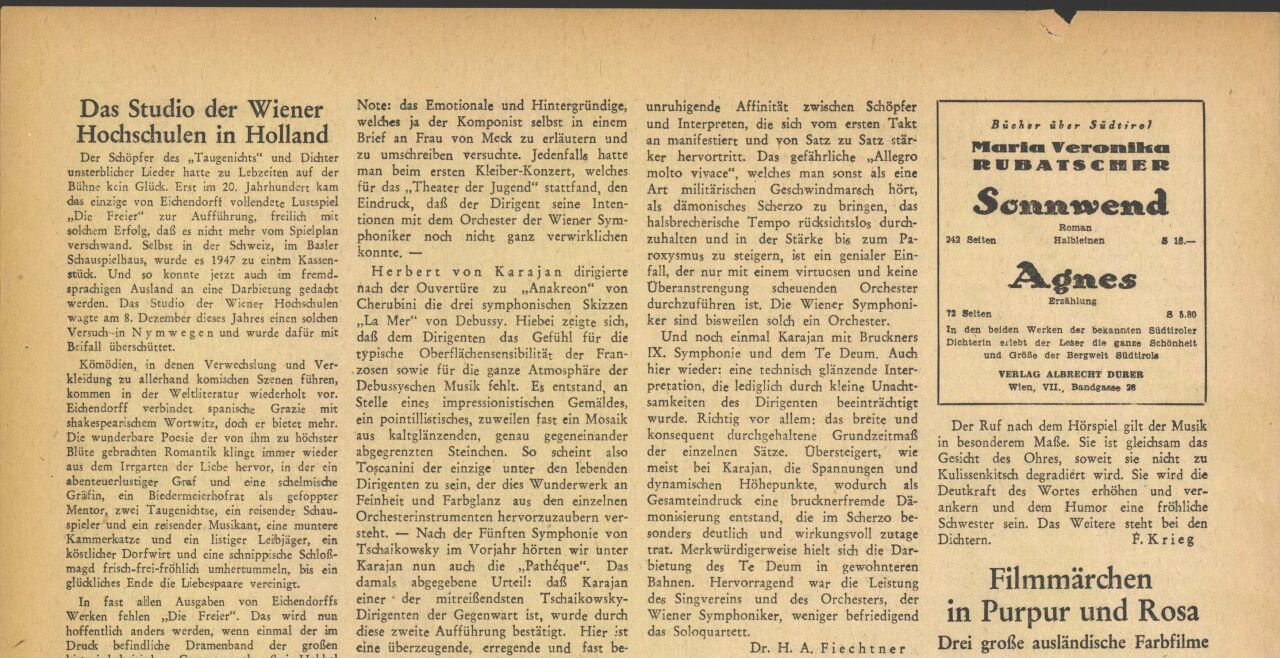
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Meisterdirigenten
Während der letzten Wochen hatten wir Gelegenheit, drei Dirigenten mit unseren Orchestern musizieren zu hören, die zusammen mit einigen anderen jenes halbe Dutzend bilden, das Weltruf hat. — Wilhelm Furtwängler brachte als einziger im Zweiten Philharmonischen Abonnementskonzert eine Novität: William Waltons 1934/35 entstandene Erste Symphonie. Diese Musik ist insofern sehr merkwürdig, da ihre Inspiration in allen Teilen gleichsam „aus zweiter Hand” kommt und die trotz- . dem zu interessieren, ja zu fesseln vermag. Respighi und Strauß, Debussy und Strawinsky klingen an; und doch: in Aufbau und Klang ein großer Wurf. Das Werk überzeugt vor allem durch seine konzise Form und die scharfe, wirkungsvolle Kon- trastierung der einzelnen Teile. (Daß Walton ein glänzender Instumentator ist, konnten wir schon bei der Aufführung seines Violin- und Bratschenkonzerts sowie des Oratoriums „Belsazar” feststellen.) Diese Erstaufführung stand zwischen der Ouvertüre zum „Freischütz” und Tschaikowskys Fünften Symphonie. In diesem Werk verwirklichte Furtwängler eine vollkommene Synthese zwischen der persönlichen Aussage des Komponisten und der großen Form der romantischen Symphonie, innerhalb welcher diese Aussage geschieht. Die Philharmoniker folgten dem Dirigenten bis an die Grenze der physischen Leistungsfähigkeit und schenkten uns einen großen, festlichen Abend.
Erich Kleiber begann mit der selten gespielten, kraftvollen und im üppigen Streicherklang schwelgenden Ouvertüre zu „Berenice” von Händel, deren Larghetto mit Recht dem berühmten Largo aus „Xer- xes” an die Seite gestellt wird. — Nach der mit großer Klarheit und Leichtigkeit nachgestalteten Symphonie G-dur („mit dem Paukenschlag”) folgte von Haydn als Hauptstück Tschaikowskys Vierte Symphonie. Unter den drei gleichrangigen Schwestern ist sie wohl die weitaus heikelste. Kleiber hat beides: den Schwung und die zeichnerische Klarheit, welche die Form des Werkes bestimmt. — Was der Aufführung fehlte war die spezifisch Tschaikowskysche Note: das Emotionale und Hintergründige, welches ja der Komponist selbst in einem Brief an Frau von Meck zu erläutern und zu umschreiben versuchte. Jedenfalls hatte man beim ersten Kleiber-Konzert, welches für das „Theater der Jugend” stattfand, den Eindruck, daß der Dirigent seine Intentionen mit dem Orchester der Wiener Symphoniker noch nicht ganz verwirklichen konnte.
Herbert von Karajan dirigierte nach der Ouvertüre zu „Anakreon” von Cherubini die drei symphonischen Skizzen „La Mer” von Debussy. Hiebei zeigte sich, daß dem Dirigenten das Gefühl für die typische Oberflächensensibilität der Franzosen sowie für die ganze Atmosphäre der Debussyschen Musik fehlt. Es entstand, an Stelle eines impressionistischen Gemäldes, ein pointillistisches, zuweilen fast ein Mosaik aus kaltglänzenden, genau gegeneinander abgegrenzten Steinchen. So scheint also Toscanini der einzige unter den lebenden Dirigenten zu sein, der dies Wunderwerk an Feinheit und Farbglanz aus den einzelnen Orchesterinstrumenten hervorzuzaubern versteht. — Nach der Fünften Symphonie von Tschaikowsky im Vorjahr hörten wir unter Karajan nun auch die „PatWque”. Das damals abgegebene Urteil: daß Karajan einer ‘ der mitreißendsten Tschaikowsky- Dirigenten der Gegenwart ist, wurde durch diese zweite Aufführung bestätigt. Hier ist eine überzeugende, erregende und fast beunruhigende Affinität zwischen Schöpfer und Interpreten, die sich vom ersten Takt an manifestiert und von Satz zu Satz stärker hervortritt. Das gefährliche „Allegro molto vivace”, welches man sonst als eine Art militärischen Geschwindmarsch hört, als dämonisches Scherzo zu bringen, das halsbrecherische Tempo rücksichtslos durchzuhalten und in der Stärke bis zum Paroxysmus zu steigern, ist ein genialer Einfall, der nur mit einem virtuosen und keine Überanstrengung scheuenden Orchester durchzuführen ist. Die Wiener Symphoniker sind bisweilen solch ein Orchester.
Und noch einmal Karajan mit Bruckners IX. Symphonie und dem Te Deum. Auch hier wieder: eine technisch glänzende Interpretation, die lediglich durch kleine Unachtsamkeiten des Dirigenten beeinträchtigt wurde. Richtig vor allem: das breite und konsequent durchgehaltene Grundzeitmaß der einzelnen Sätze. Übersteigert, wie meist bei Karajan, die Spannungen und dynamischen Höhepunkte, wodurch als Gesamteindruck eine brucknerfremde Dämonisierung entstand, die im Scherzo besonders deutlich und wirkungsvoll zutage trat. Merkwürdigerweise hielt sich die Darbietung des Te Deum in gewohnteren Bahnen. Hervorragend war die Leistung des Singvereins und des Orchesters, der Wiener Symphoniker, weniger befriedigend das Soloquartett.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!