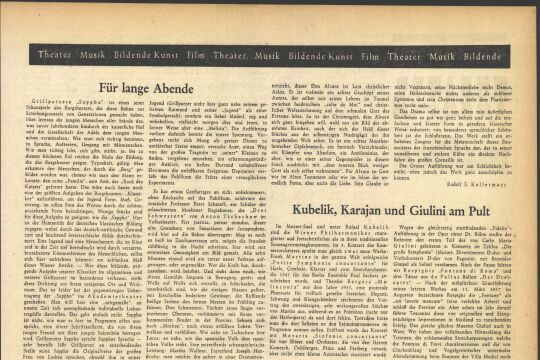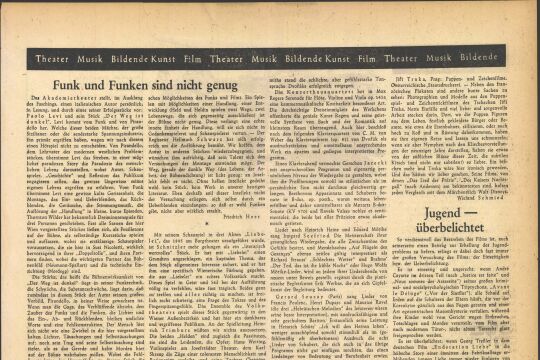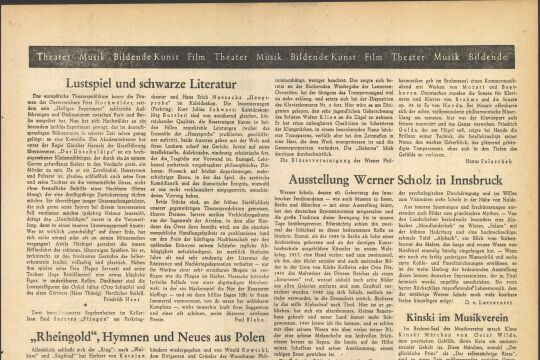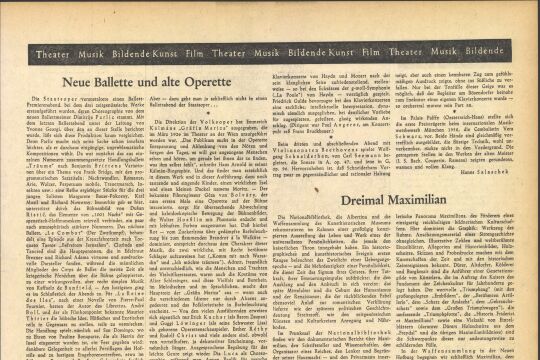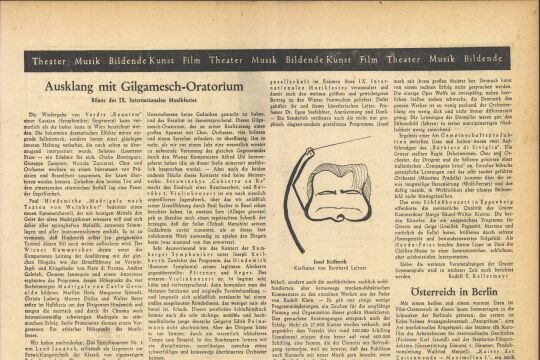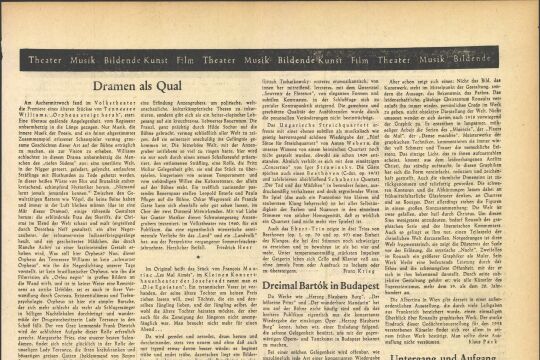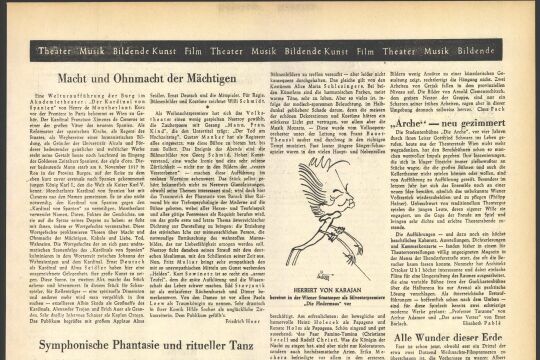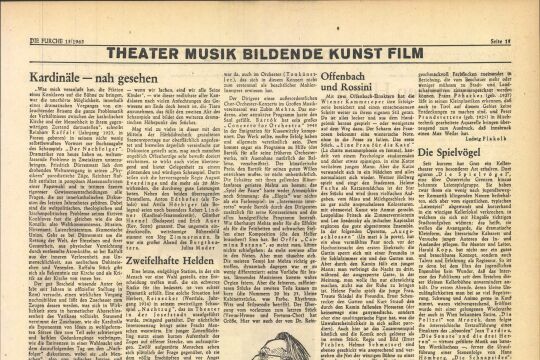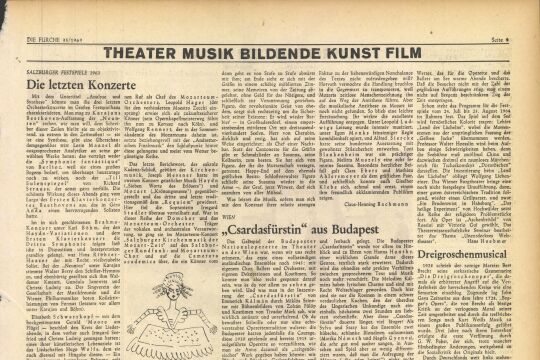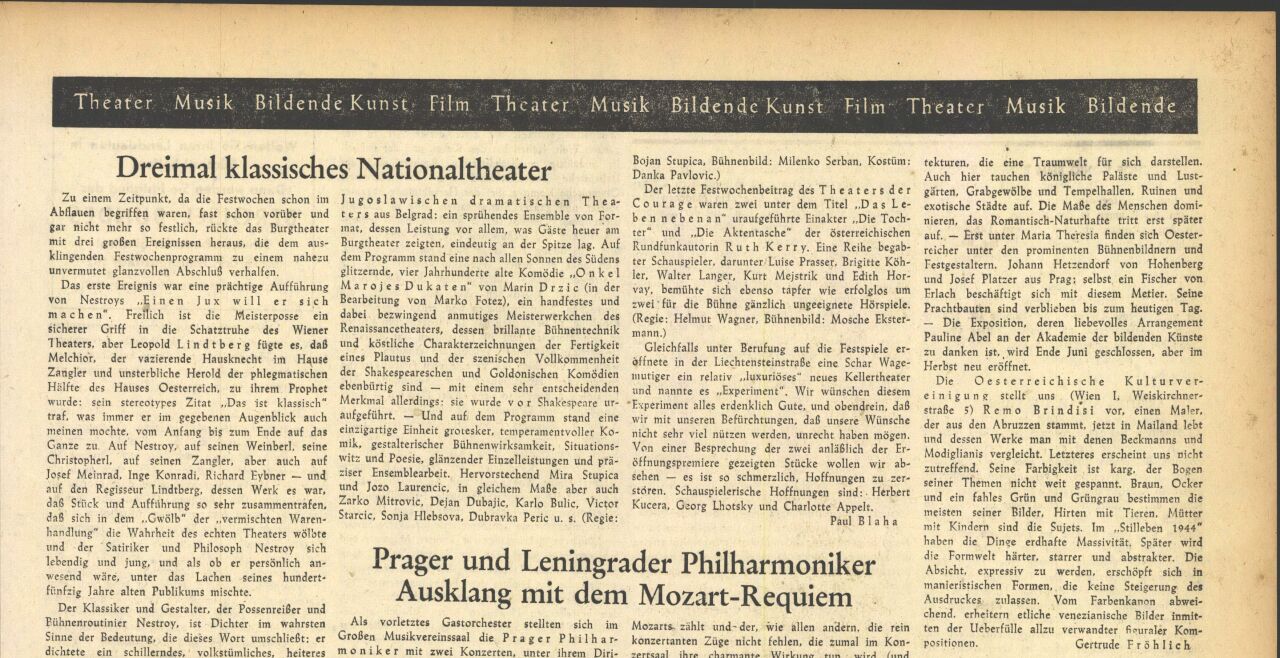
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Prager und Leningrader Philharmoniker Ausklang mit dem Mozart-Requiem
Als vorletztes Gastorchester stellten sich im Großen Musikvereinssaal die Prager Philharmoniker mit zwei Konzerten, unter ihrem Dirigenten Karel A n c e r 1 vor. Bereits äußerlich erscheint das Orchester als ein Ensemble von vorwiegend jüngeren Musikern, deren Training stärker zu spüren ist, als die Spieltradition bzw. die Individualität der einzelnen Musiker. Der Mozart der Prager (Symphonie D-Dur, genannt die „Prager“, und das von Yehudi Menuhin gespielte Violinkonzert in G) klangen — in stilvoller kleiner Besetzung — etwas dünn und schulmäßig. Mit der 5. Symphonie von Dvofak überraschten die Prager Gäste auf recht angenehme Weise, indem sie nämlich das spezifisch „Böhmische“ dieses Werkes keineswegs forcierten, sondern dieses leicht sentimental wirkende Werk einfach, temperamentvoll und mit durchweg rascheren Tempi, als hierzulande gewohnt, herunterspielten. Dvofäk ohne Pathos, Sentiment und Schleppfuß: das war ein erfrischendes Erlebnis! Die vielen Gäste und die Wiener haben die böhmischen Musikanten sehr lebhaft gefeiert und zur Draufgabe zweier böhmischer Tänze von Dwofäk ermuntert.
Daß die Leningrader Philharmoniker das beste Orchester Rußlands sind, wußte man; daß die Sowjets zur internationalen Konkurrenz, Wie sie sich beim Wiener Mozart-Fest ergab/nur ein Spitzenensemble schicken würden, war anzunehmen. Bei den Leningradern is't zunächst auch äußerlich einiges anders: Die neun Kontrabässe sind links oben postiert, davor fast der ganze Streicherkörper; die Pauken, in der Mitte rückwärts, sind schräg geneigt und befinden sich etwa in Brusthöhe des Spielers. Zum Klang: die Holzbläser stark näselnd, die Hörner — fagottartig, die Blechbläser im allgemeinen mit starkem Vibrato spielend. Zum Vortrag: Unter ihrem Chefdirigenten Eugen Mrawinski, einem etwa 40jährigen blonden Hünen, hörten wir Werke von Mozart, Tschaikowsky und Schostakowitsch; unter dem jüngeren Kurt Sanderling, der dem jungen Gustav Mahler ähnelt, spielten die Leningrader, die Ouvertüre zu „Benvenuto Cellini“ von Berlioz, das Violinkonzert von Mozart (mit dem unübertrefflichen, auf einer Stradivari mit silbrigem Ton spielenden David O i s t r a c h) und die 2. Symphonie von Rachmaninow. — Mozart interpretierten die Russen im Rokokostil: anmutig, niedlich und gewichtlos. Ihren Tschaikowsky fassen sie vor allem als einen weniger sentimentalen als leidenschaftlichen und glänzenden Komponisten auf. Die Leningrader lieben keinen gleichmäßigen Ton, keine weitgeschwungenen Bögen, keine gleichmäßig ablaufenden Tempi. Dynamisch und agogisch ist alles stets in heftiger, aber genau festgelegter Bewegung. Im blitzschnellen An- und Abschwellenlassen, in spontan wirkenden Beschleunigungen und' Dehnungen sind sie Meister. Dadurch wirkt ihr Spiel ungemein frisch und lebendig. Im Klang scheint keine Homogenität angestrebt. Die verschiedenen Instrumentalgruppen sind stets hörbar. Dadurch entsteht eine zusätzliche Polyphonie der Farben, die sehr reizvoll ist. So kommt es, daß man auch so abgespielten Stücken wie Tschaikowskys Fünfter und Sechster mit größter Spannung folgt. — Schosta-kowitschs erstaufgeführtes V isTi ti k on z e r t enttäuschte: nach einem zwar gut gearbeiteten, aber akademisch-spannungslosen 1. Satz (Npcturno), folgen zwei Burlesksätze in der bekannten Manier, die eine originelle Passacaglia mit enorm schwerer Kadenz umrahmen. Die Leningrader, ihre beiden Dirigenten und der Geiger Oistrach wurden mit ungewöhnlich starkem Beifall ausgezeichnet.
Helmut A. Fiechtner ?!.:,''.'..'- ' •-;•• •
Ein Konzert der Wiener Hofmusikkapelle (Wiener Sängerknaben, Mitglieder des Staatsopernchores und der Wiener Philharmoniker); unter Leitung von Dr. Anton Lippe war ein Fest schönen und glockenreinen Singens und stilgetreuer: Wiedergabe alter Motetten von Palestrina bis Bruck-, ner, deren sakraler Inhalt und klangliche Fülle, zu vorbildlicher Einheit gestaltet, echt kirchliche Ausdruckswelt offenbarte. Der zweite Teil des Programms war Werken Mozarts gewidmet: zunächst einem handgelenkleichten Offertorium „Venite populi“ für zwei Chöre und Streicher, sodann der Missa solemnis, KV 337, für Soli, Chor und Orchester. An dieser Messe, die zu den liebenswürdigsten
Mozarts- zählt und- der, wie allen andern, die rein konzertanten Züge nicht fehlen, die zumal im Konzertsaal ihre charmante Wirkung tun, wird (und wurde auch) wieder einmal offenbar, wie unbedeutend diese Züge sind gegen den dogmatischen Geist, der Mozarts Kirchenwerke von innen her erfüllt und sie zur einwandfreien Kirchenmusik stempelt, allerdings nur bei so vorbildlicher Wiedergabe, wie dies hier der Fall war.
Wiener Symphoniker und Singverein, traditionsreiche Partner des Zusammenwirkens, musizierten unter Robert Heger Mozarts Kantate „Davidde penitente“, KV 469, und J. S. Bachs „Magnificat“. Die Kantate Mozarts, die schon Teile der späteren c-moll-Messe enthält, mag an sich nicht das bedeutendste Werk Mozarts sein — die Wiedergabe war es leider auch nicht, besonders den Singenden mangelte die Ausgeglichenheit und letzte Beziehung auf einander in den einzelnen Teilen, und der Chor hatte einen schwachen Tag, was sich auch bei Bachs „Magnificat“ erwies, so daß die zwischen beiden Werken musizierten drei Kirchensonaten Mozarts (KV 278, 67 und 329) die rundeste Leistung boten, obwohl ihr „kirchlicher“ Gebrauch uns heute undenkbar scheint. in Spitzenleistungen großen Formats hat übrigens der Chor des Singvereins den schwachen Tag wieder mehr als eingebracht, zunächst in H ä n d e 1 s Riesenoratorium „S a m s o n“ unter Leitung von Josef Krips, der mit starker und sicherer Hand Solisten, Chor und Orchester zu gleicher Höhe führte und die großen Bogen Händelscher Architektonik in prächtigen Steigerungen übereinandertürmte. Gegen den „Messias“ ist das spätere Oratorium, der Samson, durch den passiven Helden im Nachteil (es wird nur der leidende Samson dargestellt); an Adel und Majestät des musikalischen Einfalls aber ist er ihm gieich, wenn es auch eines Händeis bedurfte, um dies zu erreichen. Von der langen Reihe der Solisten ist an der Spitze Otto Wiener zu nennen, der Oratoriensänger par excellence.
Es war sinnig und im besonderen Sinne völkerverbindend, das letzte der Mozart-Konzerte mit des Meisters „R e q u i e m“ zu gestalten und keinem Geringeren als Bruno Walter anzuvertrauen. Ebenso wie die vorangestellte Symphonie g-moll, KV 550, erhielt die Totenmesse aus seiner Hand die denkbar höchste Weihe der Wiedergabe. Bruno Walter, bescheiden als Diener am Werk wie nur ein ganz Großer sein kann, hielt nichtsdestoweniger jede Phrase, jede Solostimme, alle Chor- und Instrumentalgruppen jeden Augenblick in der Führung seiner Hand, und alles folgte in geweihtem Dienst willig dem treuen Diener Mozarts: die Solisten (Wilma Lipp, Hilde Rössel-Majdan, Dermota, Edelmann), der Chor und das Orchester (Philharmoniker). Dies Konzert war im lautersten Sinne das Geburtstagsgeschenk aller Beteiligten (wozu das Publikum in stärkster Spannung zählte) an Wolfgang Amadeus Mozart, den Zweihundertjährigen, Zeitlosen, Unsterblichen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!