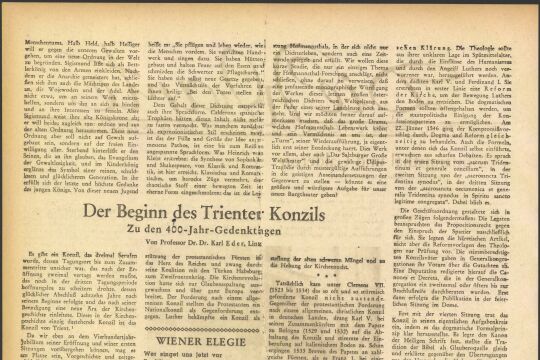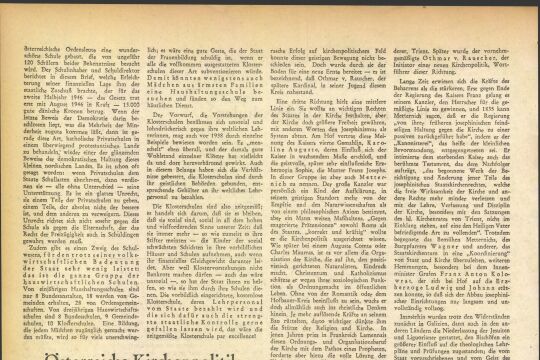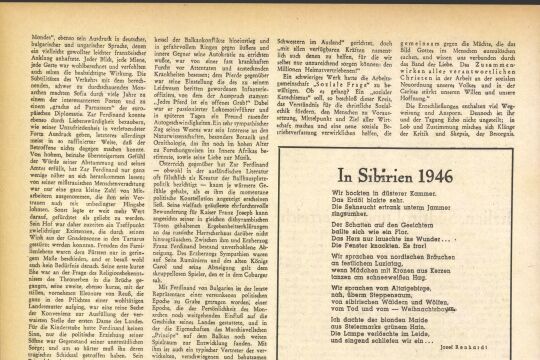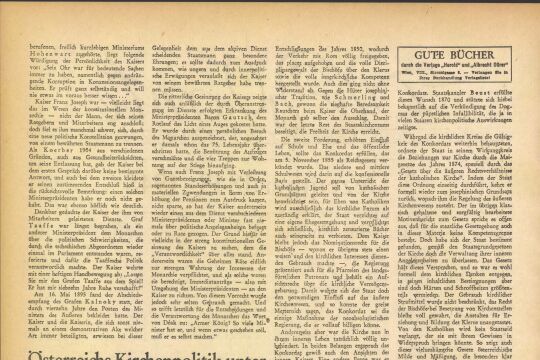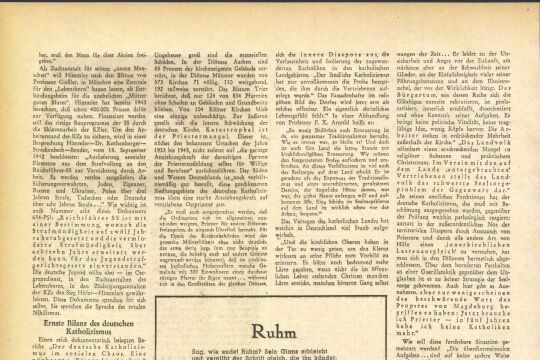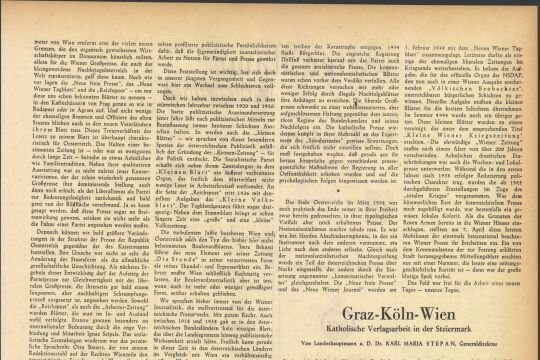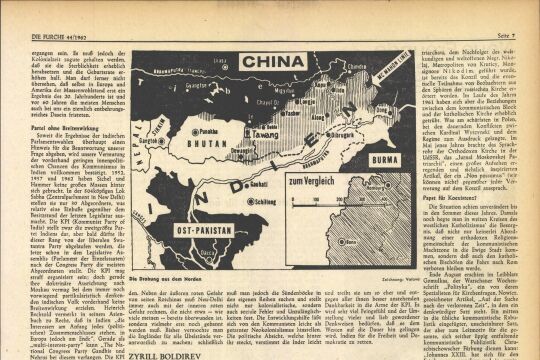Österreichs Kirche hat zwei Metropolen: Wien für das Donauland, Salzburg für das Älpen-land. Im Vergleich zur ehrwürdigen Tradition Salzburgs, die in das frühe Mittelalter zurückreicht, ist Wien immer noch eine junge Diözese, obwohl auch seine Geschichte sich nun zum halben Jahrtausend rundet. Diese Geschichte ist grundverschieden von der Entwicklung, die Salzburg seit den Tagen Ruperts und Virgils genommen hat. Die Größe der alten Bischofsstadt an der Salzach und ihrer geistlichen Fürsten lag ohne Zweifel auf kulturellem und künstlerischem Gebiet. Wien dagegen spielte als Residenz des Kaisers und als Hauptstadt eines mächtigen Reiches eine eminent politische Rolle. In den religiösen und kirchlichen Auseinandersetzungen seit dem Anbruch der Neuzeit stand das Bistum mehr als einmal an exponierter Stelle. So war es denn auch vornehmlich das Verhältnis zwischen Kirche und Staat, das diese 500 Jahre einer wechselvollen Geschichte prägte und von seinen verschiedenen Phasen her mehr oder minder stark den Weg in die Zukunft festlegte.
An einem markanten Punkt dieses Weges halten wir nun inne und versuchen, den Standort der Kirche von Wien nach einem halben Jahrtausend diözesaner Geschichte zu bestimmen. Dabei ist die runde Zahl eher Nebensache und nur kalendarischer Anlaß. Den Grund für die Besinnung auf Woher und Wohin entnehmen wir der Gegenwart, der Zeit, in der wir leben, nicht der Vergangenheit. Diese Zeit der Kirche ah der Schwelle des dritten Jahrtausends ist vom Zweiten Vatikanischen Konzil geprägt. Die Erneuerung der Kirche, die Johannes XXIII. in Angriff nahm und Paul VI, fortsetzte, muß von der weltweiten Ebene des Konzils in die Länder und Diözesen, in den Alltag der christlichen Gemeinden, in die Praxis tausendfältigen Lebens getragen werden. So fiel in Wien die 500-Jahr-Feier des Bistums zusammen mit dem Auftakt zur Diözesansynode, deren Aufgabe ja die Erneuerung unserer Kirche im Sinne des Konzüs nach den Erfordernissen der hier und heute gegebenen Situation ist. Diese Situation ist gekennzeichnet durch den sogenannten Pluralismus einer sich gründlich wandelnden Gesellschaft, das im Urteil der öffentlichen Meinung gleichrangige Nebeneinander verschiedenster Geistesströmungen, mit denen die Botschaft Jesu auf die Basis einer materialistisch orientierten, religiös indifferenten Wertordnung in Konkurrenz treten muß, indem wir sie auf neuen Wegen, in neuer Sprache den Menschen dieser Zeit nahebringen. Mitbestimmend für die Situation der Kirche von Wien ist aber auch ihre geographische Lage an der Grenzlinie zwischen den beiden Machtsphären, die sich den Anspruch auf die Weltherrschaft zugleich politisch teilen und ideologisch streitig machen. So wird doch letztlich diese Situation wieder von Komponenten geprägt, die samt und sonders in der Vergangenheit wurzeln. Die Vergangenheit jenes halben Jahrtausends, das nun die Geschichte unserer Diözese umfaßt, wollen wir nicht in eitler Selbstbespiege-lu.ng und steriler Rückschau betrachten, sondern kritisch durchleuchten, um die heilsgeschichtlich wirksamen Faktoren aufzuspüren und aus den Berührungspunkten mit der Gegenwart die Ansatzpunkte für Initiativen zur Bewältigung der Zukunft abzuleiten. Demgemäß ist auch die Synode in des Wortes ursprünglicher Bedeutung ein „Zusammensein auf dem Wege“, die Zusammenkunft von Menschen, die in der gleichen Richtung unterwegs sind, für eine Weile aber innehalten, um zu beraten, welcher von den möglichen Wegen eingeschlagen werden soll, weil er — menschlicher Voraussicht nach — am besten zum gemeinsamen Ziel führt.
Es hat in Österreich lange gedauert, bis das Land eine eigene Hauptstadt bekam; es dauerte noch länger, bis eigene Bistümer entstanden. Das hatte seine Ursachen im Charakter des Landes als Mark. Die Christianisierung Österreichs war von den bayrischen Bistümern Passau und Salzburg ausgegangen. Die Errichtung einer selbständigen Hierarchie in Ungarn band das dazwischenliegende Markgebiet noch enger an die Kirche von Bayern. Das hatte zur Folge, daß die österreichischen Lande größtenteils bis ins 18. Jahrhundert zu Diözesen gehörten, deren Bischofssitze außerhalb Österreichs lagen.
Denn das schon in frühester Zeit einsetzende Streben der Landesfürsten, ein Landesbistum zu schaffen, war erfolglos geblieben. Kaum war Österreich Herzogtum und damit ein selbständiges Glied des Reiches geworden, hatte der Passauer Bischof Wolfker von Ellenbrechtskirchen die Gründung eines Bistums in Wien vorgeschlagen. Damals, um die Wende zum 13. Jahrhundert, ging es noch um Paesauer Hausmachtpolitik gegenüber Salzburg. Spätere Bemühungen der Babenberger, vor allem Leopolds VI. und Friedrichs II., wie auch des Böhmenkönigs Pfe-mysl Ottokar scheiterten dagegen am Widerstand der Passauer Bischöfe, die keine Beeinträchtigung ihres „Herrschaftsbereiches“ dulden wollten. Diese innerkirchlichen Spannungen zwischen Passau und Wien zogen sich durch das gesamte Mittelalter bis in die nach-josephinische Zeit hin. Sie belasteten — wie alles Menschliche, allzu Menschliche in der Kirche — die religiöse Situation und Mission, konnten dieser aber letztlich doch nichts anhaben. „Gott schreibt gerade auch auf krummen Zeilen“ — eine trostvolle Erkenntnis nicht zuletzt für die Beurteilung mancher Spannungen unserer Zeit!
Rudolf IV. gelang immerhin die Loslösung der Pfarre Wien aus dem Passauer Diözesanver-band und die Gründung eines Kollegiats-kapitels bei St. Stephan. Noch bedeutender war der großartige Neu- und Ausbau der Stephanskirche, die Gründung einer Universität und die enge Verbindung zwischen beiden, dem geistlichen und dem kulturellen Zentrum. Doch erst 1469, rund hundert Jahre später, gewährte Papst Paul II. Kaiser Friedrich III. die Errichtung eines eigenen Bistums in Wien. Es war freilich ein Miniaturbistum, das kaum über die Stadtgrenzen hinausreichte. Noch dazu war die materielle Dotation äußerst bescheiden und gleich die erste Besetzung des Stuhls ein Mißerfolg, so daß mehr als.30. Jähre lang Administratoren die Diözese verwalteten. Die Residenzstadt hatte wohl einen Bischof, aber zum Landesbistum für Österreich war Wien nicht geworden.
Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts hielten die Kaiser aus dem Hause Habsburg an Wien als ihrer dauernden Residenz fest. Das bedeutete kirchenpolitisch, daß Wien zum Hofbistum wurde — mit allen positiven und negativen Konsequenzen. Der Kaiser hatte das Präsentationsrecht und besetzte den bischöflichen Stuhl mit Männern seines Vertrauens. Das schloß nicht aus, daß Bischöfe berufen wurden, deren Namen auch in der Kirchengeschichte einen guten Klang haben. So zählten Johannes Fabri und Friedrich Nausen zu den bedeutendsten literarischen Gegnern Luthers. In ihrer Bischofsstadt aber waren sie nicht in der Lage, dem Fortschritt der Reformation Einhalt zu gebieten; es fehlte ihnen die politische Macht, und diese allein gab damals auch in Kirchenfragen den Ausschlag.
Wenn wir heute mit dem Konzil die Kirche wieder als Volk Gottes verstehen und aus diesem Selbstverständnis die Funktionen des Priesters und des Laien neu überdenken, ist uns kaum noch bewußt, daß in den 500 Jahren der Wiener Diözesangeschichte weithin das Problem anders gelagert war, ja umgekehrt. Allein das Präsentationsrecht des Kaisers zeugt von einem Übermaß des Mitspracherechts bevorzugter Laien, das der Kirche und ihrem Auftrag nicht unibedingt günstig war. Im Miteinander — nach jahrhundertelangem Gegenoder Nebeneinander von Priestern und Laien — das rechte Maß der Ordnung des Gottesvolkes zu finden, ist uns durch das Konzil und den Geist der Zeit vordringlich zur Pflicht gemacht worden.
Die Ohnmacht der Wiener Bischöfe kehrte sich erst in ihr Gegenteil, als Melchior Klesl (1598 bis 1630) die Leitung des Bistums übernahm. Klesl war zuvor Offizial des Passauer Bischofs unter der Enns gewesen und hatte als solcher die Gegenreformation in Niederösterreich vorangetrieben; in Wien war er Dompropst und Kanzler der Universität. Als er die Verantwortung für die Diözese auf sich nahm, hatte sich seine Tätigkeit bereits weitgehend auf das politische Feld verlagert. Klesl war der erste Kardinal auf dem Wiener Bischofsstuhl, aber auch ein Mann, der durch seinen jähen Sturz die ganze Tragik seiner exponierten Stellung und seiner Politik erlebte.' ■ ,.'“?““;;'.'““\“„ \\ '
Beeinträchtigt war die Ausgestaltung des Wiener Bistums zu einem Bistum des Hofes lediglich durch den Nuntius, der seine Stellung als Ordinarius des Kaiserhofes aus seinen Fakultäten über exemte Kirchen und Personen ableitete. Im wesentlichen blieb es dabei auch, als der Josephinismus bestrebt war, den päpstlichen Nuntius auf den Stand eines bloßen diplomatischen Vertreters des Heiligen Stuhls zurückzudrängen und im 19. Jahrhundert schließlich der Hofburgpfarrer — zuletzt schon Titularbischof — die meisten früher dem Nuntius vorbehaltenen Funktionen ausübte.
Als Wien 1722 Erzbistum wurde, änderte sich wenig an seiner Stellung als Miniatur- und Hofbistum. Das Diözesangebiet wurde nur geringfügig vergrößert und das Stadtbistum Wiener Neustadt sein Suffragan, doch de facto bleib Wien nach wie vor ein 'Zwergbistum neben der Passauer Riesendiözese, eine Enklave im Passauer „Hoheitsgebiet“, deren Bedeutung ausschließlich vom Kaiserhof abhing. So wurden zwar die beiden Erz-bischöfe, die fast das ganze 18. Jahrundert hindurch die Geschicke der Kirche von Wien lenkten, Sigismund Graf Kollonitsch (1716 bis 1751) und Christoph Anton Graf von Migazzi (1757 bis 1803), ins Kardinalskollegium berufen, gegen die Aufklärung und das jose-phinische Staatskirchentum aber vermochten sie nichts Entscheidendes zu unternehmen. Das lag nicht nur an der Inferiorität ihres kirchlichen Einflußbereiches und ihrer dadurch bedingten Machtlosigkeit, sondern an der grundsätzlichen Konstellation des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat. Der Josephinismus ist nicht von ungefähr zum Inbegriff eines Staatskirchentums geworden, das willkürlich und notfalls mit Gewalt in die kirchliche Organisation eingreift, ohne auf Kompetenzen oder pastorale Notwendigkeiten Rücksicht zu nehmen. Zweifellos hat diese falsche, weit übers Ziel schießende Einmischung des Staates in kirchliche Angelegenheiten auch Reformen gebracht, die sich letztlich zum Guten auswirkten. So geht auch die heute noch gültige Diözesaneinteilung Österreichs und damit die Ausdehnung des Erzbistums Wien auf die östlichen Viertel Niederösterreichs auf Joseph II. zurück. Wie aber der Zweck niemals und nirgends die Mittel heiligt, können auch positive Errungenschaften einer falschen Entwicklung und Grundhaltung diese nicht rechtfertigen. Kirche und Staat müssen überall dort zusammenarbeiten, wo ihre Interessen und Aufgabenbereiche einander überschneiden, haben jedoch ihre Autorität gegenseitig bedingungslos zu respektieren.
Heute gilt für uns in dieser Beziehung unvermindert, was 1952 das Mariazeller Manifest über „die freie Kirche in einer freien Gesellschaft“ ausgesagt hat: Keine Rückkehr zum Staatskirchentum vergangener Jahrhunderte, keine Rückkehr zu einem Bündnis von Thron und Altar, keine Rückkehr zu jenen gewaltsamen Versuchen, auf organisatorischer und staatsrechtlicher Basis christliche Grundsätze verwirklichen zu wollen! Dafür aber nimmt auch die Kirche für sich das Recht in Anspruch, sich frei zu entfalten, missionarisch tätig zu sein, weltoffen und bereit zur Zusammenarbeit mit allen, die guten Willens sind. Dabei wird die Kirche sich niemals in Dinge einmischen, die sie nichts angehen; sie will einfach dienen, dies aber ausschließlich nach ihrem, nach Christi Gesetz.
Die Bedeutung Wiens als kirchliches Zentrum Österreichs datiert seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das war sicher nicht zuletzt ein Verdienst des Kardinals Othmar von Rauscher, der 1853 bis 1875 die Erzdiözese leitete. Er kam aus der Schule des heiligen Klemens Maria Hofbauer und war Lehrer des jungen Kaisers Franz Joseph gewesen. Schon 1849, als eine Bischofsversammlung in Wien die Grundlagen für eine Um- und Neuorientierung der Kirche in Österreich beriet, war Rauschers Einfluß unverkennbar. Er war zweifellos die führende Persönlichkeit der kirchlichen Freiheitsbewegung und der eigentliche Schöpfer des Konkordate von 1855. Dieses Konkordat, ein Erfolg der kirchlichen Erneuerungsbewegung, brachte zwar der Kirche nach den Zeiten der Bevormundung durch den Staat die Freiheit, litt aber in den Augen der Liberalen an dem Makel, von der „Reaktion“, dem neuabsolutistischen Staat abgeschlossen worden zu sein. Es war denn auch bezeichnend, wie der Kaiser 1867, auf dem Höhepunkt des Konkordatskampfes, den Bischöfen versicherte, er wisse „allezeit die Kirche zu schirmen und zu schützen“. 1870 gab die Unfehlharkeitserklärung des Ersten Vatikanums der Regierung den Vorwand zur Kündigung des Konkordats, doch die Kirche hatte in den Stürmen des Kulturkampfes gelernt, sich selbst zu behaupten und von der Freiheit Schritt für Schritt Gebrauch zu machen.
1858 hielt Kardinal Rauscher die erste Wiener Provinzialsynode. Von Wien gingen die Impulse zur christlichen Sozialreform und Sozialpolitik aus, die in der Enzyklika „Rerum novarum“ Leos XIII. ihren weltweiten Niederschlag fanden. Die „Wiener Kirchen-zeitung“ Sebastian Brunners leitete den Aufschwung des katholischen Pressewesens ein. Der Hofbauer-Schüler Emanuel Veith schuf mit dem österreichischen Katholikenverein „Für Glaube, Freiheit und Gesittung“ die erste Laienorganisation der Kirche. In Wien tagten 1877 und 1889 die ersten großen österreichischen Katholikentage, die sich mit der Schulfrage und sozialen Problemen auseinandersetzten. Auch der Fünfte Katholikentag, der sich — als Gegengewicht zur Los-von-Rom-Bewegung — die Organisation der Katholiken Österreichs zum Ziel setzte, fand 1905 in Wien statt. Den Höhepunkt all dieser Veranstaltungen bildete jedoch 1912 der Euchiaristische Weltkongreß in Wien, die letzte große Manifestation des katholischen Österreich vor dem Untergang der Monarchie. Mit der Aneignung und allmählichen Beherrschling demokratischer Methoden wuchsen die Katholiken hinein in die moderne Massengesellschaft, ohne freilich die ganze Tragweite sich anbahnender revolutionärer Umwälzungen zu erkennen und dementsprechend konsequent zu handeln. Und die Kehrseite. Mehr und mehr verlagerte sich das religiöse Leben in die Vereine, der Klerus engagierte sich zum Teil vehement in der Politik, so daß wohl die katholische Sache zu bedeutenden Erfolgen kam, doch mehr mit politischen als mit seel-scrglichen Mitteln. Nach dem Zusammenbruch des alten Reiches, seiner Gesellschaft und seiner Konventionen sollte sich das rächen.
Der Wandel des Wiener Erzbistums zur modernen Großstadtdiözese vollzog sich in zwei Etappen: nach 1918 und nach 1945. Es war noch vor dem ersten Weltkrieg, als der Wiener Pastoraltheologe Heinrich Swoboda sein bahnbrechendes Buch „Großstadtseelsorge“ (1909) herausgab. Einige Jahre später übernahm der Propst von Klosterneuburg, Friedrich Gustav Piffl, die Leitung der Erzdiözese. Kardinal Piffl (1913 bis 1932) gehörte zur jungen Generation des sozial aufgeschlossenen Klerus, dem er ein sicherer Führer in die neue Zeit war. Sein Hauptaugenmerk galt der praktischen Seelsorge; durch seine Schlichtheit und Bescheidenheit, seine Freundlichkeit und Natürlichkeit wurde er zum Volksbischof.
Gleichzeitig mit den entscheidenden Schritten zum Primat der Seelsorge unter Kardinal Piffl ging allerdings auch der Stern eines anderen Mannes der Kirche auf: des Prälaten Ignaz Seipel. Zu sehr war das Schutzbedürfnis des österreichischen Katholizismus aus Jahrhunderten des Bündnisses zwischen Thron und Altar noch in den Massen verankert, als daß die Kirche sofort den Weg in die uneingeschränkte, aber nach irdischen Begriffen auch ungesicherte Freiheit gewagt hätte. An Stelle des Monarchen bot sich eine Partei als neue Schirm- und Schutzmacht an, und umgekehrt erlag die Kirche der Versuchung, sich dieser Christlich-Sozialen Partei als eines neuen „weltlichen Arms“ zu bedienen. Das verlieh den weltanschaulichen Kämpfen der Zwischenkriegszeit jene Schärfe, die uns heute unvorstellbar ist. Die Auseinandersetzung mit den Zeitströmungen wurde fast ausschließlich auf politischer Ebene ausgetragen; jedenfalls konnte sich die Stimme des Geistes und des Gewissens im lärmenden Tagesstreit der Politik kaum Gehör verschaffen.
Und dennoch wurden in jenen Jahren, hinter dem Nebelvorhang weltanschaulicher Feindschaft und wirtschaftlicher Not, die Weichen für den Aufbruch der Kirche in eine Zeit der inneren Erneuerung, der Besinnung auf ihre eigentliche Sendung in der Welt gestellt, wurden eben damals jene Werke ins Leben gerufen, die heute aus der kirchlichen Arbeit nicht mehr wegzudenken sind: das Canisius-werk, das Bibelapostolat und die volksliturgische Bewegung, das Wiener Seelsorgeinstitut mit seinen Weihnachtstagungen und seiner Ausstrahlung in den ganzen deutschsprachigen Raum, die Katholische Aktion. „Die Kirche erwachte in den Seelen“ (Guardini). Für immer wird dieser Aufbruch der Kirche von Wien mit den Namen Pius Parsch, Michael Pfliegler, Karl Rudolf verbunden sein. Piffls Nachfolger als Erzbischof, Kardinal Theodor Innitzer (1932 bis 1955), in seinen Anfängen dem politischen Katholizismus verhaftet, leistete Großes in der Organisation der Seelsorge nach den Erkenntnissen der pastoraltheologischen Schule Swobodas. Seine Pfarrgründungen brachen den Bann nach der josephinischen Ära. In der Zeit der Prüfung gereift, wurde Innitzer nach Piffl der zweite Volksbischof von Wien.
Diese Zeit der Prüfung in den Jahren der Okkupation Österreichs durch Hitler-Deutschland, einer bis dahin unerhörten Verfolgung und Unterdrückung der Kirche durch das nationalsozialistische Gewaltregime, war auch die Zeit des berühmten „Aufbaus im Widerstand“. Sie brachte eine heilsame Besinnung auf das Wesentliche und schuf mit dem erstarkenden Selbstvertrauen der österreichischen Katholiken die Voraussetzung für die Stellung der Kirche in der Zweiten Republik: jener „freien Kirche in einer freien Gesellschaft“ des Mariazeller Manifests.
Aus zahllosen Komponenten fügen sich die 500 Jahre unserer Diözesangeschichte zu dem Mosaik, vor dem wir heute stehen. Es zeigt uns ein Bild der Kirche, das sich grundlegend gewandelt hat seit den Tagen Friedrichs III., dessen Sohn die Geschichtsschreiber noch „den letzten Ritter“ nannten. Diese Kirche hat das gemeinsame Priestertum aller, die auf Christi Namen getauft sind, wieder entdeckt — und damit ihre primäre Aufgabe, dem Heil der Welt zu dienen, ihr die frohe Botschaft der Erlösung zu bringen. Die Welt, in der wir leben, ist freilich indessen auch eine ganz andere geworden und so geartet, daß die Erfüllung jener Aufgabe neu durchdacht werden muß. Diesem Ziel dient die Synode, ausgehend nach dem Vorbild des Konzils von der eigenen Erneuerung: „Damit die Gemeinschaft unseres Glaubens wirksam werde!“ Es geht dabei nicht nur um eine strukturelle Neuordnung. Das Konzil selbst hat mit dem Prinzip der kollegialen Führung, verankert im Bischofsrat, das Element der „Demokratie“ in die Kirche getragen, soweit es sich um das menschliche Element in der Kirche handelt.
Es auch in die Basis des Gottesvolkes einzu-beziehen und zu bewältigen im Aufbau lebendiger, missionarischer Gemeinden, die wieder „Salz der Erde“ und „Stadt auf dem Berge“ sind — das ist eines der nächsten Ziele, die sich beim Ausblick von der Schwelle dieses halben Jahrtausends in ein anderes dem Auge zeigen. Zweifellos wird die Synode weitere Ziele ins Auge fassen, wird die Wege dahin auskundschaften und miteinander in Verbindung bringen. Gott segne das Unterfangen: Beten wir, daß es gelinge!