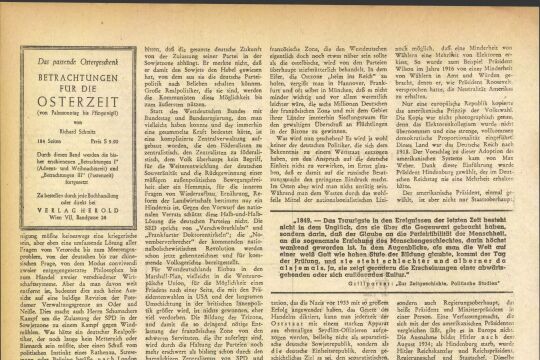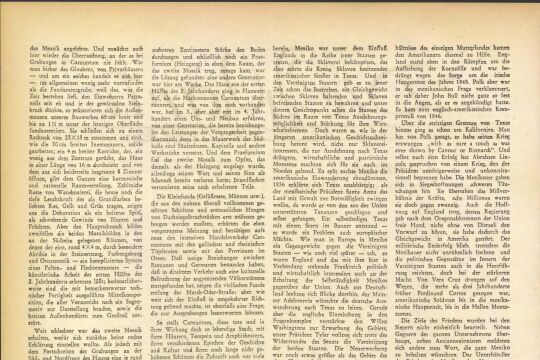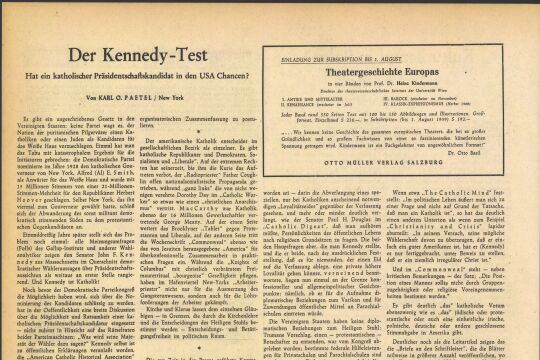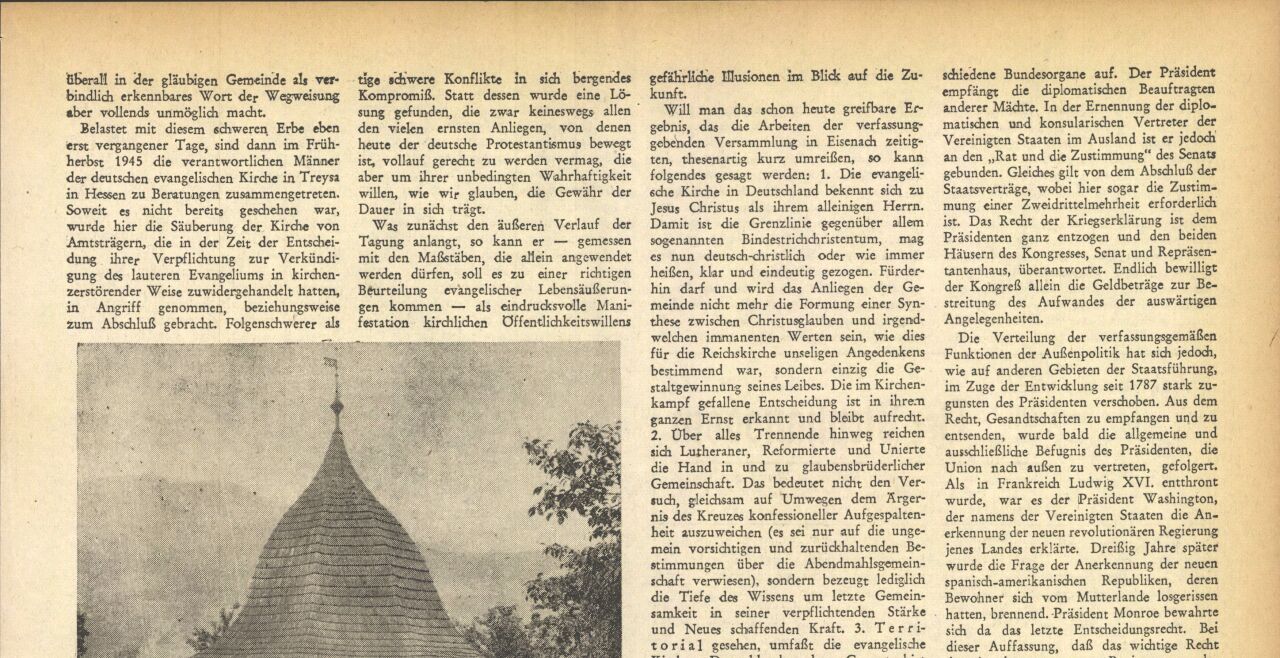
Am 2. November werden die Wähler in den Vereinigten Staaten von Amerika ihre Entscheidung über die Person des künftigen Staatsoberhauptes treffen. Die außeramerikanische Welt ist an einem etwaigen Wechsel im Amte des Präsidenten der nordamerikanischen Union vor allem vom Standpunkt der Außenpolitik dieser Weltmacht interessiert. Den meisten Europäern sind von den jeweils führenden Politikern Nordamerikas nur die Namen des Präsidenten und allenfalls seines nächsten Gehilfen, des mit den auswärtigen Angelegenheiten betrauten Staatssekretärs, geläufig. Die Persönlichkeiten eines Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson und Franklin D. Roosevelt, welche die einst so fernabgeschiedene’Republik jenseits des Atlantiks zum politischen Schwerpunkt der Welt gemacht haben, versinnbildlichen den zeitgenössischen Europäern die Außenpolitik des amerikanischen Volkes an sich. Einzelne, wenn auch sehr gewichtige gegenteilige Erfahrungen, insbesondere die Verleugnung der Ergebnisse Wilsonscher Staatskunst, Pariser Friedensverträge und Völkerbund, dann die hartnäckige Weigerung der Union, dem Ständigen Internationalen Gerichtshof im Haag beizutreten, verlieren sich im Auge des europäischen Beschauers in den nebelhaften Hintergründen Washingtoner Kongreßpolitik. Aus ihnen heben sich doch wieder die allein festen Umrisse der Gestalt des Präsidenten ab.
Welches ist die verfassungsrechtliche Stellung des Präsidenten der Vereinigten Staaten auf dem Gebiete der Außenpolitik und wie weit ist er hier in der Führung der Staatsgeschäfte an die Mitwirkung des Kongresses gebunden? James Bryce hat in seinem berühmten, aus dem vergangenen Jahrhundert schöpfenden Werk über „Das amerikanische Gemeinwesen“ das Amt des Präsidenten der Union auf das des Königs von England zurückgeführt. Neuere Beobachter glauben, in der wachsenden Machtfülle des gewählten Staatsoberhauptes der nordamerikanischen Republik das Wiedererstehen des altgermanischen Herzogtums zu erkennen. In der Tat gaben die Väter des heutigen Grundgesetzes der Union vom Jahre 1787 dem Gedanken einer monarchischen Führung der Bundesvollzugsgewalt Raum. Sie schufen damit erstmalig den Typus der Präsidentschaftsrepublik. Dafür heimsten sie auch von den Radikalen der Revolution des Jahres 1776 den Vorwurf der Reaktion ein. Aber gerade auf dem Gebiete der Außenpolitik folgte die verfassunggebende Versammlung von Philadelphia nicht dem Vorbild der britischen Krone und den damals herrschenden Lehren Lockes, Montesquieus und Blackstones, welche die Außenpolitik zu den ausschließlichen Gerechtsamen des Königs zählten. Die geltende amerikanische Verfassung des Jahres 1787 teilte die entscheidenden außenpolitischen Funktionen auf verschiedene Bundesorgane auf. Der Präsident empfängt die diplomatischen Beauftragten anderer Mächte. In der Ernennung der diplomatischen und konsularischen Vertreter der Vereinigten Staaten im Ausland ist er jedoch an den „Rat und die Zustimmung’ des Senat’ gebunden. Gleiches gilt von dem Abschluß der Staatsverträge, wobei hier sogar die Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Das Recht der Kriegserklärung ist dem Präsidenten ganz entzogen und den beiden Häusern des Kongresses, Senat und Repräsentantenhaus, überantwortet. Endlich bewilligt der Kongreß allein die Geldbeträge zur Bestreitung des Aufwandes der auswärtigen Angelegenheiten.
Die Verteilung der verfassungsgemäßen Funktionen der Außenpolitik hat sich jedoch, wie auf anderen Gebieten der Staatsführung, im Zuge der Entwicklung seit 1787 stark zugunsten des Präsidenten verschoben. Aus dem Recht, Gesandtschaften zu empfangen und zu entsenden, wurde bald die allgemeine und ausschließliche Befugnis des Präsidenten, die Union nach außen zu vertreten, gefolgert. Als in Frankreich Ludwig XVI. entthront wurde, war es der Präsident Washington, der namens der Vereinigten Staaten die Anerkennung der neuen revolutionären Regierung jenes Landes erklärte. Dreißig Jahre später wurde die Frage der Anerkennung der neuen spanisch-amerikanischen Republiken, deren Bewohner sich vom Mutterlande losgerissen hatten, brennend. -Präsident Monroe bewahrte sich da das letzte Entscheidungsrecht. Bei dieser Auffassung, daß das wichtige Recht der Anerkennung neuer Regierungen oder Staaten ein Ausfluß der Vertretungsbefugnis des Präsidenten sei, ist es geblieben. So hat Franklin D. Roosevelt 1933 die Sowjetregierung anerkannt, nachdem vier Präsidenten das durch sechzehn Jahre verweigert hatten. Auch die Bindung des Präsidenten an die Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit des Senats zum Abschluß von Staatsverträgen wurde wiederholt umgangen. In solchen Fällen schloß der Präsident selbständig Vereinbarungen agreements ab, derep Unterschied von Verträgen treaties recht unklar ist. Es handelte sich da mitunter um internationale Vereinbarungen von bedeutender politischer Tragweite, nicht um bloße Regierungsabkommen verwaltungstechnischer Natur zur Durchführung bestehender Gesetze. Ein anderer Weg, die Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit des Senats zu ersetzen, wurde in übereinstimmenden Entschließungen beider Häuser des Kongresses mit einfachen Mehrheiten gefunden. Diese Vorgangsweise wurde bei der Angliederung von Texas und von Hawaii oder beim Beitritt der Vereinigten Staaten zur Internationalen Arbeitsorganisation angewendet. Im Jahre 1905 schloß Präsident Theodore Roosevelt mit der Republik San Domingo einen Vertrag, nach dem die Vereinigten Staaten die Zolleinhebung für diesen finanziell zerrüttetenStaatübernahmen und dafür dessen europäische Gläubiger befriedigten. Damit, sollte einer Intervention europäischer Mächte auf dem amerikanischen Erdteil zuvorgekommen werden. Der Senat nahm eine kritische Haltung gegenüber dem Vertrag mit San Domingo ein und vertagte sich, ohne einen Beschluß über die bezügliche Vorlage zu fassen. Daraufhin setzte Theodore Roosevelt den Vertrag, wie er sich in seiner Selbstbiographie ausdrückt, „als einfache Vereinbarung der Vollzugsgewalt“ vorläufig in Kraft. Erst zwei Jahre später verwandelte der Senat dieses Regierungsabkommen unter Hinzufügung geringfügiger Änderungen in einen Vertrag. Der andere Roosevelt auf dem Präsidentenstuhl, Franklin, überließ 1940 an Großbritannien fünfzig amerikanische Zerstörer und erhielt dafür die Pacht von Flottenstützpunkten auf britischem Boden, ohne die Zustimmung des Senats oder des Kongresses einzuholen.
Der Wortlaut der Verfassung erfordert, wie erwähnt, nicht nur die Genehmigung des abgeschlossenen Vertrages durch den Senat, sondern auch Beratung mit ihm anläßlich der Vertragsverhandlungen. Diese Bestimmung erlangte aber nie Lebenskraft. Als Präsident Washington Verträge mit damals noch unabhängigen Indianerstämmen abschließen wollte, begab er sich zur Einholung des verfassungsgemäßen Rates persönlich in den Senat. Die weisen Herren setzten dem Präsidenten aber so hart zu, daß er die Beratung in Erregung abbrach. Es wird überliefert, er habe nachher gesagt: „Der … soll mich holen, wenn ich je wieder dorthin gehe!“ Nach diesem Präzedenzfall hat sich kein Präsident gefunden, der den Senat zwecks Vertragsberatungen aufgesucht hätte.
Auch in der Ausübung seines ausschließlichen Rechtes, Krieg zu erklären, hat der Kongreß im Laufe der Geschichte mehrmals nur den Schlußpunkt hinter vollendete Tatsachen gesetzt. Da der diplomatische Verkehr mit den fremden Mächten und das ganze laufende Geschäft der äußeren Angelegenheiten durch die Hand des Präsidenten oder des von ihm abhängigen Staatssekretärs geht, hat jener die Möglichkeit, Lagen herbeizuführen, in denen der Kongreß tatsächlich nicht mehr die freie Verfügung über Krieg und Frieden besitzt. Das gleiche gilt natürlich im Fall eines Angriffs einer anderen Macht gegen die Vereinigten Staaten. Es ist jedoch dem Präsidenten anheimgegeben, die Gefahren eines kriegerischen Zusammenstoßes zu meiden oder sie näherzurücken. Dabei kommen ihm auch seine Befugnisse als oberster Befehlshaber der bewaffneten Macht zustatten. George Washingtons Neutralitätsproklamation nach Ausbruch des Krieges zwischen England und dem revolutionären Frankreich, die an- fängliche Haltung Woodrow Wilsons während des ersten und Franklin D. Roosevelts während des zweiten Weltkrieges waren kriegvermeidend. Als aber Präsident Polk 1846 Unionstruppen in ein Gebiet vorzurücken befahl, dessen Besitz zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko bestritten war, führte er dadurch den Krieg mit dieser Macht herbei. Ebenso kam es zum Krieg mit Spanien, als Präsident MacKinley 1898 das amerikanische Kriegsschiff „Maine“ nach dem aufständischen Kuba entsandt,e’und, als das Schiff im Hafen von Havanna in die Luft flog, eine schiedsgerichtliche Erledigung dieses Zwischenfalls ablehnte. Nach der Versenkung der „Lusitania“ durch deutsche Unterseeboote im Jahre 1917 ließ Präsident Wilson amerikanische Kauffahrteischiffe bewaffnen, ungeachtet der Weigerung des Kongresses, die bezügliche Ermächtigung zu erteilen. Präsident Franklin D. Roosevelt ordnete 1941 den Schutz amerikanischer Munitionsverschiffungen nach Großbritannien durch die Kriegsflotte der Vereinigten Staaten an und erteilte deren Einheiten sogar — drei Monate vor Kriegsausbruch — den Schießbefehl gegen deutsche Unterseeboote, die in Sicht kämen. Aber der Krieg wurde diesmal durch den japanischen Angriff auf Pearl Harbour ausgelöst.
Trotz der geschichtlich entwickelten Vormacht des Präsidenten auf dem Gebiete der Außenpolitik, trotzdem hier mehr wie in anderen Funktionen der Unionsregierung die These Theodore Roosevelts siegreich zu sein scheint, daß das Haupt der Vollzugsgewalt des Bundes jede Staatshandlung vornehmen könne, die nicht ausdrücklich durch die Verfassung ausgeschlossen ist, darf der außenpolitische Einfluß des Kongresses und besonders des Senats nicht unterschätzt werden. Die Kriege zum Beispiel mit Mexiko und mit Spanien wurden dem Präsident letztlich durch die Stimmung im Kongreß aufgenötigt. Zudem kennt die politische Geschichte der Vereinigten Staaten Zeiträume, in denen die überwiegende Macht des Präsidenten von stärkerem Gewicht des Kongresses unterbrochen wurde. Es kommt eben viel auf die beteiligten Persönlichkeiten an. Man darf auch nicht vergessen, daß die Vereinigten Staaten ein Land angelsächsischer Rechtsüberlieferung sind, in welchem Fierkommen und Präzedenzfälle oft größere Kraft haben als eine strenge Auslegung des Wortlautes der Verfassung.
Wenn, wie in den letzten zwei Jahren, die Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus der Partei angehört, die in Opposition zu der Partei des Präsidenten steht, sind dessen Macht naturgemäß engere Grenzen gesetzt. Wenn ein Staatsvertrag zur Genehmigung vorliegt, ist der Präsident wegen des Erfordernisses der Zweidrittelmehrheit zumeist auch an die Zustimmung einer oppositionellen Minderheit gebunden. Doch hatten wiederholt Präsidenten der Vereinigten Staaten mit ihrer eigenen Partei im Kongreß erhebliche Schwierigkeiten zu bestehen. Gewitzigt durch Wilsons Erfahrungen nach dem ersten Weltkrieg suchte Franklin D. Roosevelt, als während des Krieges die Gründung der Organisation der Vereinten Nationen vorbereitet wurde, die Senatoren unter Druck ded öffentlichen Meinung zu setzen. Von Seiten, die dem Präsidenten nahestanden, wurde in Presse und Rundfunk die Möglichkeit erörtert, die Charta der Vereinten Nationen nach älteren Mustern durch Entschließungen beider Häuser des Kongresses mit einfacher Stimmenmehrheit oder gar durch ein Regierungsabkommen in Wirksamkeit zu setzen. Aber der Senat unter Führung des südlichen Demokraten Connally und des Republikaners Vandenberg behauptete sein Recht. Im Artikel 110 der Charta der Vereinten Nationen wur’k niedergelegt, daß deren Genehmigung „nach dem verfassungsgemäßen Verfahren der Unterzeichnerstaaten“ erfolgen müsse. Um diese Zeit wurde die „Zweiparteienaußenpolitik“ geboren, die Zusammenarbeit zwischen Präsident, Senatsmehrheit und Senatsminderheit bezweckt. Führende Senatoren beider Parteien haben an der amerikanischen Abordnung zur Konferenz von San Franzisko, weldie der Charta der Vereinten Nationen ihre jetzige Form gab, teilgenommen. Gleiches geschah auch bei anderen internationalen Beratungen, und so scheint der Senat sein altes Recht, daß sein Rat auch während der Vertragsverhandlungen gehört werde, wenn auch pur mittelbar und teilweise, wiedergewonnen zu haben. Aber die Republikaner betonen wiederholt, daß sich die Zweiparteienaußenpolitik nur auf jene Fragen erstrecke, in denen sie von Seiten des Präsidenten oder des Staatssekretärs unterrichtet und um ihre Zustimmung ersucht wurden.
Trotz dem Spielräume, den die Republikaner sich für den Fall des erwarteten Sieges ihres Präsidentschaftsbewerbers Gouverneur Thomas E. Dewey gelassen haben, dürfte nach den Wahlen mit einem Fortbestand der bisherigen „Zweiparteienaußenpolitik" zu rechnen sein. In diesem Sinn müssen auch Deweys Wahlreden, in denen er das amerikanische Volk zur nationalen Einigkeit in einer Zeit äußerer Gefahren aufruft, verstanden werden. Auch Senator Vandenberg hat sich jüngst öffentlich für den Fortbestand des Einvernehmens beider Parteien in außenpolitischen Fragen eingesetzt. Vandenbergs Stimme kommt besondere Bedeutung zu, weil er gegenwärtig nicht nur Vorsitzender des Senats, sondern auch des außenpolitischen Anschusses dieser Körperschaft ist; der Auschuß setzt sich aus sieben Republikanern und sechs Demokraten zusammen. Er ist das vornehmste Organ der Zweiparteienaußenpolitik. Hinter diesen Rufen der republikanischen Führer nach Einigkeit und Einvernehmen birgt sich jedoch auch die Tatsache, daß sie dem Wahlergebnis für den Senat nicht mit der gleichen Zuversicht entgegensehen wie dem für die Präsidentschaft. Derzeit besteht der Senat nämlich aus 51 Republikanern und 45 Demokraten. Mindestens vier von jetzt republikanischen Senatssitzen gelten als unsicher, und so könnte es sich ereignen, daß ein republikanischer Präsident mit einem der Mehrheit nach demokratischen Senat zu arbeiten hätte. Das wäre, soweit diese Kammer in Betracht kommt, eine Umkehrung der gegenwärtigen Lage.
An den Grundzügen der gegenwärtigen amerikanischen Außenpolitik hinsichtlich der Sicherung des Friedens, der Vereinten Nationen, der Europahilfe, des Verhältnisses zur Sowjetunion sowie zu den lateinamerikanischen Nationen wird sich nach einer Neubesetzung des Präsidentenstuhls kaum viel ändern. Die republikanische Kritik richtet sich hauptsächlich gegen „vergangene Sünden“ der amerikanischen Diplomatie unter Führung demokratischer Präsidenten, namentlich gegen die Übereinkommen mit der Sowjetregierung in Yalta 1944 und Potsdam 1945. Auch der Chinapolitik des Staatssekretärs Marshall wird vorgeworfen, daß sie es verabsäumt habe, dort beizeiten die antikommunistischen Kräfte zu stärken. Wenn die Voraussagen zutreffen, daß am 20. Jänner 1949 nach sechzehn Jahren wieder ein republikanischer Präsident in das Weiße Haus in Washington einziehen wird, dann dürfte die Präsidentenmacht wohl wieder stärkere Betonung erfahren. In der Außenpolitik wird aber der Einfluß republikanischer und demokratischer Senatoren „von Rang" weiterdauern, die, gestützt auf eine reiche Überlieferung und auf persönliches Ansehen, die Stellung des Senats und dessen Ausschusses für auswärtige Beziehungen zu wahren verstehen.