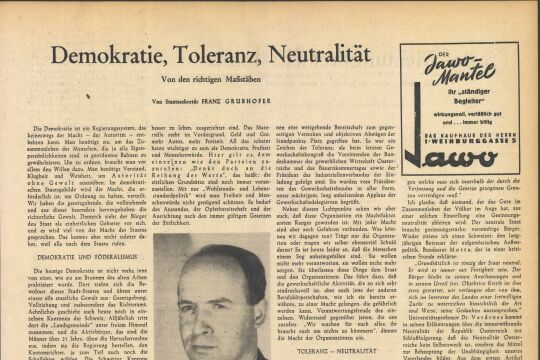Mit steigender Dringlichkeit erheben die Wortführer Oesterreichs, zuletzt wieder in feierlichster Form bei der Konstituierung des neuen Nationalratspräsidiums, die Forderung nach dem Staatsvertrag und dem Abzug der Besatzungen, kurzum nach der vollen, uneingeschränkten Souveränität. Bedenken gegen dieses Verlangen sind nicht laut geworden und sollen auch hier nicht erhoben wer'den; denn es gibt keine selbstverständlichere und natürlichere Forderung als die nach der Freiheit.
Genau so aber, wie es verderblich wäre, einen Krieg nur um des Sieges willens zu führen und nicht wegen seiner Frucht, des Friedens, ebenso wäre es verfehlt, nur nach der Aufhebung der Alliierten-Vormundschaft zu rufen und nicht Vorsorge für die Zeit nachher zu treffen. Dies aber ist, wie nachfolgend aufgezeigt werden soll, bisher nicht ernstlich geplant und durchdacht worden.
Sobald der Staatsvertrag ratifiziert sein wird, müssen auf Grund der bis jetzt genehmigten Artikel sämtliche Besatzungstruppen das Territorium des Bundesstaates binnen einem halben Jahr räumen. Damit tritt dann unsere Republik wieder in denselben Verfassungszustand zurück, abgesehen von der damals folgenden Finanzkontrolle durch den Völkerbund, wie nach dem Frieden von St. Germain en Laye. In denselben Verfassungszustand, das heißt, in alle jene politischen, kulturellen und — in technisch-juristischem Sinn — verfassungsmäßigen Verhältnisse wie damals, lediglich mit dem einen Unterschied: daß die Aussichten, die Demokratie aufrechtzuerhalten, schwieriger sind als 1920.
Während an der Wiege des neuen Staatswesens Oesterreich noch der überwiegende Teil der Bevölkerung in den Traditionen einer Ordnungsmacht wie der alten Monarchie wurzelte, besteht heute die Kernschicht aus Jahrgängen, die von Kindheit auf alles eher denn Ordnung im öffentlichen Leben und in den privatrechtlichen Verhältnissen kennengelernt haben und damit grundsätzlich loyal den Autoritäten gegenüberstünden.
Während in der Ersten Republik noch die Kirche durch ihre Exponenten oft recht maßgeblich an der Staatsführung bis zum Gemeindeleben Anteil nahm und daher auch in diesen Räumen ihren bewahrenden Einfluß geltend machen konnte, hat sie sich seit Dr. Seipels Tod weitgehend von jeder äußeren Einflußnahme auf das öffentliche Leben distanziert. Während nach dem ersten Weltkrieg der Name Oesterreich in den Herzen der Jugend noch ein Singen und Klingen hervorzurufen imstande war, weiß unsere Jugend zum Teil nichts mehr von Stolz oder gar Liebe gerade zum österreichischen Vaterland; mit Recht oder Unrecht — jedenfalls stellt sie sich viel nüchterner zu diesen Dingen. Während es — drittens — nach 1920 vorzüglich das durch die teilweise robusten Methoden des damaligen Linksextremismus verbitterte Landbürgertum gewesen war, das als Gegenwehr das dunkle Panier der Unzufriedenheit entrollte und letzten Endes zum sogenannten Pfriemer-Putsch antrat, steigt die Zweite Republik mit einer weitaus kompakteren und besser durchorganisierten, von geschulteren und leidenschaftlicheren Anführern geleiteten Truppe von Unzufriedenen in die Arena der Souveränität. Wenn schon heute Rhetoren von einer „KZ.-Clique“ sprechen, die ihre Herrschaft nur den Bajonetten der Besatzung verdanke, von einer „Brut“, die „zur gegebenen Zeit“ vernichtet werde, so kann daraus füglich auf ihre Lautstärke am Tage nach dem Abzug der Besatzung geschlossen werden — wenn eben jene Redner sich von eben jenen Bajonetten nicht mehr bedroht fühlen werden ...
Aber auch diese nicht sehr erfreulichen Vorstellungen wären noch nicht so erschütternd. Denn wenn die immerhin weit überwiegende Mehrheit der hinter der „KZ.-Clique“ loyal stehenden Bevölkerung einig ist, dann könnte, so wird wohl eingewendet werden, ein Pfriemer-Putsch, ein Ueberfall auf das Bundeskanzleramt, eine Inbesitznahme der „Ravag“, wie damals, sich nicht wiederholen oder müßte baldigst erledigt werden. Denn, so wird wohl argumentiert werden, heute fehlt den künftigen Umstürzlern die Unterstützung, wie sie sie 1933 bis 1938 vom nationalsozialistischen Deutschland erhielten, vor allem die legendäre Figur des „Führers“, und statt der damaligen Zwietracht herrscht im Inneren Eintracht; statt der feindlichen Organisationen Heimwehr und Schutzbund genießen wir heute die Beruhigung, überhaupt keine paramilitärischen Verbände marschieren sehen zu müssen. Im Gegenteil, die Exekutive befindet sich in den Händen von Mandataren unter Kontrolle der staatsbejahenden Parteien, die sich das Heft um so weniger aus den Händen winden lassen werden, als sie den Feuerofen selbst kennenlernten, in den sie jene Volkstribunen wieder schicken möchten.
Aber dieser fromme Glaube, daß die demokratische Verfassung heute besser behütet sei als zur Zeit der Ersten Republik, sollte nur mit größter Vorsicht genossen werden, und es wäre vorteilhafter, sich demgegenüber folgende Erwägungen vor Augen zu halten.
Allein, daß heute zum Unterschied von 1927, 1934 bis 1938 überhaupt (noch) kein Heer aufgestellt ist, sondern die Exekutive sich im wesentlichen auf eine erst im Aufbau begriffene Gendarmerie- und Polizeitruppe beschränkt, zeigt doch, wie wenig die zweite Republik materiell entgegenzustellen hätte, wenn ein entschlossener Angreifer so rasch Zuschläge, daß die Lücken nicht ausgefüllt werden könnten.
Aber es braucht nicht einmal solcher Alpträume, um auch einer entschlossenen Erhebung beste Erfolgsaussichten zuzusprechen, wenn sie bloß auf dem sogenannten kalten Weg des Staatsstreiches geschickt operiert und den Pfad der Legalität dabei gar nicht merklich verläßt. Es ist das Uebel aller papierenen Verfassungen, also der kontinentalen, und von diesen insbesondere der österreichischen: am grünen Tisch geschaffen und so ausgeklügelt zu sein, daß, wieder am Papier, ein vollkommenes Gleichgewichtssystem geschaffen erscheint, so zwar, daß ängstlich dafür Vorsorge getroffen wurde, auf daß ja “keine der nun einmal unerläßlichen Autoritäten, wie Parlament, Bundespräsident und Oberster Gerichtshof, über die anderen die Ueberhand bekommen könnte. Dieses System ist in den Verzweigungen des Staatsapparates von der Spitze bis zur Basis fortgeführt und durch immer neue „Sicherheiten“ gefestigt. Wie bei allen übertriebenen menschlichen Konstruktionen haftet daher auch dieser der Fehler an, in der rauhen Wirklichkeit versagen zu müssen, weil die ängstliche Bemühung, keinen Spielraum für persönliche Entfaltung zu belassen, dazu führt, daß jegliche Initiative vorher vernichtet wird. Im Augenblick, da nun eine von der papierenen Verfassung nicht geregelte Situation eintritt, muß daher dieser Fehler zutage treten, muß die stets auf der Kippe ruhende Staatsverfassung rutschen.
Es ist hier nicht der Platz für eine langatmige verfassungsrechtliche Abhandlung. Es mag genügen, nur die wenigen Fälle aufzuzeigen, in denen sich eben dieselbe Verfassung, die wir heute wie damals noch haben, bereits in der Ersten Republik aus obigen Gründen verwundbar zeigte. An drei formellen Fehlern erwies sich diese Schwäche auf dramatische Art:
1. Der noch in allgemeiner Erinnerung stehende Rücktritt aller drei Nationalratspräsidenten mit der Folge, daß die allerdings durch die Furchtbarkeit der damaligen Situation hierzu gedrängte Bundesregierung ihn nicht mehr reaktivierte. Unsere Verfassung kennt also keine Instanz, um bei Ausfall der Repräsentanten unserer gesetzgebenden Versammlung den Parlamentsapparat wieder in Gang zu setzen — ein grundsätzlicher Fehler also der dem Gedanken an Gewalt allzu abholden Schöpfer dieser Charta, die auch eine Parallele bei den übrigen Spitzen der Staatsführung hat, ein Uebel, das im Grunde auch beim Putsch auf das Bundeskanzleramt 1934 Pate stand.
2. Die somit autoritär gewordene Regierung konnte sich dann auf die formell noch in Kraft stehenden Ausnahmebestimmungen des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes stützen, um soga# die Verfassung selbst zu erneuern. Es gab also außerhalb der allgemein bekannten Rechtsvorschriften noch zumindest eine, die der breiten Oeffentlichkeit fremd und von der Jurisprudenz vergessen dabingeschlummert war.
3. Die von der Verfassungsgesetzgebung einzig vorgesehene Schranke gegen Eingriffe, der Verfassungsgerichtshof, tat nicht nur nichts dagegen, sondern nur noch dazu, um jedes Hindernis gegen eine Aufhebung der Verfassung, der er seine Existenz verdankte, aus dem Wege zu räumen. Er löste sich selbst auf!
Fragt man sich nun, was wohl seit 1945 auf Grund dieser Erfahrungen vorgekehrt wurde, um ihre Wiederholung oder Zumindestens einen Anreiz dafür zu vermeiden, so ergibt sich, und das ist nun das wirklich Erschütternde, daß überhaupt nichts geschah, sondern im Gegenteil die Fehlerquellen noch vermehrt wurden.
Weder wurde eine Bestimmung über die Weiterführung der Geschäfte des Nationalrates, noch, wie hinzuzufügen wäre, der Gesamtheit der* Bundesregierung für den Fall einer Ausschaltung durch höhere Gewalt getroffen, im Gegenteil wurde kürzlich ein weiteres „trojanisches Pferd“ in die ohnedies labile Festung eingebracht, und zwar durch die einer eigenen Würdigung bedürftige Zusammenarbeit einer staatsbejahenden mit einer nichtstaatsbejahenden Partei, die den Vertreter einer nichtstaatsbejahenden Partei als dritten Nationalratspräsidenten an einen solchen Schlüsselposten brachte, noch wurde das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz mehr als dem Namen nach aufgehoben; es erseheint zwar formell endlich außer Geltung gesetzt, doch liegt wie ein Schatten über uns noch jenes unglückliche „Rechtsüberleitungsgesetz“ vom Mai 1945, das alle Gesetze der bisherigen NS-Besatzungsmacht, von Ausnahmen abgesehen, in vorläufiger Geltung beließ; und bei dieser Regelung ist es über acht Jahre lang bis zum heutigen Tage geblieben, trotz lebhafter Erinnerungen aus dem Alliierten-Kontrollrat, diesem unwürdigen und in der Welt einzig dastehenden Zustand doch endlich ein Ende zu machen.
Dadurch ist aber, wie mit der Zeit in Fachschriftstellerkreisen nicht mehr verschwiegen wird, an Stelle des einen bekannten kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes eine unbekannte Zahl mindest ebenso tückischer Ermächtigungsgesetze getreten, nämlich sämtliche Geheimerlässe Hitlers, die anzuwenden zwar heutzutage begreiflicherweise kein Kläger und kein Richter begehren und wagen dürfte, die aber „zu gegebener Zeit“ dank unserem heute noch vorherrschendem Rechtspositivismus ohne weiteres virulent werden können. Denn der erwähnte Verfassungsgerichtshof hat sich nicht nur 1933, als ein Staatsnotstand bestand, selbst aufgelöst, er hat' auch im Jahre 1948, drei Jahre nach der Befreiung von Hitler, erklärt, daß Hitlers Anordnungen kraft seiner faktischen Macht Gesetzeskraft hatten.
Somit hat Oesterreich, und das ist nicht das Erschütternde, sondern das Tragische, eine schicksalshafte, verhängnisvolle Geste gesetzt,kaum, daß es unter der Fahne der Zweiten Republik wieder aus dem Grabe auferstanden war.
Das Nichtwissen um diese Verhältnisse in den breiten Kreisen und ihr dadurch verständliches Nichtinteresse für solche scheinbar nur die Fachjuristen angehende Fragen der Verfassung macht die Auspizien für die Zeit der vollen Souveränität nicht weniger beunruhigend — im Gegenteil!
Es ist daher die höchste, vielleicht sogar die einzig wirklich wesentliche Aufgabe des nunmehr neugewählten und (vielleicht wenn man den Anzeichen trauen darf) letzten „unfreien“ Parlamentes der Zweiten Republik, in seiner Stunde diese Versäumnisse nachzuholen.
Davon, ob sich die Gesetzgebung ihrer Hauptaufgabe bewußt wird und jene Bereinigungen vornimmt, oder ob sie die Initiative für die unausbleibliche Auseinandersetzung den Unzufriedenen überläßt, davon wird wohl Sein und Schicksal unseres Vaterlandes abhängen.
Als die Marshall-Plan-Hilfe zur Einstellung kam, war eine Beunruhigung der Oerfentlich-keit nicht bemerkbar. Damals mochte die Ueberzeugung vorgeherrscht haben, daß die Vereinigten Staaten uns trotzdem nicht finanziell im Stiche lassen würden. Diese Meinung war, wie sich herausstellte, begründet. Wenn aber Oesterreich der Besatzung ledig werden soll, handelt es sich nicht mehr um reparable Maßnahmen, sondern um etwas Endgültiges. Wer die Besatzung nicht auch als Hilfe ansieht, würde leugnen, daß Oesterreich seit 1918 noch keine so stetige Zeit der Entwicklung und des Friedens genossen hat, obwohl es noch nie so nahe an dem Rande eines Pulverfasses war, wie seit 1945. Es steht uns daher nicht an, die gleiche vertrauensselige Haltung weiter einzunehmen. „Es wird schon was g'schehn“, ist eine Devise, die sich gefährlich gegen uns kehren müßte. Die Opfer der bitteren Jahre würden verzagt, das Ausland mißtrauisch, die Staatsbevölkerung in ihrer Gesamtheit an der Staatsführung irre werden. Damit würde dem festen Zusammenschluß der heute schon Unzufriedenen vorgebaut.
Töricht wäre es, darauf zu spekulieren, daß die gar so platten Schlagworte jener obenerwähnten Rhetoren ein zweites Mal nicht wieder verfangen werden. Sie sind zu gut gewählt! Es steckt nun einmal ein wahrer Kern in der Behauptung, daß unsere Staatsmacht „auf den Bajonetten der Soldaten“ ruht. Es ist dies freilich nur eine Teilwahrheit, ebenso wie es nur teilweise wahr wäre, wenn behauptet würde, daß auch der Kirchenstaat Soldaten braucht. Aber es ist leichter, einer willigen Hörermasse T e i 1 w a h r-heiten einzuhämmern, als ihnen erklären zu wollen, daß und inwieweit jene Plattheiten nur bedingt gelten und daß etwa auch ein Friedenskaiser wie Franz Josef I. ein schlagkräftiges Heer mit größten Opfern halten mußte. Aber die Dreistigkeit, eine derartige Selbstverständlichkeit trotzdem in dem heutigen demokratischen Staatswesen als Sprengmittel zu verwenden, ist gleichwohl ebenbürtig der Ignoranz derjenigen, die in Verkennung der Empfänglichkeit gewisser einfältiger Menschen die Gefährlichkeit solcher Agitation unterschätzen.
Das Ergebnis unserer Betrachtungen ist also die Forderung, der Bevölkerung reinen Wein einzuschenken, sie auf die unausbleibliche Schärfe der kommenden Auseinandersetzung aufmerksam zu machen und ihr anderseits durch entsprechende gesetzgeberische Akte Beruhigung darüber zu verschaffen, daß die Staatsführung wachsam ist und alles Nötige und Mögliche vorgekehrt hat, nicht zuletzt übrigens auch eine konstruktive Außenpoli-t i k, die an die Lage unseres Staates gegenüber sämtlichen, wenn auch augenblicklich ideologisch getrennten Nachfolgestaaten denkt. Heute würde hierzu nur wenig Mut gehören, morgen wird es vielleicht schon ein Bravourstück sein, derartige Gesetzesvorlagen einzubringen.