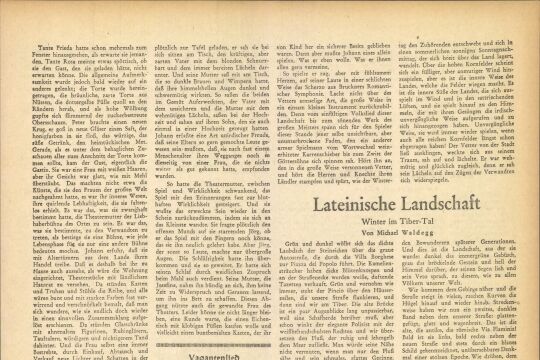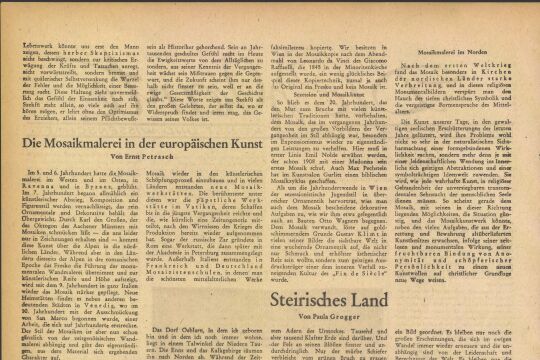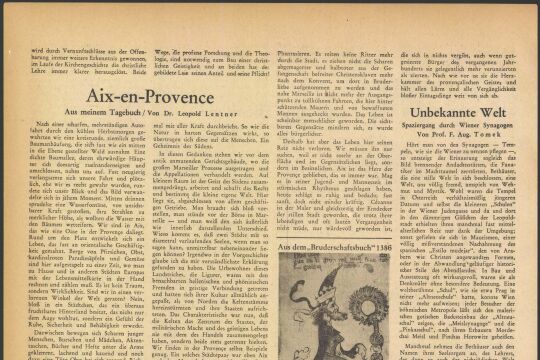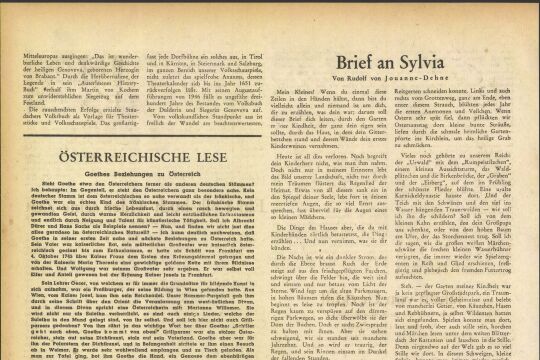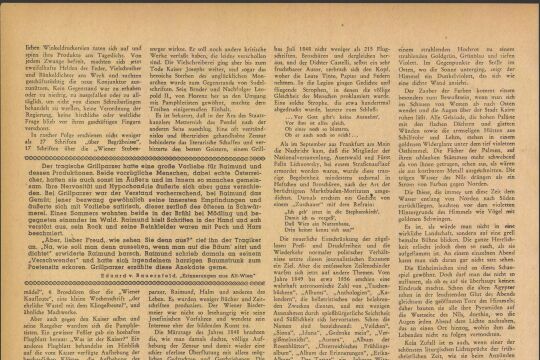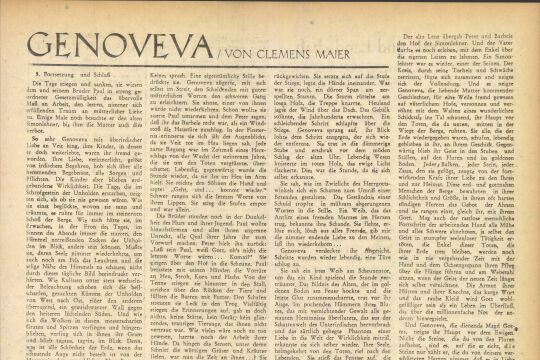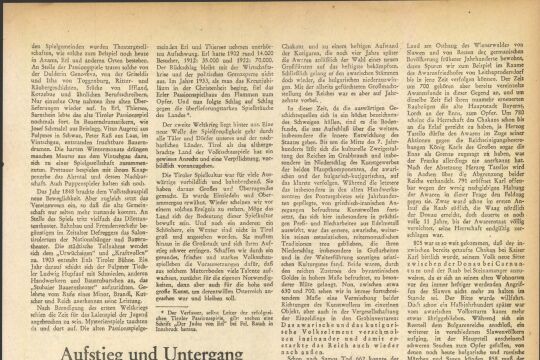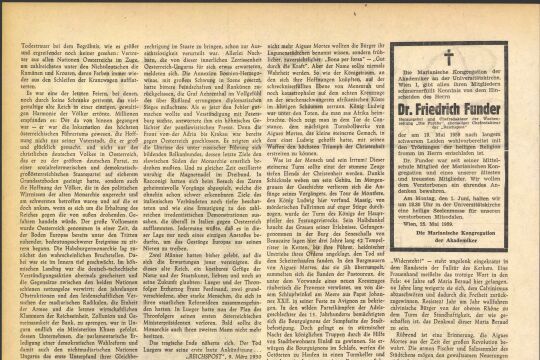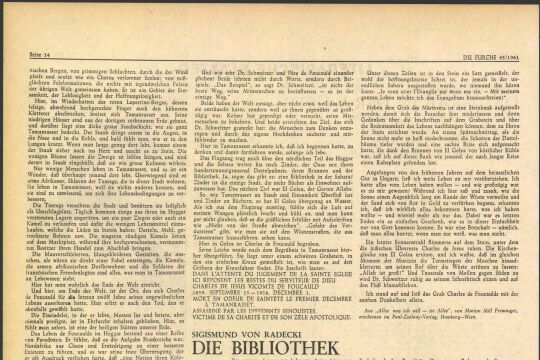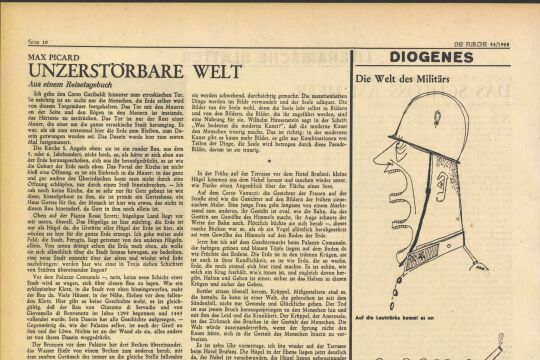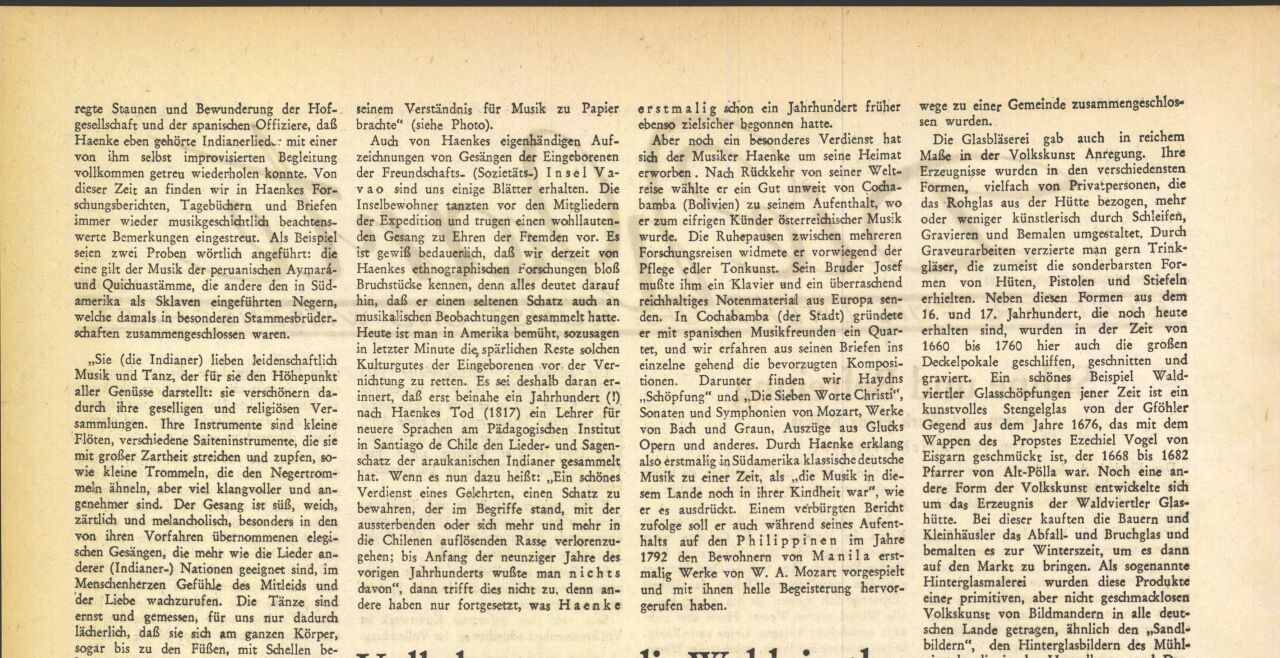
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der große Plan
Ein Münster weiß ich, das steht unfaßbar groß und erhaben inmitten eines Meeres von altertümlichen schmalen Spitzgiebeln. Wie eine erstarrte Flut sturmgepeitschter braungrauer Wellen umbrandet die Masse der Dächer das steil aufstrebende Riff des gewaltigen Domes. So hoch ragt der Bau, daß man, mit dem Zuge der Stadt sich nähernd, schon lange nur ihn sieht, scheinbar auf freiem Felde stehend, bis, beim Näherkommen endlich, an seinem Fuß das Gewimmel der anderen Gebäude auftaucht.
Weit muß man den Kopf in den Nacken legen, will man, am Domplatz stehend, mit den Blicken den himmelstrebenden Linien des Turmes folgen. Wer diesen Turm im Abendgold gesehen hat, wenn er, den warmroten Sandstein wie von innerer Glut leuchtend, aufbrennt in die stille Bläue über ihm, umrauscht von den Schwärmen der Tauben, deren Flügel hell blinken, wenn sie, geheimem Befehle folgend, eine ihrer exakten Wendungen machen — wer dies offenen Sinnes erlebte, der wird es nicht so bald vergessen.
Ich hatte das Glück, ein Jahr lang eine Dachstube zu bewohnen, in deren Fenster, wenn ich vom Schreibtisch aufsah, allbeherrschend der Turm des Münsters stand. Ich habe ihn zu allen Jahreszeiten und bei jedem Wetter kennengelernt und weiß, daß sein steinernes Gesicht den Ausdruck wechselt wie das beseelte Antlitz eines Menschen. Ich sah ihn an Nebeltagen wie ein Schemen aufragen als ungegliederten Block mit zerfließenden Umrissen, noch gewaltiger als sonst, schwer und drohend; ich sah ihn, die tausend Krabben seiner Türmchen mit Neuschneekäppchen bedeckt, ungewohnt gegliedert durch die vom Weiß betonten spärlichen
Waagrechten seiner Architektur; ich' sah ihn jenes eine Mal, als nach langem strengem Frost plötzlich der feuchte warme Föhn einbrach und die Straßen vor Glatteis fast unpassierbar wurden, im schrägen Strahl der Morgensonne gleißen wie einen riesigen Kristall in seinem Eismantel vom Fuß bis zum goldenen Kreuzknauf; und ich sah ihn im Abendgold, im lebendigen Geschmeide der rauschenden Taubenschwärme.
Jeder Quader in dem goldenen Gebäude hat seine eigene Physiognomie; da gibt es helle Steine mit glatter Oberfläche, frisch vom Steinbruch und beinahe schwarze, denen man die Jahrhunderte ansieht, mit narbigem, zerrissenem Gesicht; dazwischen alle Schattierungen von Gelb und Ocker über Rosenrot und hellem Zinnober nach Siena und Sepia, auch violette, graue und zart grünliche Töne sind dabei; und aile Grade vom neuen Schliff bis zur völligen Verwitterung. Und doch, wie einheitlich, wie aus einem Guß wirkt das Ganze!
Gewaltig, wie der Anblick, ist auch das Schicksal des Münsters, In den Jahrhunderten seines Bestehens haben Feuersbrünste es mehrmals verheert. Bei der schlimmsten floß — nach alten Chroniken das Blei aus den Fugen zwischen den mächtigen Quadern in siedenden Bächen durch die Gassen in die tiefer gelegenen Teile der Stadt. Die Bilderstürmer haben Hunderte seiner Steinplastiken zerschlagen, doch es waren so viele der Kunstwerke, daß, als die Zerstörer ermüdet von ihrem Werk abließen, noch genug übrigblieb, die Jetztzeit staunen zu machen. Kriege brandeten um den Turm und schlugen ihm Wunden auch der letzte verschonte ihn nicht. Und die Zeit frißt an ihm, unaufhörlich, mit denselben Riesenkräften, die Gebirge abtragen und in das Meer wälzen. Aus Hunderten von Schloten schwelt der schwefelige Brodern des Jahrhunderts der Kohle und nagt an dem Stein — schlimmer als der blaue Rauch von stilleren Holzfeuern der früheren Geschlechter.
Doch Münster und Turm ragen ungebrochen empor. Immer wieder ließ die gläubige Inbrunst der Herzen, die unter den schmalen Giebeln schlugen, das Wunder ihres Opfersinns im Steine neu erblühen, wenn eine Katastrophe das Wahrzeichen ihrer Stadt zerstört hatte. Fünfundzwanzig Generationen rangen mit den zerstörenden Kräften von Wind und Wetter, Brand und Krieg um die Erhaltung ihres Münsters.
So stehen und hängen auch heute wieder wie meist Gerüste an dem mächtigen Turm und aus der Bauhütte an seinem Fuß klingt Stahl auf Stein. Dort liegen die ungefügen Kalksteinblöcke auf hölzernen Zargen, und Steinmetzen in bestäubten Kitteln schwingen die Hämmer. Und auf den Tischen liegen die Zeichenpläne all des Maßwerks, der Bögen und Pfeiler, der Säulchen, Rippen und Grate, der Türmchen mit steinernem Gerank und Gezier.
Ist überhaupt, so frage ich mich angesichts dieses immerwährenden Auswechselns und Erneuerns von Bauteilen, noch ein Stein derselbe, den, als der Dom emporwuchs, die kunstfertigen Meistergenerationen des 13., 14. und 15. Jahrhunderts setzten? Und wenn — so verfolge ich den Gedanken weiter — kein Stein mehr derselbe ist, wie ehedem, ist dann überhaupt der ganze Dom heute noch derselbe, der er vor Jahrhunderten war? Wenn ja, so frage ich mich nachdenklich, was ist dann das Bleibende, an dem man ihn als denselben erkennt, obwohl alles, was man an ihm sieht, nicht mehr dasselbe ist, das es war — ausgetauscht und ersetzt durch anderes, jüngeres?
Schon die alten Griechen beschäftigte dieses Problem in der Form einer Rechtsfrage: ist ein Schiff, bei dem nach und nach alle Planken und anderen Teile durch neue ersetzt wurden, noch dasselbe wie vorher? Kann der Besitzer noch behaupten, es sei sein Schiff? Die Griechen bejahten diese Frage, denn sie betrachteten die Form als das wesentlichste Merkmal eines Gegenstandes und wenn diese erhalten blieb, dann war eben das Ding, trotz allem Wechsel in sich, dasselbe.
Ich bin nicht ganz zufrieden mit diesem unbedingten Primat der Form, ich grüble weiter. Die Form allein kann es nicht ausmachen. Es gibt Versteinerungen von Holz, bei denen haben die Ablagerungen der Kieselsäure die zerfallenden Holzteilchen so genau ersetzt, daß der steinerne Stamm die Struktur des Holzes erkennen läßt, samt Poren, Jahresringen, Harzkanälen und Markstrahlen — also gewiß eine peinlich genaue Nachbildung der Form —, und doch nicht dasselbe. Also muß zur Beibehaltung der Form mindestens noch die Gleichheit des Stoffes treten. Sonst nichts.
Und während die Wolkenschatten das alte Gemäuer des Domes, vor dem ich stehe, überziehen und das Spiel des Lichtes den Steinen seltsames Leben gibt, finde ich noch ein Gleichnis für dieses geheimnisvolle Beharren der Identität inmitten allen äuße-
ren Wechsels: auch vom Menschen sagen die Biologen, daß seine Bausteine, die Zellen, in sieben Jahren alle durch neue ersetzt seien, daß also der Menschengreis zehnmal während seines Lebens sich vom Scheitel bis zur Sohle vollständig erneuert habe — und doch derselbe geblieben sei.
Ich selbst habe die Mitte des Lebens weit überschritten, an die sieben Male hat sich der Stoff erneuert, aus dem ich gebildet bin; siebenmal bin ich verwandelt worden. Bin ich noch derselbe, der ich war, als mir, noch vor der ersten Verwandlung, die Mut ter starb? Bin ich noch — ich? Der Spiegel sagt: du bist ein anderer, vielfach gewandelter. Auch der Spiegel des Verstandes muß dies bestätigen. Doch dann leuchtet er in die Schatzkammer des Gedächtnisses, wo Erinnerung und Wissen sich häufen zum bleibenden, allen Wandlungen trotzenden Besitz. Sehe ich nicht meiner Mutter Antlitz frisch vor meinem inneren Auge, ja, wird es nicht deutlicher und heller mit jedem Jahr, das mich weiterträgt auf der blauen Flut des Lebens, gleich einem Schiff? Gleich welchem Schiff? Gleich dem Griechenschiff mit neuen Planken — doch mit der alten, köstlichen Fracht.
Was also ist das Bleibende bei all diesem Erneuern und Austauschen, diesem unablässigen Bauen am Dorq am Schiff, am lebendigen Menschen? Wodurch behalten die Dinge und Geschöpfe ihr Wesen? — Ich stehe am Dompiatz und schaue gedankenverloren den Steinmetzen zu, wie sie nach alten Plänen das Neue formen; nach alten Plänen… der Plan! Es ist, als fiele eine Binde von meinen Augen.
Nun weiß ich es: der Plan des Schöpfers jedes Wesens muß befolgt werden! Dom und Schiff und Mensch bleiben, was sie sind, obwohl ihre Bausteine ständig durch neue ersetzt werden, so lange der Plan des Meisters, der sie schuf, zu recht besteht. Auf den Plan, auf die Idee kommt es an, di nicht nur Form und Stoff, sondern auch Sinn und Ziel bestimmt. Stein und Holz und lebendige Zelle sind nur Werkstoffe, dienstbar dem Gedanken des Schöpfers. Dieser Gedanke ist der immaterielle Inhalt, der dem Stoff die Form gibt und allem Seienden durch allen äußeren Wechsel sein Ich erhält.
Wer dürfte an ein Bauwerk die Hände legen, ohne um den Plan des Werkes zu wissen? Er würde die Harmonie des ursprünglichen Gebäude zerstören; sinnlos und hemmend wäre sein Pfuschwerk am Rumpf des Schiffes; und die lebendige Zelle, die nicht mehr dem Ganzen des Geschöpfes dient, dem sie angehört, würde zum Krebsgeschwür, dessen Wachstum Zerstörung ist.
Im Plane, dem Menschen unlesbar, steht auch die Rune der Zeit, für deren Dauer er gilt. Wenn diese Zeit erfüllt ist, geht das Geschöpf in seine letzte Wandlung, wo mit Form und Stoff und Plan auch sein Dasein auf Erden erlischt.
Doch noch atme ich. Noch ragt des Mün- sterturmes roter Pfeil ins Abendsonnengold. Noch rauschen Taubenflügel rund um ihn. Noch pflügt mein Schiff des Lebens blaue Flut. Noch lächelt mir die Mutter gütig zu aus fernen Knabentagen. — Noch gilt der große Plan.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!