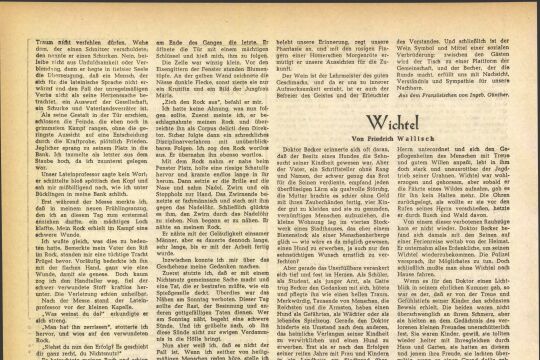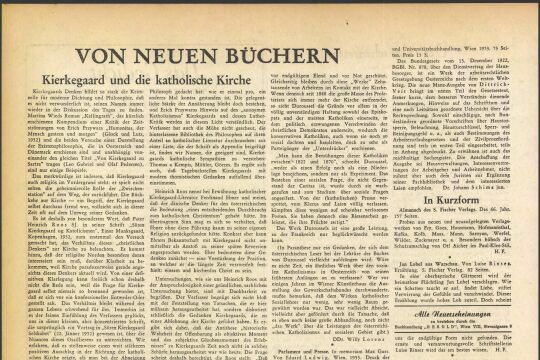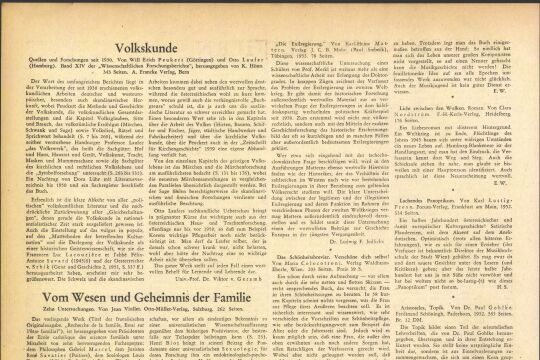Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Franzosen schauen nach Osten
Das Wort vom deutsch-französischen Gespräch ist heute eine sehr geläufige Floskel. Auf den ersten Blick scheint sie auch der Realität zu entsprechen: Es werden am laufenden Band Tagungen und Gespräche mit Partnern aus beiden Ländern abgehalten, es gibt Zeitschriften und Institute, die allein diesem Austausch gewidmet sind, kurzum: An Betrieb fehlt es nicht. Schaut man jedoch genauer hin, so entdeckt man einen seltsamen Widerspruch. Im Politischen, Wirtschaftlichen, Sozialen ist der Kontakt besser als je in den letzten hundert Jahren; die Wunden des letzten Krieges sind ziemlich vernarbt, ganz andere Völker haben in Frankreich den Deutschen die Rollen des „feindlichen“ Volkes abgenommen, und die Franzosen beginnen mehr und mehr, nach Deutschland zu reisen. Und doch: Das eigentliche Gespräch zwischen Deutschland und Frankreich, das von Kern zu Kern, ist erlahmt.
War es denn überhaupt einmal stärker? Ist denn der oft so auffallenden Frankophilie der Deutschen je ein ähnlich eindringliches Verhältnis zum ( Nachbarn auf der französischen Seite gegenübergestanden? Diese Frage beantwortet am besten ein kürzlich erschienener, 560 Seiten starker Wälzer von erstaunlicher Gelehrsamkeit: „La Crise allem ande de la Pensee francaise (1 870—1914)“ (Presses Universitäres de France, Paris 1959) von dem Flaubert- und Michelet-Spezialisten Claude D i g e o n. Aus dem Material, das Digeon da zusammengetragen und mit wacher geistesgeschichtlicher Sensibilität belebt hat, springt uns eine „Entdeckung“ an: Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und noch bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges wurde von der französischen Elite wirklich Angesicht in Angesicht mit Deutschland gedacht.
Wie weit sind wir heute jedoch von deT Intensität des deutsch-französischen Gespräches zur Zeit der Taine und Renan, ja der ohne den deutschen Widerpart nicht denkbaren Deutschenfresser Barres und Maurras entfernt! Seit Ende des ersten Weltkrieges ist die geistige Auseinandersetzung mit Deutschland zu einer durchaus exzentrischen Angelegenheit, des französischer! Geistes geworden. Man sieht es schon daran, daß Frankreich der brillanten Phalanx deutscher Frankreichkenner von E. R. C u r t i u s und S i e b u r g bis zu den Rohden, Gurian und Stadelmann kaum etwas Gleichwertiges an Deutschlandkennern entgegenzustellen hat. (Ein einzelner Robert Minder, ein Elsässer notabene, macht noch keinen Sommer.)
Auch darin ragt ein de Gaulle noch als Zeuge vergangener Welten in unsere Zeit, daß er sich mit einem Adenauer, wenn auch gebrochen, auf deutsch unterhalten kann. Das ist für einen Franzosen fast selbstverständlich, der seine Erziehung vor 1914 erhielt. Im Briefe eines französischen Germanisten lesen wir: „Damals galt die deutsche Sprache (im Vergleich mit der englischen, vom Italienischen und Spanischen war kaum die Rede) als die wichtigere, vornehmere, interessantere. Es ist ja bemerkenswert, daß mein Großvater, meine Großmutter mütterlicherseits, ihre drei Töchter Deutsch lehrten und deutsche Bücher besaßen (und sie sogar aufmerksam lasen), aber kein Wort Englisch verstanden und kein einziges englisches Buch bei sich hatten, obwohl Rouen so fern von Deutschland und so nah an England liegt.“ Heute jedoch ist es selbst bei Gelehrten nur zu häufig, daß sie sich zwar über die angelsächsischen (und allenfalls auch italienisch-iberischen) Fortschritte auf ihren Wissensgebieten unmittelbar zu informieren vermögen, nicht aber über die in deutscher Sprache festgehaltenen.
Immerhin: Ansätze zu einem vertiefteren Verständnis der deutschen Welt sind doch wieder da, und daß man sie vorerst in der Hauptsache bei den „Spezialisten“ findet, die sich von Berufs wegen mit jener Welt befassen, ist nur natürlich. Bei dem Beispiel, von dem wir sprechen wollen, spielt wiederum die Sorbonne eine führende Rolle. Wir meinen die von dem (inzwischen verstorbenen) Fernand Mosse herausgegebene „Histoire de la Litterature allem an de“ (Verlag Aubier, Paris 1959). welche fünf jüngere französische Universitätsprofessoren der Germanistik geschrieben haben: Georges Zink (Lyon) stellt die Epoche von den Karolingern bis zur Reformation dar, Maurice Gravier (Sorbonne) das 16. und 17. Jahrhundert Pierre Grappin (Sorbonne) das 18. Jahrhundert Henri Plard (Freie Universität Brüssel) den Abschnitt von 1805 bis 1848 und Claude David (Sorbonne) die restlichen hundert Jahre.
Nun, der Band kann es mit den parallelen Werken in deutscher Sprache, mit Ausnahme vielleicht des etwas schwach geratenen 18. Jahrhunderts, durchaus aufnehmen. Bei gewissen Aufgaben, etwa dem Aufzeigen der Verschränkungen der deutschen in die gesamteuropäische Literatur, ist er ihnen sogar überlegen. Was von Anfang an wohltuend auffällt und ein Ergebnis der strengen französischen Schulung sein dürfte, ist das Fehlen jener „Tiefstapelei“, jenes pseudophilosophischen Geschwätzes, das in der deutschsprachigen Literaturwissenschaft im Kielwasser gewisser geistiger Modestr'ömungen so erhebliche Verheerungen angerichtet hat. Diese französischen Germanisten bleiben bei der Sache und formulieren sachgetreu, und das ist auf die Dauer spannender als Verrenkungen des Geistes.
Claude David, Verfasser des ersten wissenschaftlichen Werkes über Stefan George, zieht sich aber in diesem Schlußteil mit Meriten aus der Affäre. Gewiß, bei uns noch so nahen Dingen werden wir schwerlich einen Historiker finden, der es uns in allen Einzelheiten recht macht. So scheint uns bei der Beurteilung der nach 1933 emigrierten oder in Deutschland verbliebenen Literatur das politische Urteil doch zu sehr das literarische zu bedingen. Aber wo fände man eine entsprechende deutsche Literaturgeschichte, die mit der gleichen Selbstverständlichkeit einem Wilhelm Lehmann, einem Konrad Weiss, einem Hans Henny Jahnn den ihnen gebührenden Platz einräumen würde? Im übrigen hat sich David vor den Kohorten der „Jungen“ von heute durch einen weisen Entschluß gerettet: Obwohl er auch kurz vor diesem Buch erschienene Werke noch würdigt, hat er doch keinen Autor aufgenommen, der nicht schon vor 1945 ein geschlossenes Opus vorzuweisen hat. Das erspart uns jene Paraden von Eintagsfliegen, in die so manche anderen Literaturgeschichten ausmünden.
In einem Falle allerdings hätte David eine Heimito von TJoderer, der an seiner erst 1952 erschienenen „Strudlhofstiege“ schließlich seit Mitte der zwanziger Jahre arbeitete. Sonst aber ist der österreichische Beitrag angemessen behandelt, von Grillparzer' (sieben Seiten) und Raimund (fünf Seiten) bis zu Weinheber (eine Seite), Musil (drei Seiten) und Broch (zwei Seiten). Ein Beitrag, der von Henri Plard über die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, geht weit über das hinaus, was für einen „Manuel“ üblich ist: Es reiht sich da — erleichtert allerdings durch den Umstand, daß Plard auf zweihundert Seiten nur den kurzen Zeitraum von Schillers Tod bis zur Revolution von 1848 darstellt — ein essayistisches Meisterstück ans andere. Wir rechnen dazu auch sein Kapitel „Romantik und Biedermeier in Österreich“ (S. 627 bis 648).
Wie sicher weiß Plard schon in den ersten Sätzen seiner Porträts den richtigen Ton zu treffen: „Verdrießlich, nach innen gekehrt, aus Schüchternheit und Selbstbewußtsein auf sich zurückgezogen, reizbar und mißtrauisch, war Grillparzer, wie Joseph Roth sagte, genau das Gegenteil des liebenswürdigen Postkarten-.österreichers. Die intellektuelle Flachheit einer von Zensur beherrschten Epoche, seine schmerzliche und leidenschaftliche Liebe zu Österreich, dessen Shakespeare er werden wollte, die Kühle und der Argwohn des kaiserlichen Hofes, die Indifferenz der Zeitgenossen gegenüber seinen besten Stücken haben ihn zerbrochen...“ Oder dann: „Obwohl er den Schwank und die volkstümlichen Feerien Wiens in den Rang einer literarischen Gattung erhoben hat, obwohl er ihnen ihre klassische Form und eine weit über das Lokale hinausgehende Ausstrahlung verlieh, ist Ferdinand Raimund im Kerne kein Autor; er ist zunächst Schauspieler, dann Theatermensch, Spielleiter, bei Gelegenheit auch Theaterdirektor, und zuletzt erst Schriftsteller.
Wer im Setzen der Akzente so sicher ist, darf sich auch kritische Ketzereien leisten. So führt Plard angesichts eines auch in Frankreich allmählich zu einem Terror werdenden Kults um diesen Dichter die Gestalt Adalbert Stifters mit einigen vorsichtigen Strichen auf ihre wahre Proportion zurück, ohne dabei in Hebbelsche Maßlosigkeiten zu verfallen. Der Österreicher wird dafür mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen, daß der in Brüssel dozierende Normanne eine Gestalt wie Postl-Sealsfield literarisch mehr ernst nimmt, als das außerhalb der österreichischen Grenzen heute üblich ist: Man spürt Plards Text an, daß er die Bücher auch gelesen hat, von denen er spricht. (Was unter Literaturhistorikern notabene gar keine Selbstverständlichkeit ist.)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!