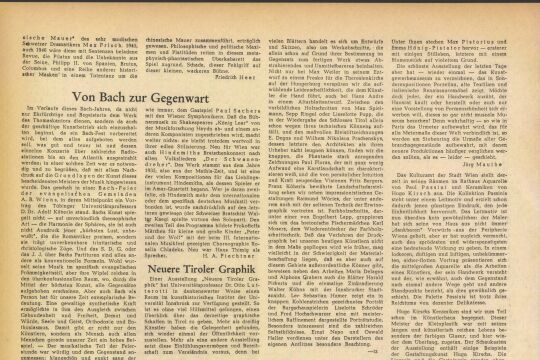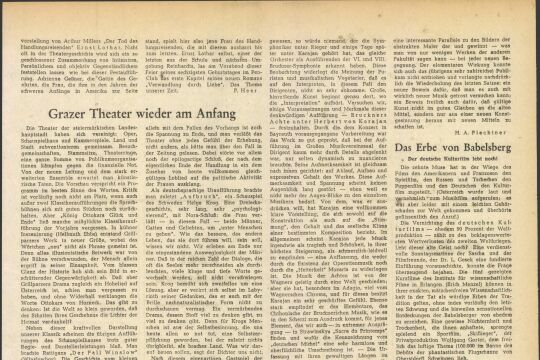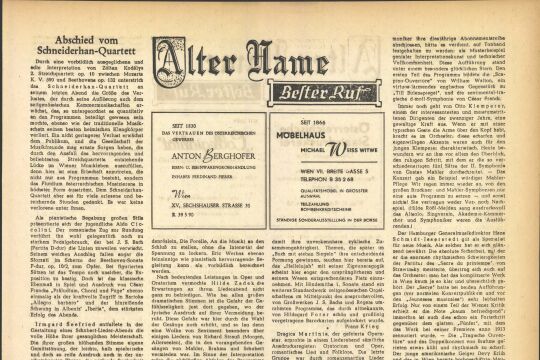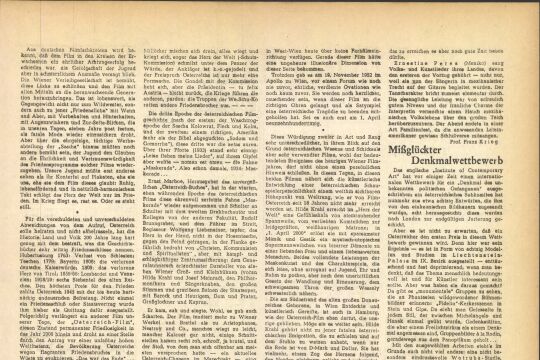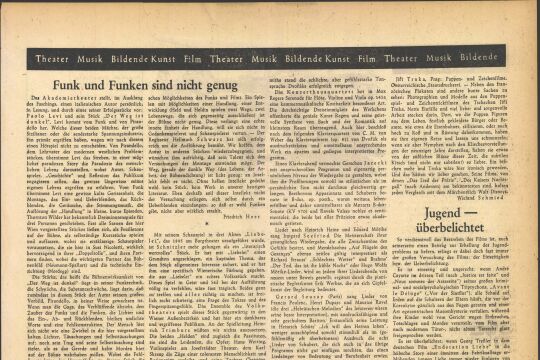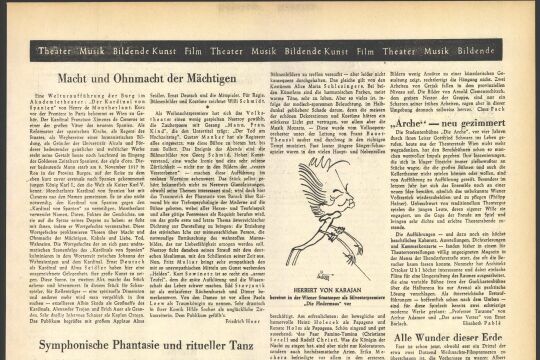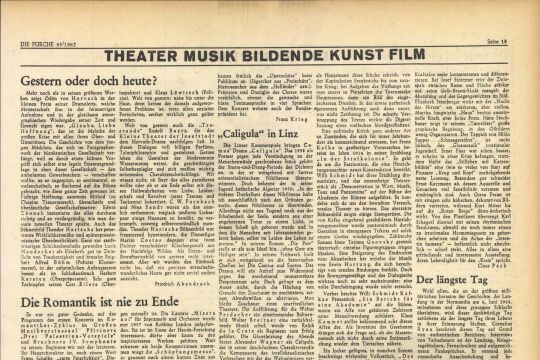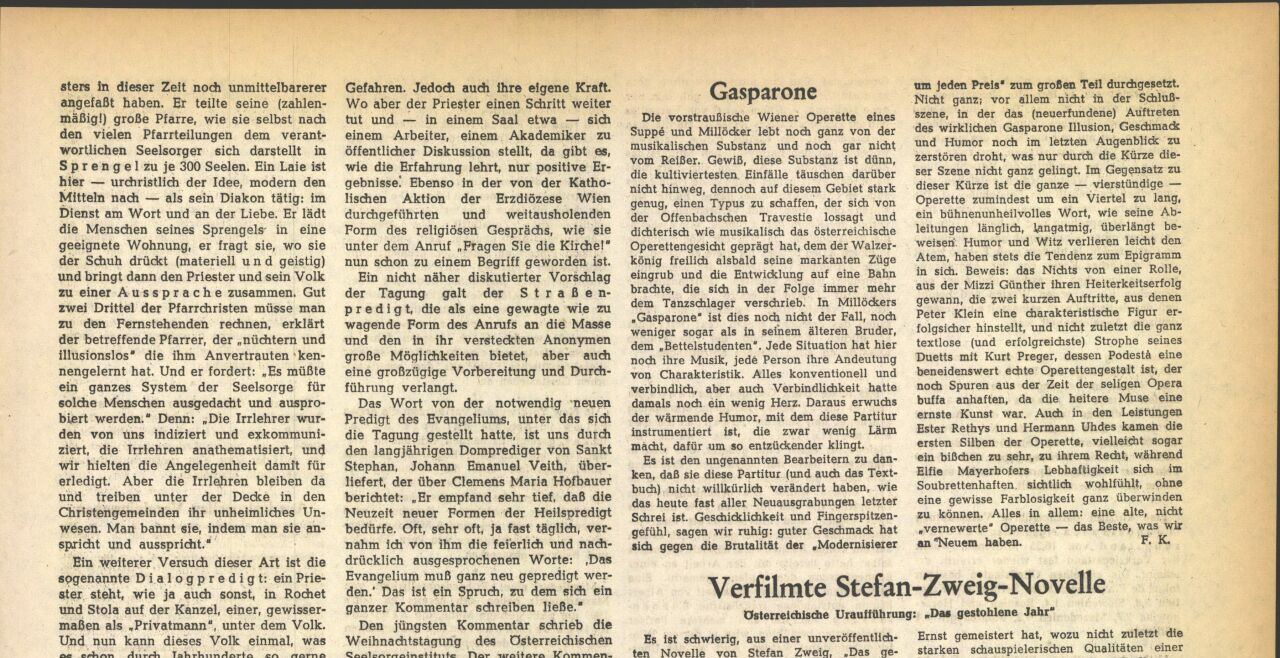
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Neues Altes und altes Neues
Robert Schumanns fünf Lieder auf Gedichte der Maria Stuart in ihrem ergreifenden dichterischen Gehalt, dem der kompositorische kaum gerecht wird, von Elisabeth Höngen vorbildlich interpretiert, hörte zumindest die jüngere Generation zweifellos zum erstenmal im Konzertsaal. Dennoch wirkten die folgenden bekannten Schumann-Lieder ungleich stärker als die unbekannten. Nicht alles Vergessene großer Meister ist es zu Unrecht. Vollends mit immer wieder gehörten Liedern von Brahms und Hugo Wolf ersang sich die Künstlerin den gewohnten großen Erfolg, was durchaus die Qualität ihrer Leistung legitimiert, während man dem Zyklus „Unter Sternen“ von Othmar Sdioeck gegenüber durch den Beifall hindurch etwas kühl blieb. Sieg der Tradition? Vielleicht das Gegenteil, denn das Ältere und oft Gehörte erwies sich überzeugend als das Stärkere und damit Neuere.
Weitest gespannt im historischen und ausdrucksmäßigen Sinn stellten sich Programm und Interpretation des schnell zum Wiener Liebling gewordenen George London dar. Lully, Verdi, Debussy, Richard Strauß, Mous-sorgski und Negro-Spirituals vermag er mit derselben Sicherheit und restlosen Einfühlung zu gestalten, ein anderer stets und doch immer das gleiche jugendliche Naturtalent, das sehr viel mitbekam und sehr viel noch dazugelernt hat. Und wie immer in solchen (seltenen) Fällen erwächst aus dem großen Können die große Kunst. Londons Atemtechnik allein ist ebenso wie seine souveräne Sprachenbeherrschung ein Beweis unermüdlicher und sich nie begnügender Arbeit. Seine schöne füllige Stimme überwindet alle Schwierigkeiten spielend, aber hinter der hohen Kunst dieses Spiels steht eben diese Arbeit, von der Offenbach sagt, sie sei erst dann vollendet, wenn ihre letzten Spuren aus der Leistung verschwunden sind.
Als jüngste Geigerin des heimatlichen Nachwuchses vermochte Elf riede B a c h n e r von ihrer musikantischen Begabung ebenso zu überzeugen, als ihr geistiges und technisches Können unter Beweis zu stellen, vielleicht gerade dadurch am ehrlichsten, daß die (vorläufigen) Grenzen in der d-moll-Sonate von Brahms fast erreicht schienen. Ein großer, klingender Ton von ungewöhnlicher Frische, bis zum Fanatischen ausgeprägte rhythmische Spannkraft, darin ihre Persönlichkeit sich am eigenwilligsten ausdrückt, sowie phraseologisch gepflegte Bogenführung sind die hervorstechendsten Positiva der jungen Künstlerin. In der Vielseitigkeit ihres Programms, als dessen Höhepunkt sich J. S. Bachs Solosonate g-moll erwies, kam ihre stilistische Kenntnis zu schöner Geltung.
Eine tiefsinnige Wiedergabe von Beethovens Klaviertrio B-dur, op. 97, und eine reizend bedächtige des Forellenquintetts, Schuberts fröhlichstem Werk, bot der zweite Abend des E b e r t - 1 r i o (mit Ferdinand Stangler als Bratschist und Otto Rühm als Baßgeiger). Hier wird mit altwienerischer Kultur gleichsam hausmusiziert, einer Tradition folgend, deren Substanz leider im Schwinden ist und die hochzuhalten an sich verdienstvoll genug ist, nicht allein in der Pflege des Triospiels, sondern mehr noch in dem Prinzip, sich und den Partnern nicht die kleinste Unklarheit durchgehen zu lassen; ein Prinzip, das ausnahmslos besteht, wenn au* nicht ausnahmslos gelingt, das aber in der stets gesteigerten Subtilität des Zusammenspiels seine edle Wirkung erweist und in besonderen Fällen, wie hier, aus drei Spielern ein wirkliches Trio macht.
Durch die Erstaufführung des VI. Streichquartetts von Paul Hindemith gewann ein Abend des Konzerthaus-Quartetts besondere Bedeutung. 1944/45 entstanden, ist das Werk trotz seiner Kürze in seiner musikalischen Wesenhaftigkeit ganz rund, von einer Ausgewogenheit zwischen Form und Inhalt, die bei einmaligem Hören allerdings mehr zu spüren als zu beweisen ist. Denn das Spiel der Motive und kontrapunktischen Figuren steht nicht mehr im Vordergrund, vielmehr ist alles Struktive in den demütigen Dienst des musikalischen Erlebens an sich gestellt, wodurch ein klassisches Ideal wieder anerkannt und in modernem Sinn auch wieder erreichbar erscheint, was als Manifest und Korrektiv zugleich von entscheidender Bedeutung werden könnte, soweit es nicht im Epigrammatischen verbleibt. Unterstrichen wurde die Bedeutung des Werkes durch seine Placierung zwischen Haydns Kaiserquartett und Mozarts g-moll-Quintett (K. V. 478), zwei kammermusikalische Spitzenwerke der Wiener Klassik. Die Sorgfalt der Ausführung entsprach in ihrer Spannkraft und künstlerischen Leistung den großen Anforderungen in besonderem Maß.
Wilhelm Backhaus' wiederholt an dieser Stelle gewürdigte edle Meisterschaft der Beethoven-Interpretation, stets wieder verjüngt und vertieft zugleich, stand diesmal sein nicht minder einmaliges Chopin-Spiel gegenüber, das diese langlinige, perlende, rankenreiche Musik aus dem Kerzenschein der Markart-Salons gleichsam in die volle Tageshelle hinausspielt und einen liebenswürdigen, seufzerlosen, männlichen Chopin zeigt, der sich zwar verhalten, aber durchaus bedeutend und genial austönt. Die rhythmische, ja tänzerische Bezogenheit seiner Melodien wird ihrer angeatmeten Schwüle entkleidet und als innerlich bewegendes Element des musikalischen Erlebens wie etwa Kanon oder Krebs erfühlt und erschlossen. Die kleinste Verzierung, die steilsten Läufe und ebenso die Reihen gebrochener Akkorde sind dem gleichen Prinzip absolut dienstbar gemacht, verlieren ihren bravourösen Selbstzweck, eingeordnet dem Gesamterlebnis, das uns größer als sonst erschien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!