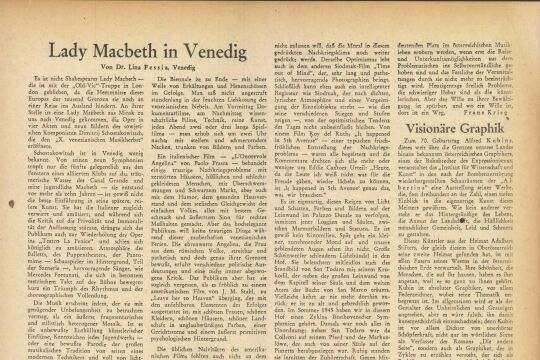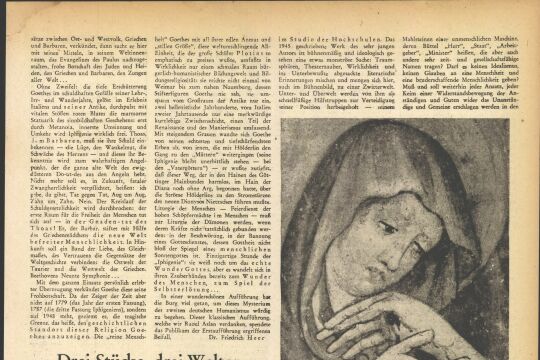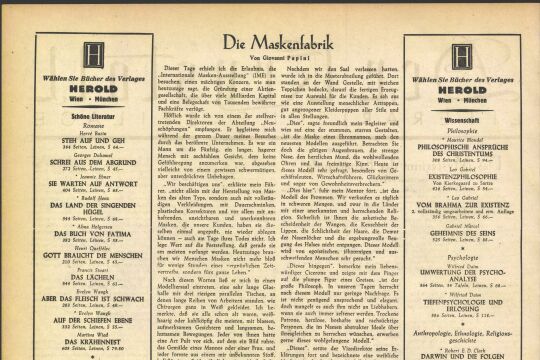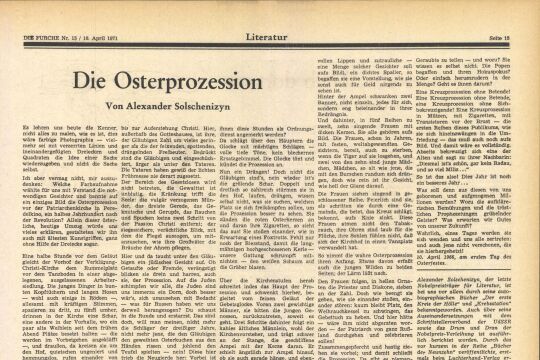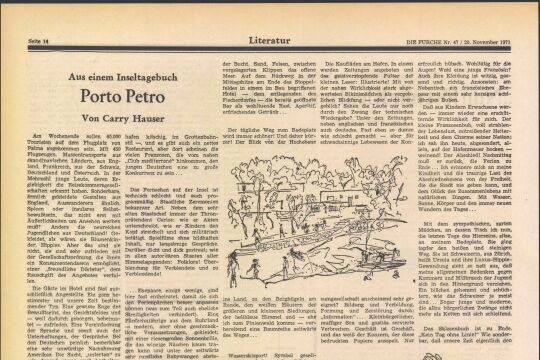Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Abartige triumphiert
Es begann so vielversprechend: Eine knappe Einführungsrede des Theaterkritikers und Jurymitglieds Friedrich Luft, dann — allerdings außer Programm — eine Proklamation des Volksbühnenpersonals für Finanzaufbesserung und danach der erste Diskussionsbeitrag „Die See“ von Edward Bond. Das Residenztheater München präsentierte unter der Regie des 25jährigen Luc Bondy ein beklemmend-groteskes Spiel zwischen den Elementen, die Wahnideen und Aufbegehren, Resignation und Bösartigkeit in den widersprüchlichsten Charakteren einer kleinen britischen Hafenstadt freilegen.
Es begann so vielversprechend: Eine knappe Einführungsrede des Theaterkritikers und Jurymitglieds Friedrich Luft, dann — allerdings außer Programm — eine Proklamation des Volksbühnenpersonals für Finanzaufbesserung und danach der erste Diskussionsbeitrag „Die See“ von Edward Bond. Das Residenztheater München präsentierte unter der Regie des 25jährigen Luc Bondy ein beklemmend-groteskes Spiel zwischen den Elementen, die Wahnideen und Aufbegehren, Resignation und Bösartigkeit in den widersprüchlichsten Charakteren einer kleinen britischen Hafenstadt freilegen.
Der Tuchhändler Hatch, von einer reichen, herrischen Lady bis zum Wahnsinn schikaniert und an den Ruin gebracht, verweigert als Strandwärter zwei in Seenot geratenen Männern seine Hilfe, weil er sie für Spione aus dem All hält. In besinnungslosem Mordrausch sticht er schließlich auf den angeschwemmten Ertrunken ein, dessen Freund seinem Messer entkommt. Nach einer
gespenstischen Trauerfeier in Sturm und Regen auf der Düne entflieht der Freund des Toten mit dessen junger -Braut zaghaft in eine hoff-nungsschimmernde Zukunft, fern jener Welt spinnös-frustrierter Frauen, die eine Laientheateraufführung proben, fern der Sphäre des versoffenen, philosophierenden Landstreichers Evens, der in einer Strandhütte haust. Grauen, Verfolgung und Verschwörung eines Irren und seiner Spießgesellen versänken hinter dem jungen Paar.
Bond nennt sein böses Stück, das mehr ein trauriges Resume über die Abartigkeit der deformierten menschlichen Gesellschaft zu sein scheint, „Komödie“.
In surrealistischen Visionen, grünlich-bleicher Salonatmosphäre oder stockdunkler Sturmnacht mit stereoverstärktem Meerestosen, verwirrt, verstrickt durch Naturgewalten, geistern die Marionetten von Bondys sublimer Inszenierung hektisch oder larmoyant durch den nordischen Alptr?“Ti.
Hervorragende Besetzung: Walter Schmidinger als irrsinniger, zuletzt aus der Trauergemeinde geprügelter Tuchhändler, den seine darstellerische Aufgabe fast sichtbar angreift und zerstört; seine bigotte Gegenspielerin Lola Müthel als schikanöse Lady, die auch ihre religiösen Kränzchenschwestern zu Tode peinigt; der Säufer Siegfried howitz, der banale Lebensweisheiten herunterfaselt; dazu die schüchternen jungen Leute Christine Buchegger — Christian Kohlund, und in einer geradezu selbstverleugnerisch demutsvollen Hundestudie Elfriede Kuzmany. Sie alle werden umrankt von plastisch herausgearbeiteten Nebenfiguren. Ein silbrig-kalter Himmel mit ziehenden Wolken und MÖven über gischtender Brandung (Bild: Rolf Glittenberg) offenbart in dieser sensiblen, atmosphärisch dichten Inszenierung die Ohnmacht des Menschen gegenüber den ewigen Naturgewalten.
Eine zauberhafte Plüsch- und Pleu-reusenklamotte bescherte tags darauf die Schaubühne mit Eugene La-biches Schwank „Das Sparschwein“. Dieses Genrebild ehrbar-tumber Provinzler, die ihr mit Spielgroschen gefülltes Sparschwein zerschlagen und mit den sorgsam gehüteten Moneten einen Ausflug nach Paris, in die große Welt, unternehmen, in der sie durch skurrile Verkettung un-
wahrscheinlichster Umstände kräftig auf die Schnauze fallen, hat das Kollektiv unter Peter Steins Regie zu prallem Leben erweckt. Karl Ernst Hermanns Bühnenbilder — vor allem die Eisen- und Glasarchitekturen seiner im diesigen Morgenregen stehenden Markthallen —■ erhielten Sonderapplaus. Jutta Lampe, Otto Sander, Wolf R. Redl — um nur einige zu nennen — sind die Protagonisten dieser morschen Bürgerwelt, die, vom jauchzenden Gelächter des Publikums umtost, in ihre endliche Katastrophe hineinkatapultiert wird.
Faszinierend, wie Peter Stein die Charaktere aufbaut, die Szenen betulich zerdehnt und dann wieder sich überkugeln läßt. Ein Musterbeispiel komödiantischer Schlagfertigkeit und bildhaft-grotesker Phantasie. *
Was dann die gleiche verschwore-ne, besessene Schaubühnengemeinschaft unter Klaus Michael Grüber in einer weißgetünchten, rohen Bretterhalle am Funkturm als „Anriken-projekt“ an zwei überdimensionalen
Aufführungsabenden zusammen* braut, entzieht sich jeglicher Theaternorm. Die „Übungen für Schauspieler“ sind nur als morbide Studie für Euripides' „Bakchen“ gedacht, in denen Exzesse und Widerlichkeiten ihren optischen Höhepunkt erreichen. Gips, lehm- oder blutbesudelte Nacktheit, Lallen, Stöhnen und Kreischen enervieren mehr als vier Stunden lang ein sonderbarerweise erstaunlich gläubiges Publikum, dem ob so viel geballter Perversion und philosophischer Geheimniskrämerei buchstäblich der Atem stockt.
Der nackte, gipsbesehmierte Bacchus (Michael König), auf einer Krankenbahre von Wärtern hereingeschoben, tobt — einen Schuh in Händen haltend — minutenlang auf seinem Lager, bis es zusammenbricht. Wenn er mit dem ebenfalls nackten Bruno Ganz (Pentheus) Zungenküsse tauscht und ihn genüßlich angreift, erhält er von diesem zu Recht eine Ohrfeige. Im Hintergrund der gleißend erhellten Spielfläche
treiben echte Pferde, beritten vom nackten Bruno Ganz, ein ähnliches Liebesspiel als optische Entsprechung. Unter der von emsigen Bacchantinnen — in zerfetzte Fledermausgewänder keusch gehüllt — mühsam aufgerissenen Bretterbühne verbergen sich Jauche, daneben zahlreiche frische Salatköpfe, wird ein vergipster Manneskörper aus dem Erdreich der Unterbühne heraufgehoben.
Zwei Hunde fressen Eingeweide und rohes Fleisch einem nackten, auf Kothumen stelzenden Hirten aus den Händen, Bruno Ganz — jetzt im weißseidenen Mantel tänzelnd wie ein Boxer — tut desgleichen. Auf einer Kehrmaschine fahren Arbeiter in orangefarbenen Plastikdressen durch die sich am Boden Wälzenden. Agaue, im blutverschmierten Hosenanzug mit triefendem Pentheus-Kopf windet sich brüllend und quietschend in Zeitlupentempo über die Bühnenplanken. Am Rande des Spielgeschehens wandeln ein echter Feuerwehrhauptmann, ein Herr im Cut und ein anderer im sommerlichen Straßenanzug, zeitunglesend.
Rezitiert wird in schlechtem Griechisch und noch schlechterem Deutsch — und eine hypnotisierte Jury präsentiert einem offenbarungsgläubigen Auditorium dieses faszinierend scheußliche Machwerk als Antike in moderner Sicht.
Nacktheit und Geilheit sind Trumpf — auch in Strindbergs „Fräulein Julie“, die uns Regisseur Günther Krämer aus Hannover bescherte. Die enttäuschend mittelmäßige Johanna Liebeneiner, ein hysterischer, zackig-schreiender Weibsteufel, wird gleich zu Beginn des Spiels als nackte Silhouette Im Bühnenhintergrund von schwarzen Le-murenweibem, die geigend auf einem Sandhaufen sitzen, mehr als zehn Minuten lang angekleidet, ehe sie in die Küche und in Diener Jeans Arme stürzt Der derbe, primitive Wolf-gang KrajJnitzer vergewaltigt die Grafentochter brutal coram publico, ehe er sich ungeniert noch einmal die Hosen zu entsprechenden Waschungen aufknöpft.
Einzig Format in diesem makabren Ensemble besitzt die Kristin der Elke Claudius, die unvergleichliche Würde in die Figur einer geschundenen, getretenen Domestikenkreatur zu legen imstande ist
Die Glaubwürdigkeit dieser Konzeption scheitert an der Enge der Bühnendimensionen. Symbolik und Realität bedrängen sich, und künstliches Hell-Dunkel-Lichtspiel, das die Personen ständig marionetten-
haft erstarren läßt, zerdehnt qualvoll den unerotischen Sommernachtsspuk.
*
Auf kahlem Bretterboden, umrahmt von Zuschauern auf alten Sofas im Bühnenhintergrund, läßt Peter Zadek (Bochum) Tschechows „Möve“ zu Tode trampeln. Unmotiviert rasen und stampfen seine Akteure kreuz und quer durch den Bühnenraum, um zu ihrem Auftritt au gelangen. Eine Art Hochsitz aus Stahlkonstruktion steht sinnloserweise den ganzen Abend sichtbehin-dernd im Zuschauerraum, von dem aus die bewußt unattraktiv gehaltene, fast stoppelhaarige Nina — Rosel Zech — eine begabte, sympathische junge Derne —) ihren Monolog herabschmettern muß. Ihre Partner sind ein linkisch ältlicher, lispelnder Konstantin (Hermann Lause), ein stumpfer, ausdruckslos murmelnder schwammiger Trigorin mit Halbglatze und strähnigem, schütteren Haarkranz (Ulrich Wildgruber), der mehr zum Shakespearenarren prädestiniert scheint, ein unglaublich seniler Pjotr (Hans Mahnke), der sich aber immerhin glaubwürdig seiner raunzigen Partie entledigt und die
völlig fehlplacierte Lola Müthel (Arkadina), eine grande dame, die als einzige darstellerisches Format und hervorragende Sprechkultur besitzt. Die restlichen Figuren: erschreckende schauspielerische Unzulänglichkeit. — Die rüde, schnoddrige Textübersetzung (Johannes von Günther) entzaubert und zerstört Tschechow restlos und wird besonders gut von einem linksradikalen, schlampig gekleideten jugendlichen Volksbühnenauditorium verstanden.
Unverständlich bleibt die Kompetenz der Juroren, die einstimmig derart banale theatralische Mittelmäßigkeiten als herzeigenswerte Meilensteine moderner Dramatik des deutschen Sprechtheaters nach Berlin berief. Die ebenfalls vorgeschlagenen Wiener Aufführungen der „Akrobaten“ und des „Kätchen von Heilbronn“ werden in einer umfassenden Programmbroschüre — bis auf wenige zaghafte Lobe einzelner Kritiker — hohnlachend und wortreich geschmäht. Sie hätten etliche Werke dieser zum großen Teü indiskutablen ersten Hälfte des Berliner Theatertreffens würdig ersetzen können.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!