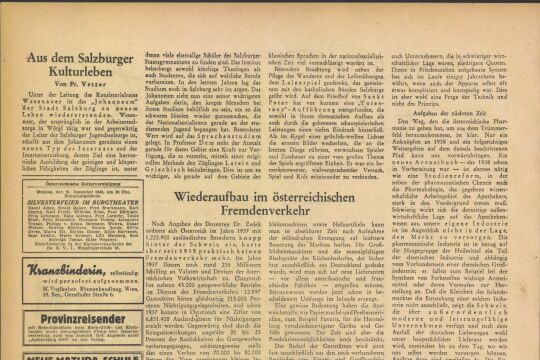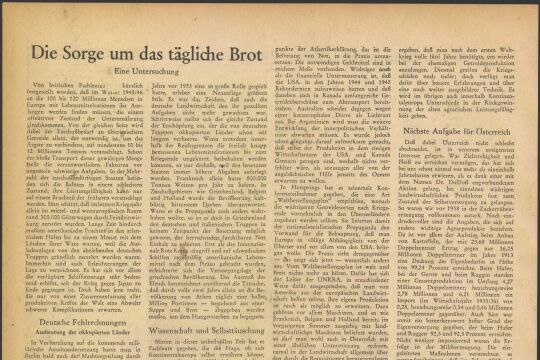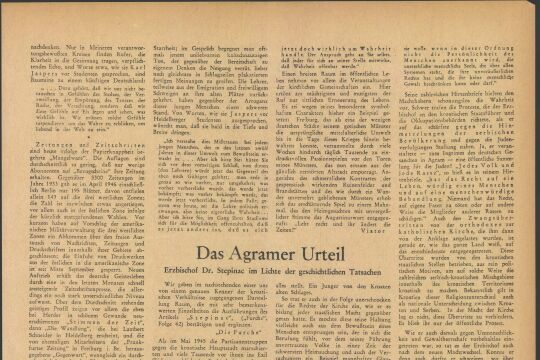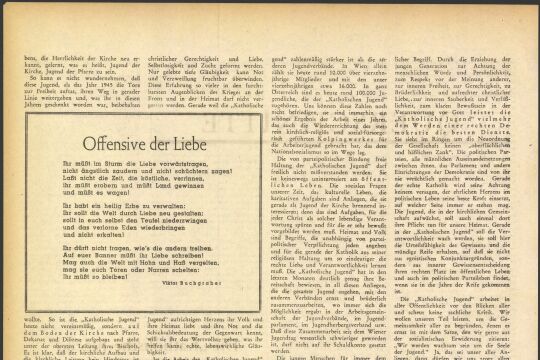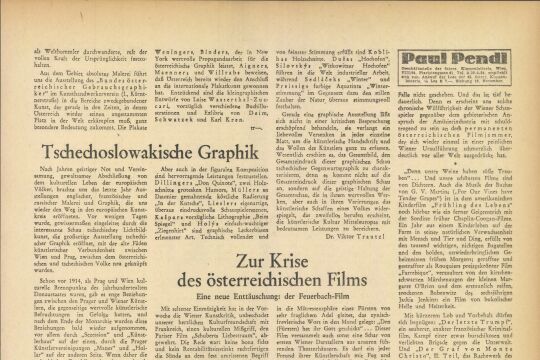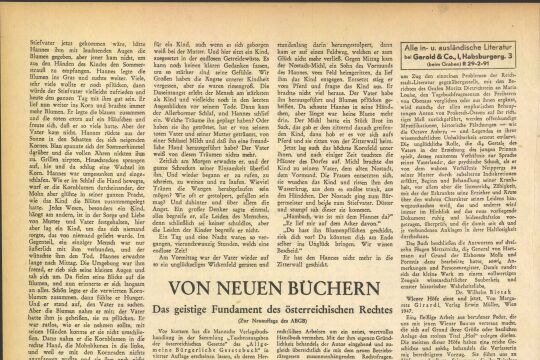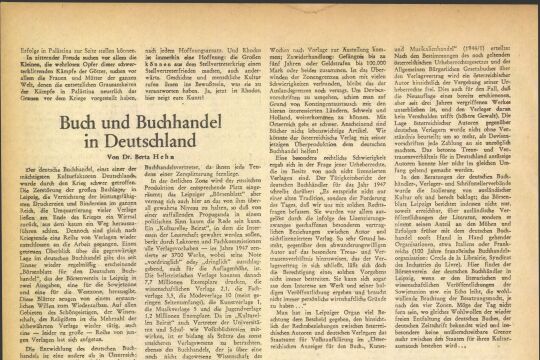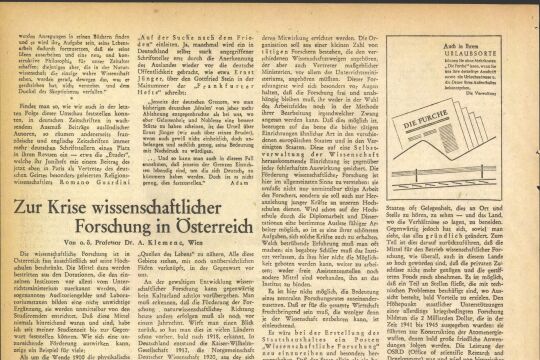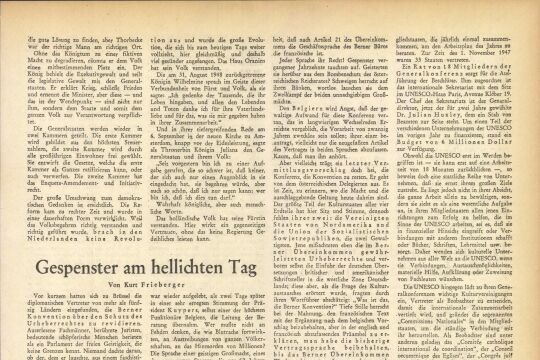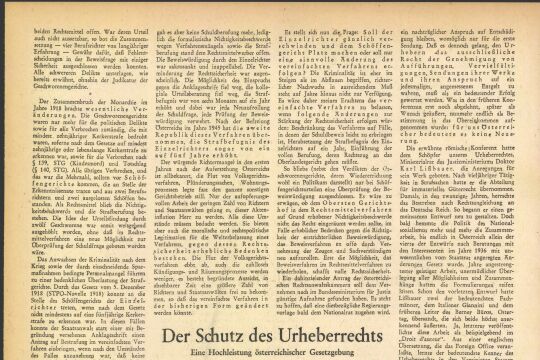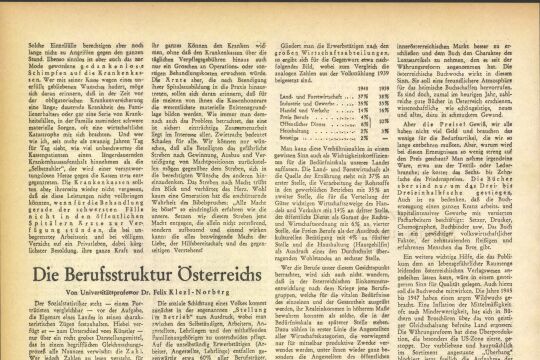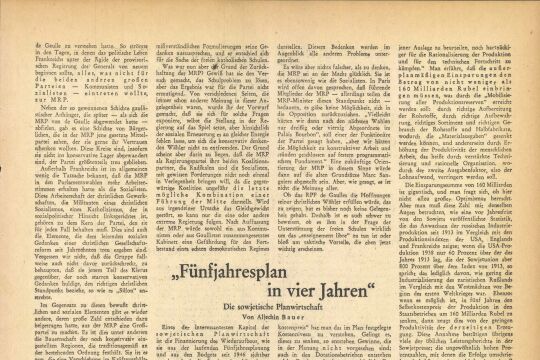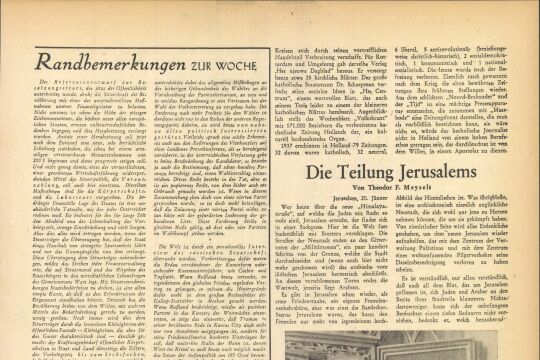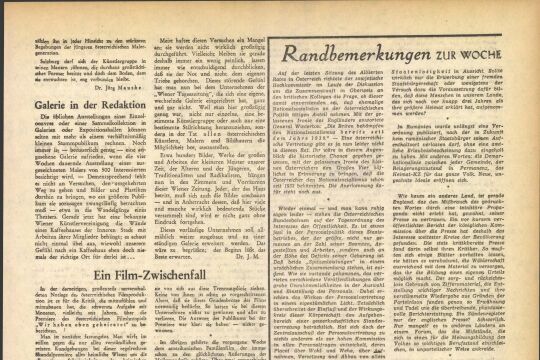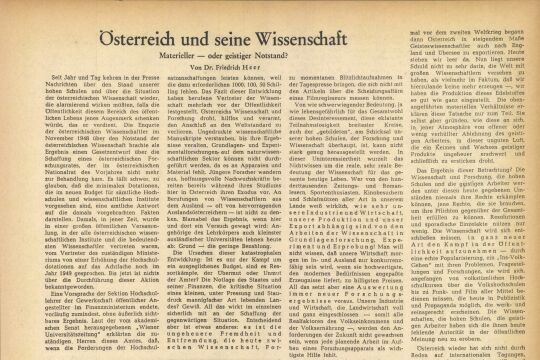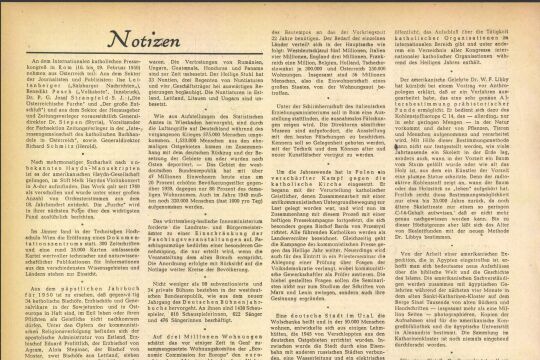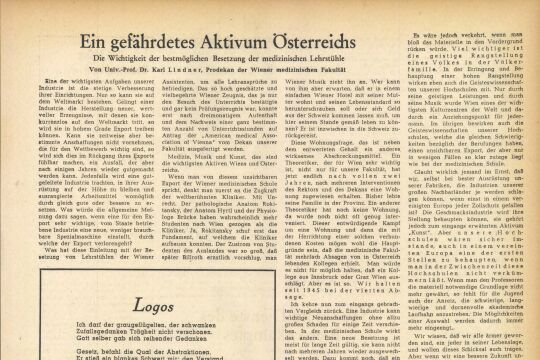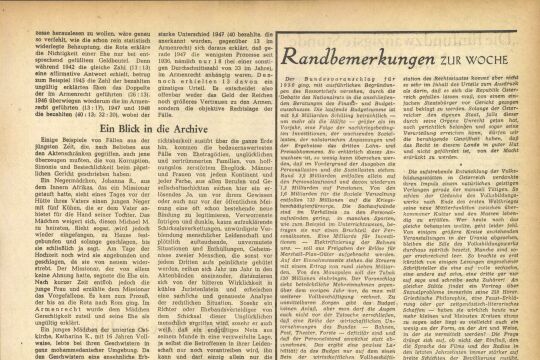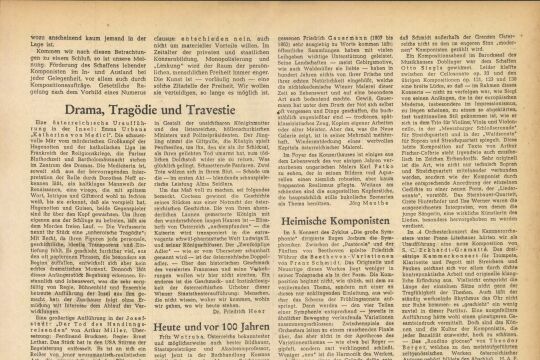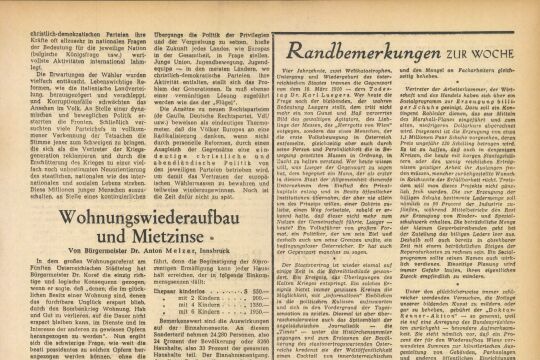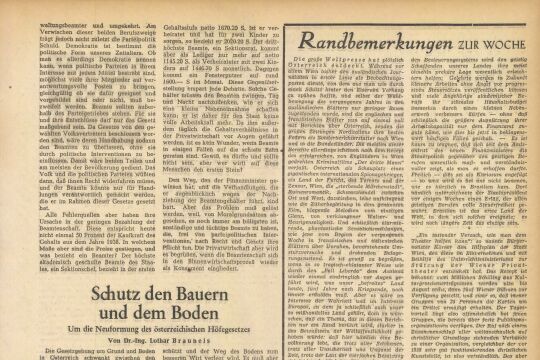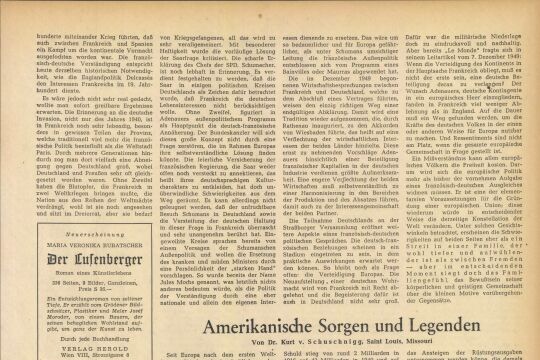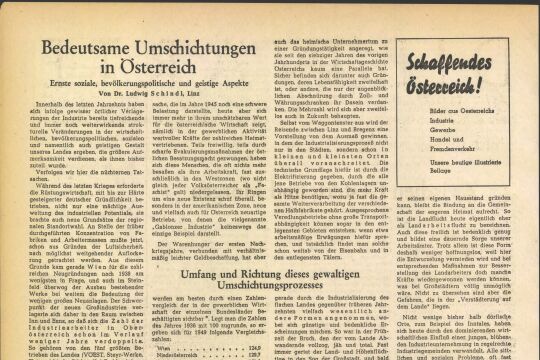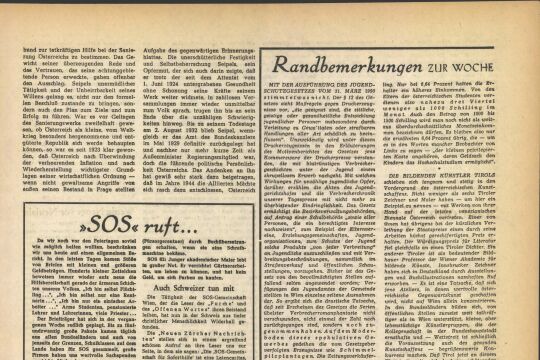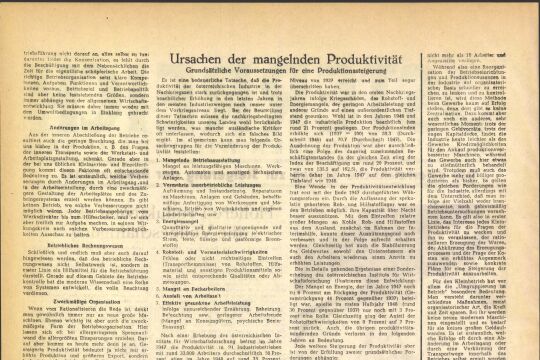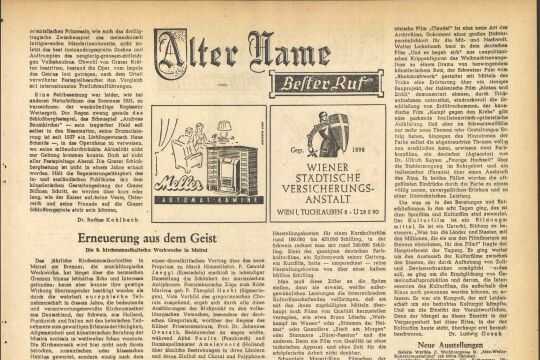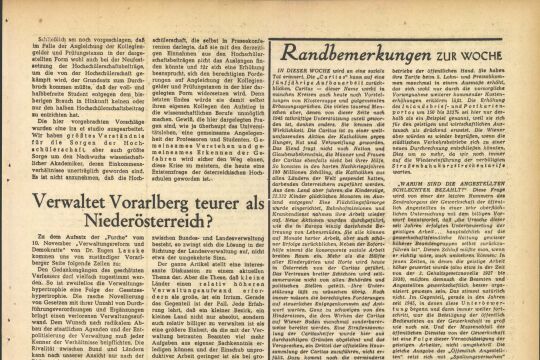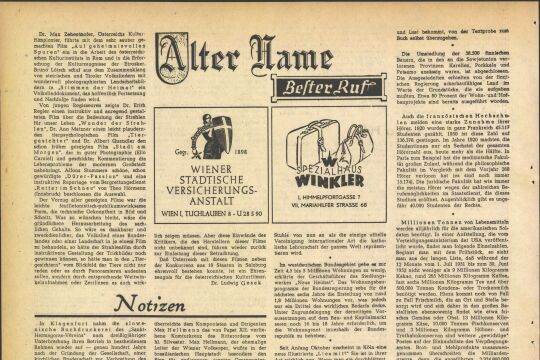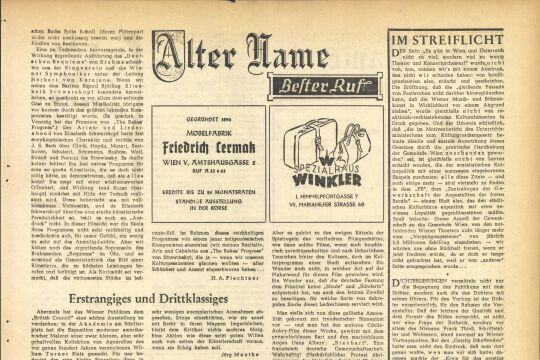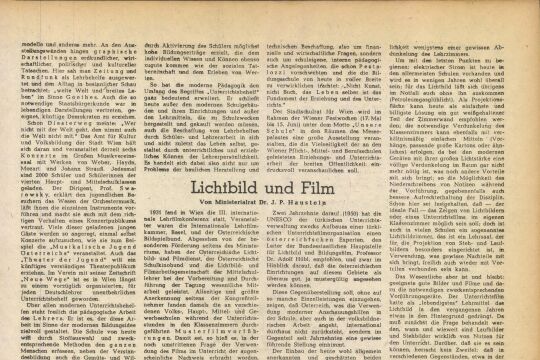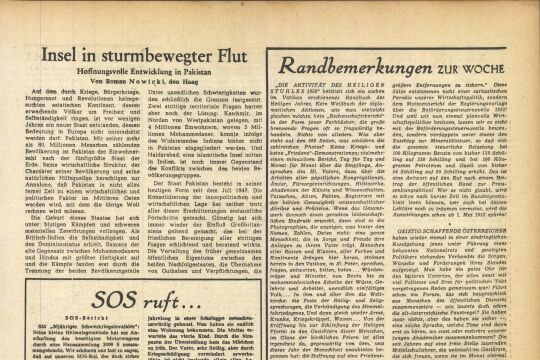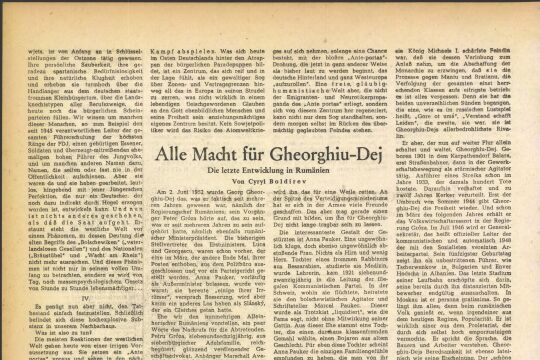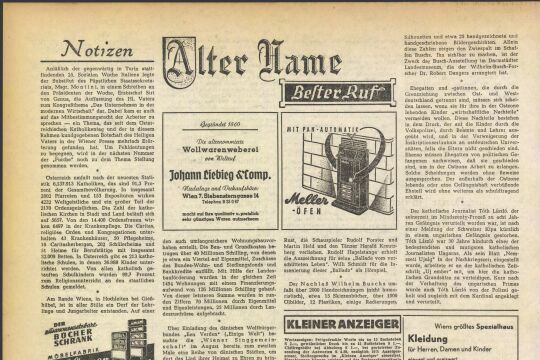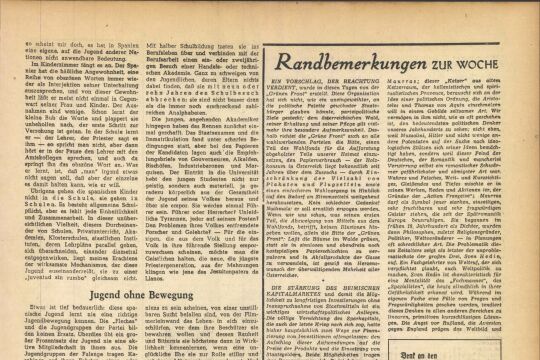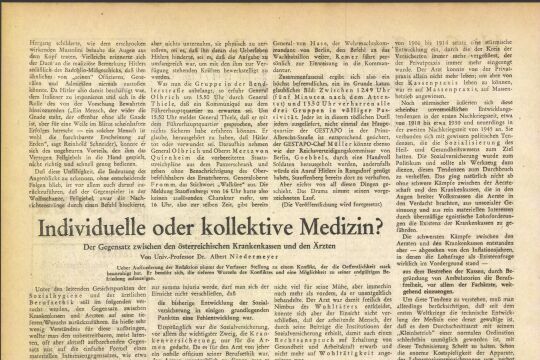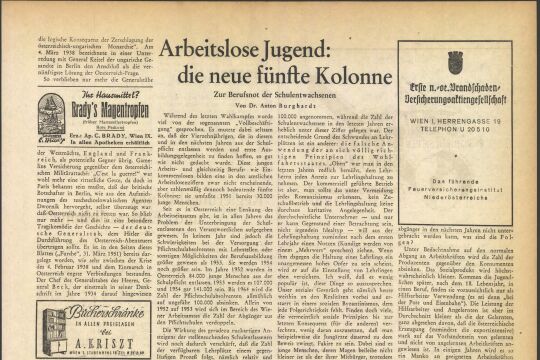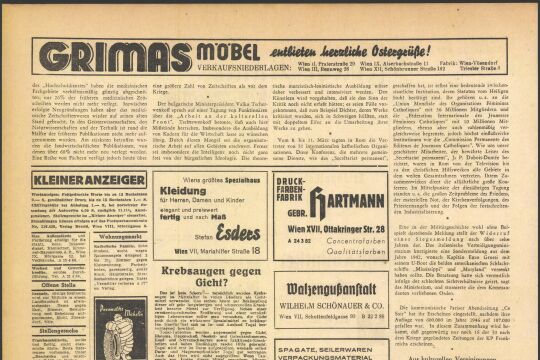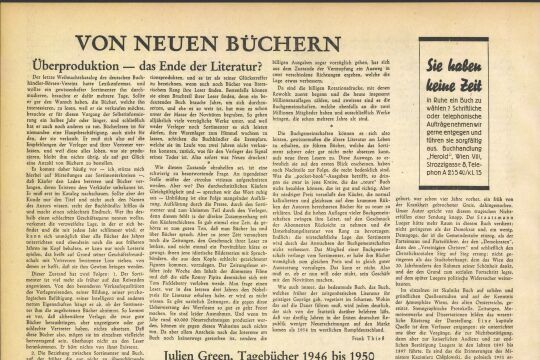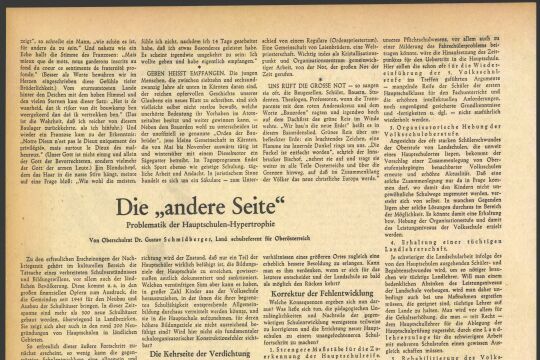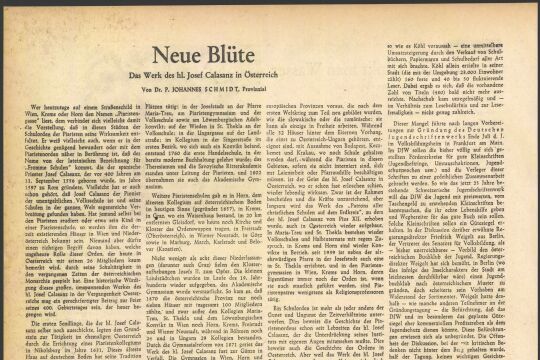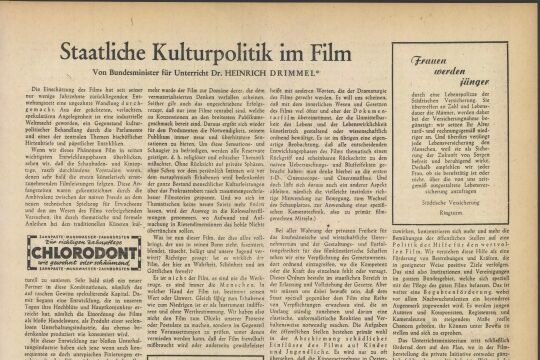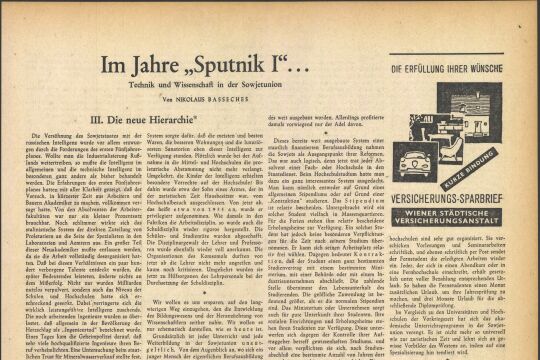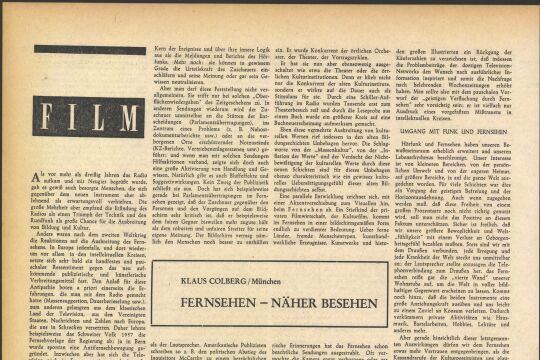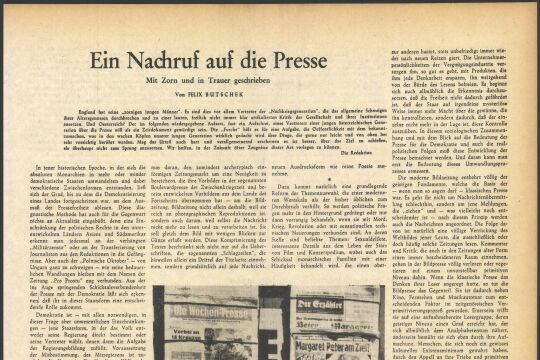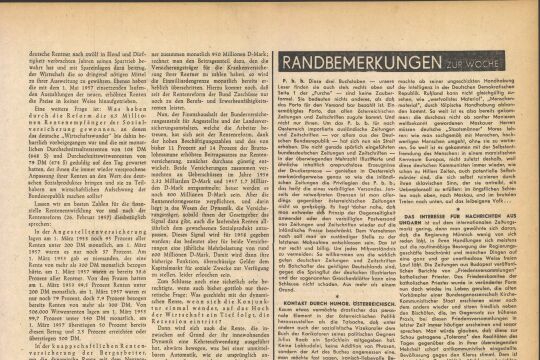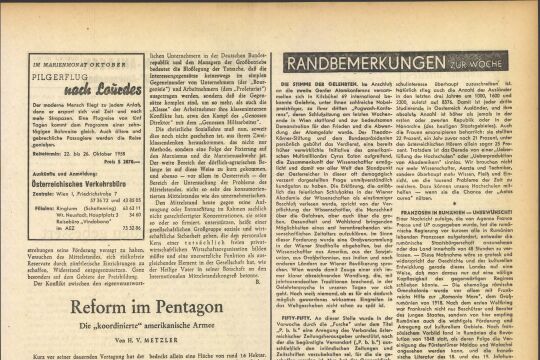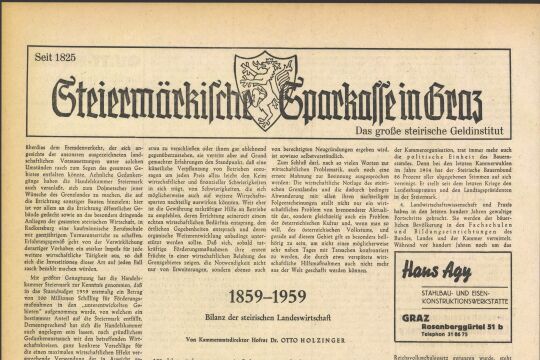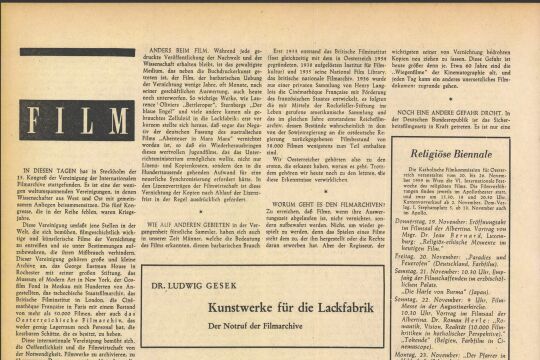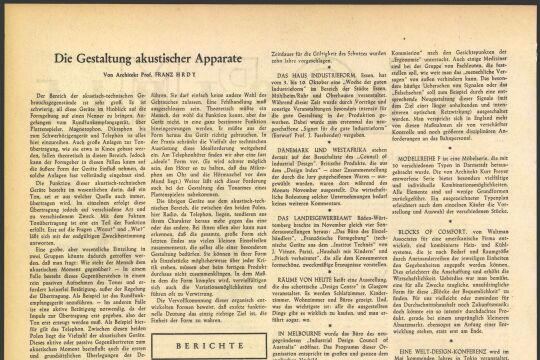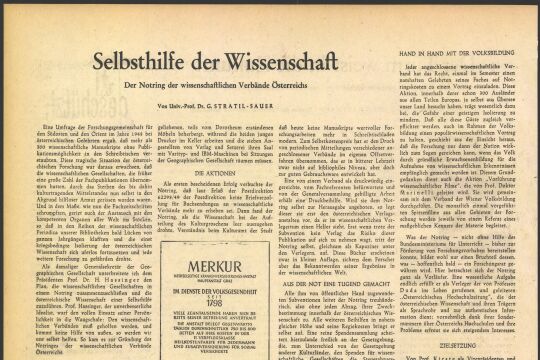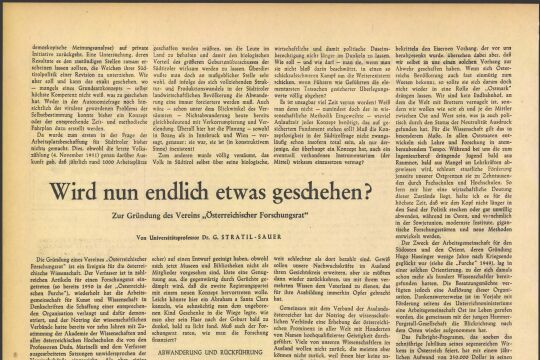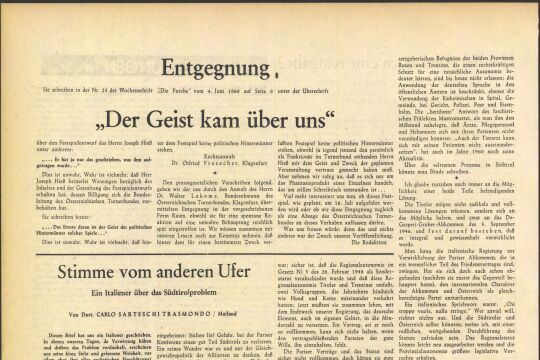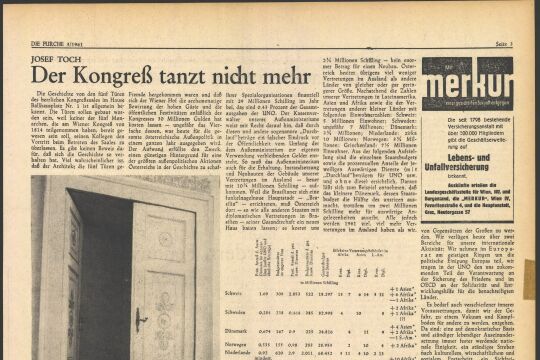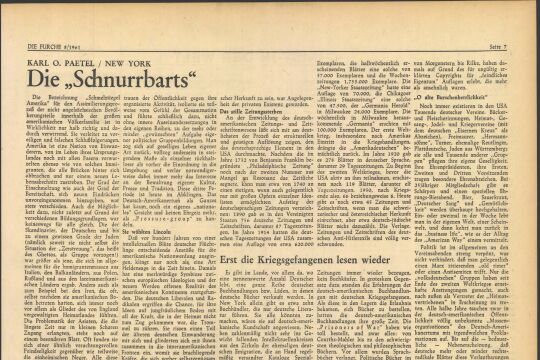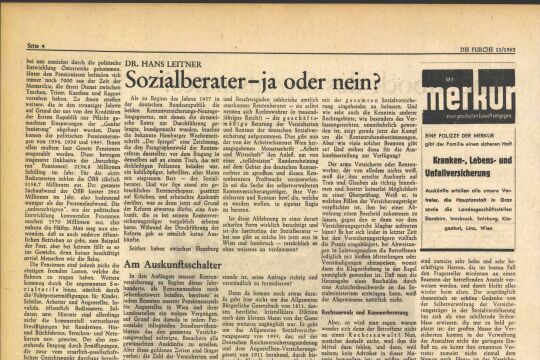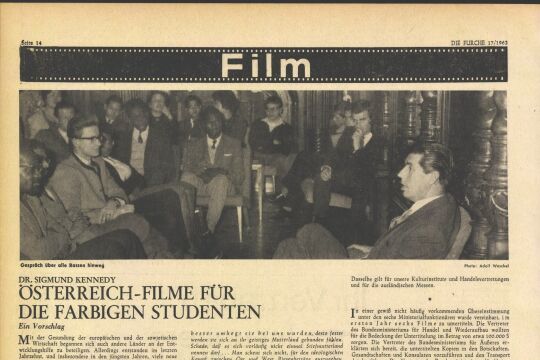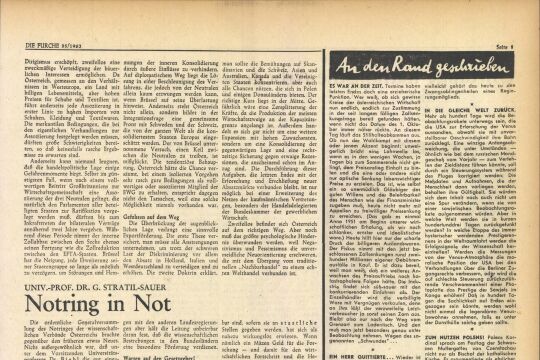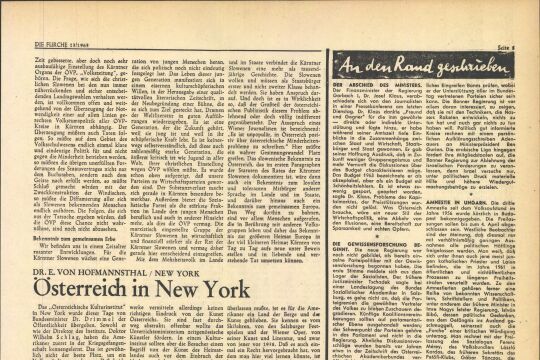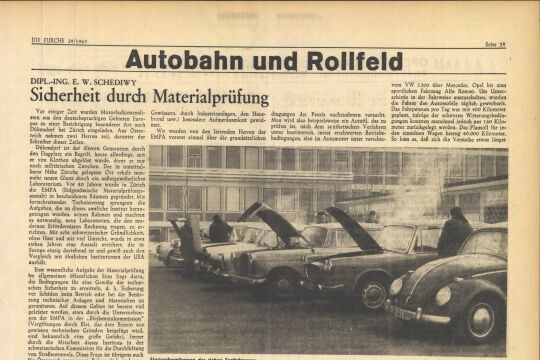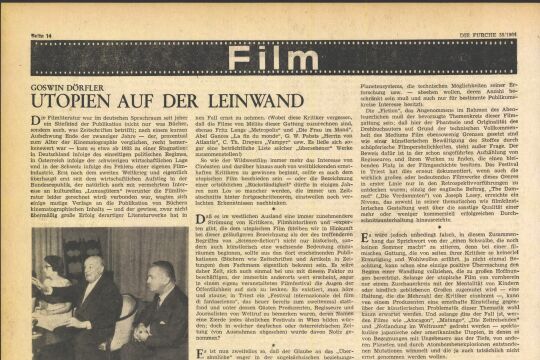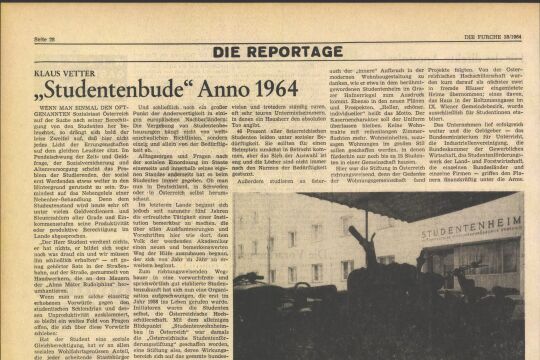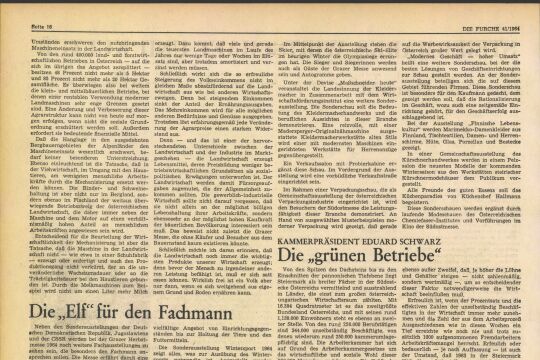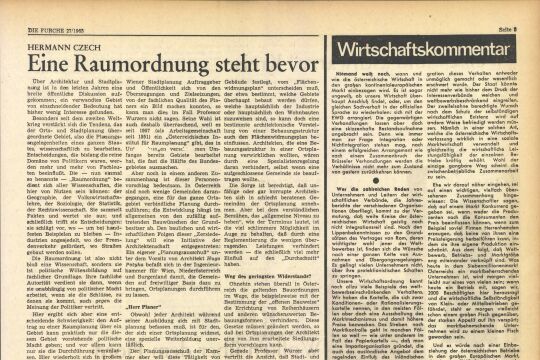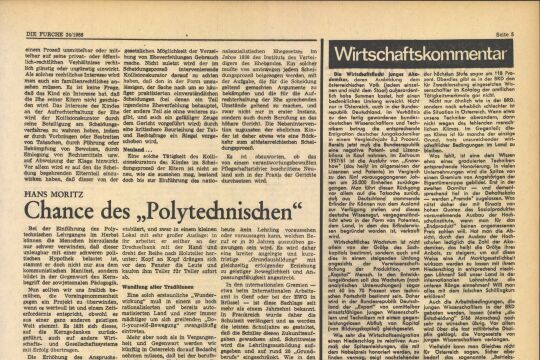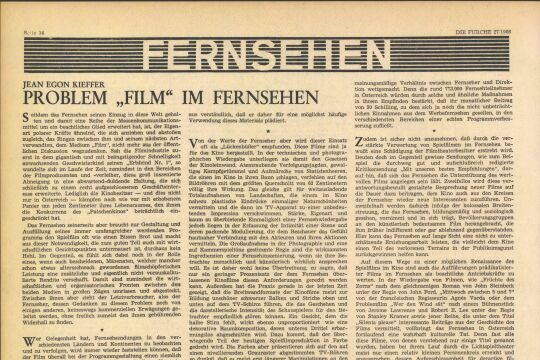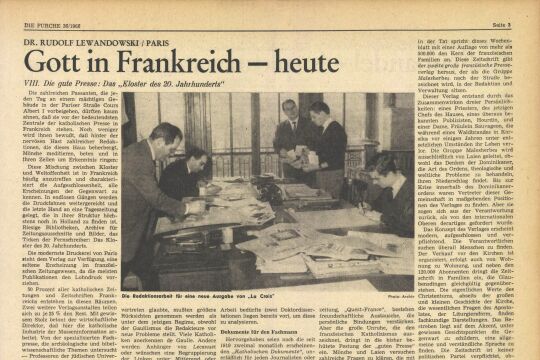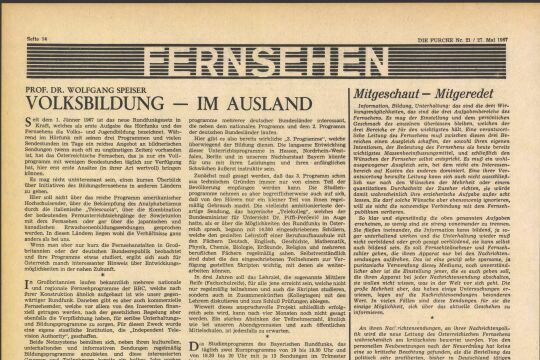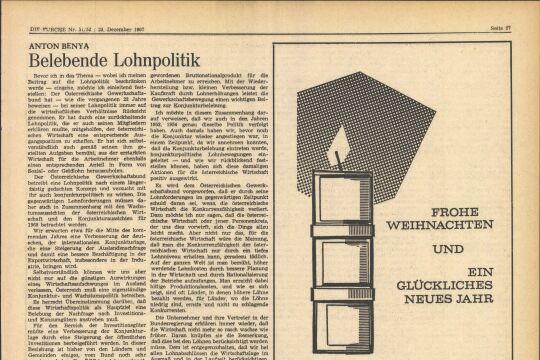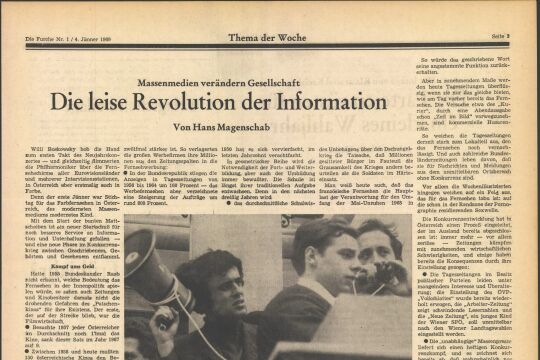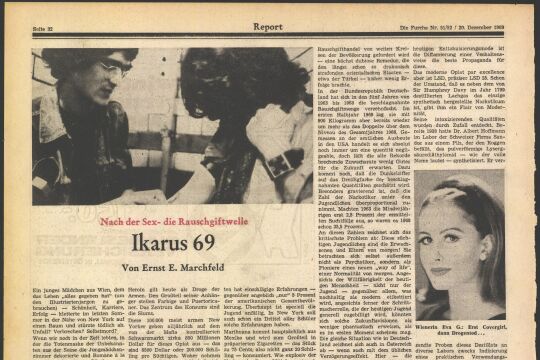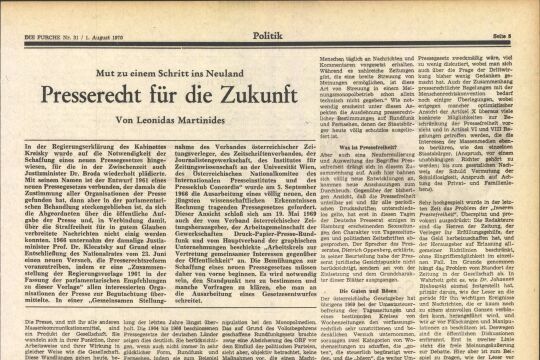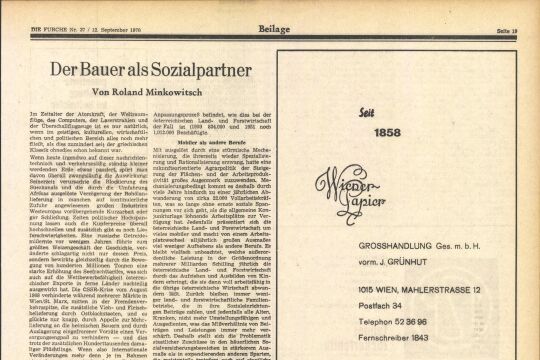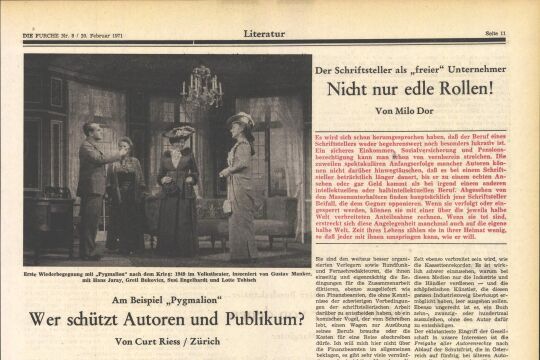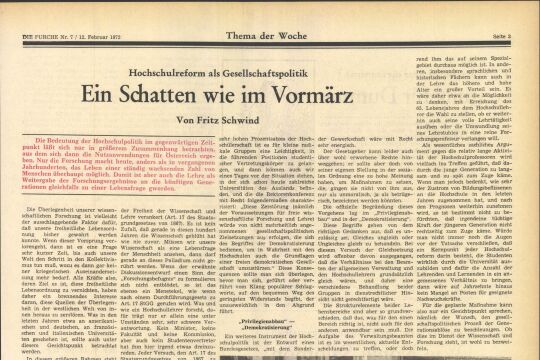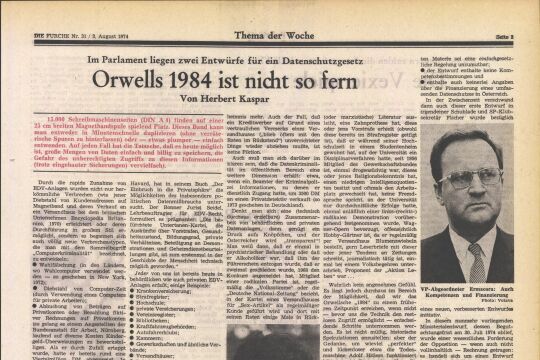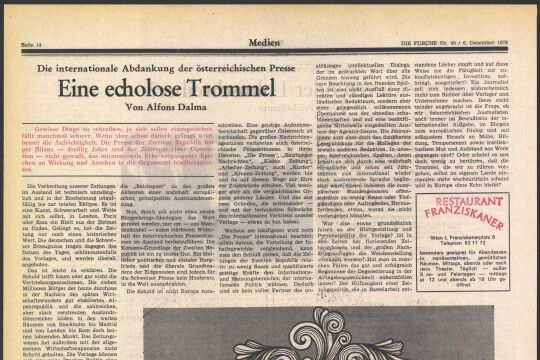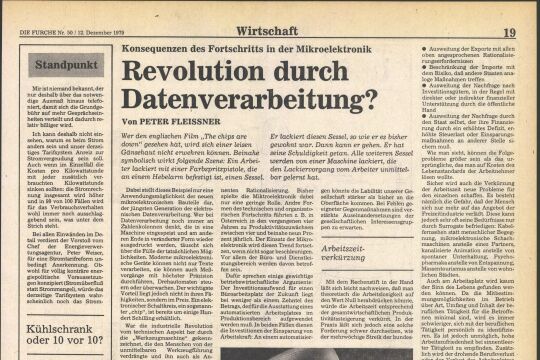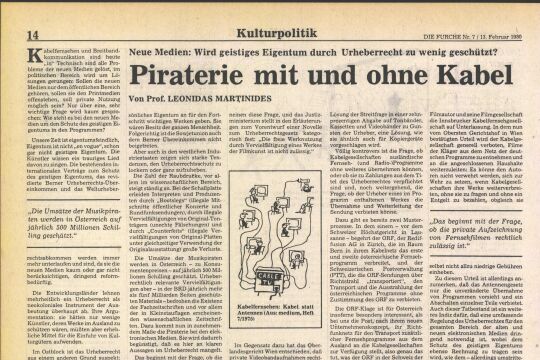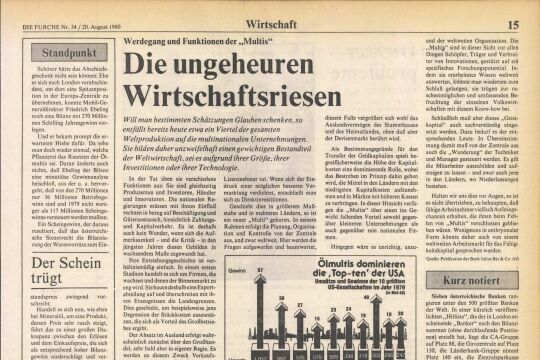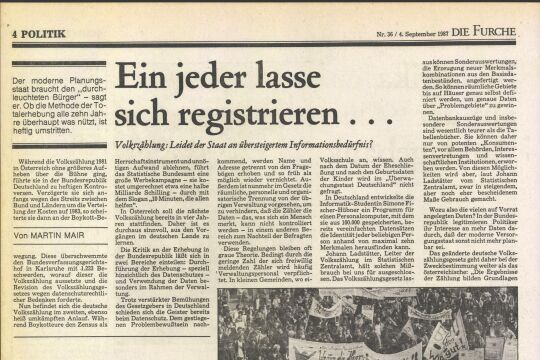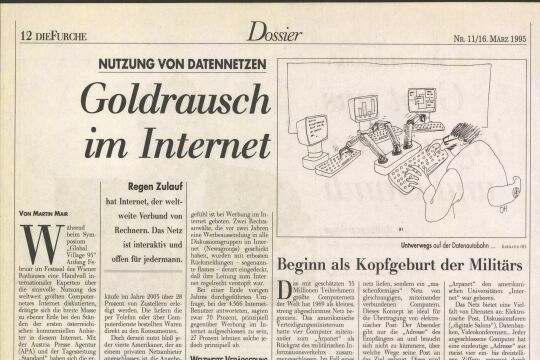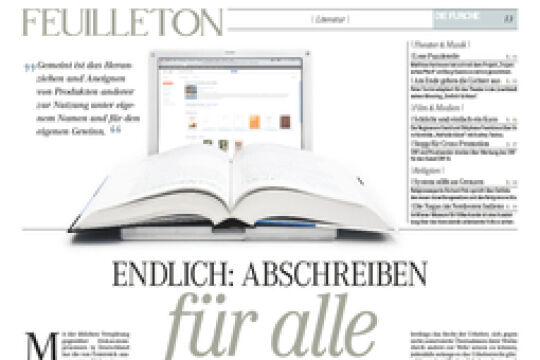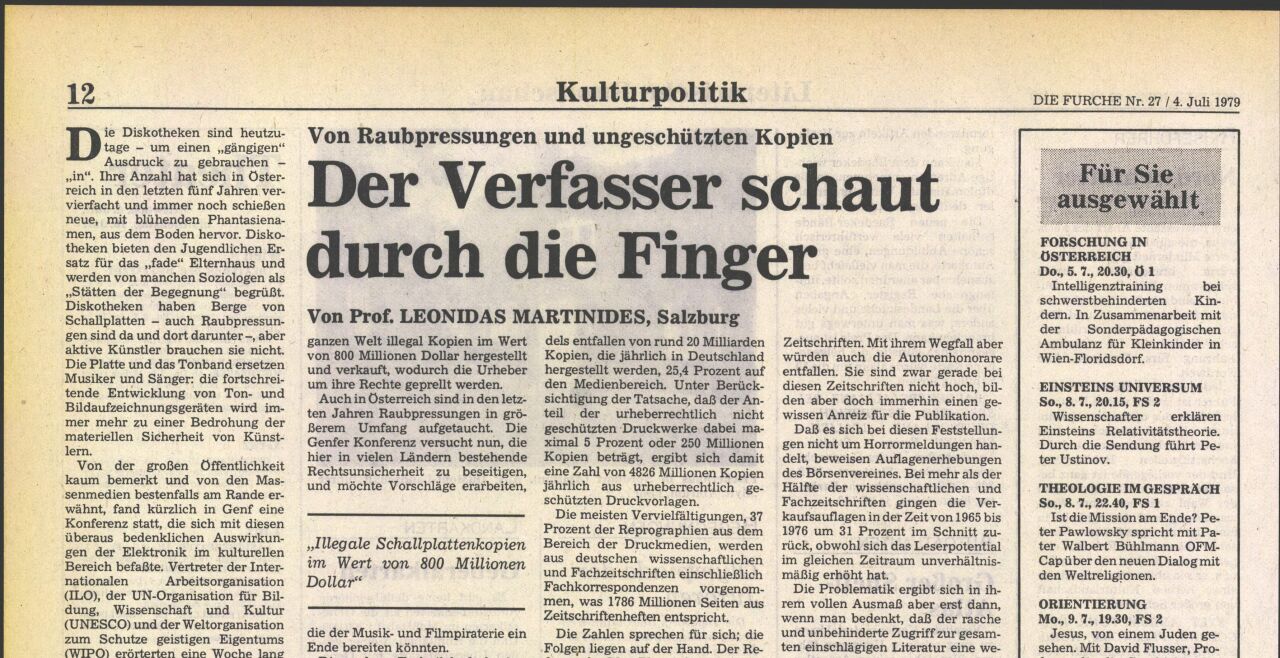
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Verfasser schaut durch die Finger
Die Diskotheken sind heutzutage - um einen „gängigen“ Ausdruck zu gebrauchen -„in“. Ihre Anzahl hat sich in Österreich in den letzten fünf Jahren vervierfacht und immer noch schießen neue, mit blühenden Phantasienamen, aus dem Boden hervor. Diskotheken bieten den Jugendlichen Ersatz für das „fade“ Elternhaus und werden von manchen Soziologen als „Stätten der Begegnung“ begrüßt. Diskotheken haben Berge von Schallplatten - auch Raubpressungen sind da und dort darunter-, aber aktive Künstler brauchen sie nicht. Die Platte und das Tonband ersetzen Musiker und Sänger: die fortschreitende Entwicklung von Ton- und Bildaufzeichnungsgeräten wird immer mehr zu einer Bedrohung der materiellen Sicherheit von Künstlern.
Von der großen Öffentlichkeit kaum bemerkt und von den Massenmedien bestenfalls am Rande erwähnt, fand kürzlich in Genf eine Konferenz statt, die sich mit diesen überaus bedenklichen Auswirkungen der Elektronik im kulturellen Bereich befaßte. Vertreter der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) und der Weltorganisation zum Schutze geistigen Eigentums (WIPO) erörterten eine Woche lang die Tatsache, daß durch den technischen „Fortschritt“ die Zahl der Künstler ständig zurückgeht. Nach Angaben der ILO hat allein in der
Bundesrepublik Deutschland die Zahl der Sänger und Musiker zwischen 1950 und 1970 um 19.000, von 48.500 auf 29.500, abgenommen, gerade in jener Zeit, in der die Diskotheken ihren Siegeslauf antraten.
Im Zusammenhang damit steht die Tatsache, daß immer mehr Raubkopien von Schallplatten auf den Markt kommen. Nach Erhebungen der UNESCO würden allein 1977 in der ganzen Welt illegal Kopien im Wert von 800 Millionen Dollar hergestellt und verkauft, wodurch die Urheber um ihre Rechte geprellt werden.
Auch in Österreich sind in den letzten Jahren Raubpressungen in größerem Umfang aufgetaucht. Die Genfer Konferenz versucht nun, die hier in vielen Ländern bestehende Rechtsunsicherheit zu beseitigen, und möchte Vorschläge erarbeiten, die der Musik- und Filmpiraterie ein Ende bereiten könnten.
Die moderne Technik bedroht aber auch in zunehmendem Maße den Bestand der Zeitschriften, und hier wieder im besonderen jenen der wissenschaftlichen. Die immer weiter ansteigende Kopierflut läßt um ihre Existenz bangen. Die Autoren aber werden dadurch um ihre Urheberrechte gebracht.
Dazu einige Zahlen: Die Technische Informätionsbibliothek (TIB) Hannover vervielfältigt und versendet an jedem Arbeitstag rund 16.000 Kopien aus wissenschaftlichen Zeitschriften und Fachpublikationen. Perfektioniert hat das System die „Lending Division“ der British Library: rund eine Million Aufsätze werden jährlich auf Bestellung kopiert und verschickt, davon rund zwei Drittel-aus Zeitschriften.
Nach Feststellungen des Börsenvereines des Deutschen Buchhandels entfallen von rund 20 Milliarden Kopien, die jährlich in Deutschland hergestellt werden, 25,4 Prozent auf den Medienbereich. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß der An-teü der urheberrechtlich nicht geschützten Druckwerke dabei maximal 5 Prozent oder 250 Millionen Kopien beträgt, ergibt sich damit eine Zahl von 4826 Millionen Kopien jährlich aus urheberrechtlich geschützten Druckvorlagen.
Die meisten Vervielfältigungen, 37 Prozent der Reprographien aus dem Bereich der Druckmedien, werden aus deutschen wissenschaftlichen und Fachzeitschriften einschließlich Fachkorrespondenzen vorgenommen, was 1786 Millionen Seiten aus Zeitschriftenheften entspricht
Die Zahlen sprechen für sich; die Folgejn hegen auf der Hand. Der Referent des Max-Planck-Institutes für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Paul Katzenberger, hat aufgezeigt, wohin dieser Weg führt: „Durch den Kaufeines einzigen Zeit-schriftenexemplares durch eine Bibliothek oder ein Dokumentationszentrum können über Kopien oder im Wege der auf Mikrofilmarchive oder Datenbanken gestützten Fernübertragung die Informationsbedürfnisse aller betroffenen Wissenschaftler eines Landes und darüber hinaus voll befriedigt werden. Die wirtschaftlichen Grundlagen der Zeitschriften werden dadurch völlig zerstört.“
Bedroht sind dabei weniger die minder wertvollen, aber um so mehr die qualitativ hochwertigen, hochspezialisierten, in niedriger Auflage erscheinenden und damit teuren
Zeitschriften. Mit ihrem Wegfall aber würden auch die Autorenhonorare entfallen. Sie sind zwar gerade bei diesen Zeitschriften nicht hoch, bilden aber doch immerhin einen gewissen Anreiz für die Publikation.
Daß es sich bei diesen Feststellungen nicht um Horrormeldungen handelt, beweisen Auflagenerhebungen des Börsenvereines. Bei mehr als der Hälfte der wissenschaftlichen und Fachzeitschriften gingen die Verkaufsauflagen in der Zeit von 1965 bis 1976 um 31 Prozent im Schnitt zurück, obwohl sich das Leserpotential im gleichen Zeitraum unverhältnismäßig erhöht hat.
Die Problematik ergibt sich in ihrem vollen Ausmaß aber erst dann, wenn man bedenkt, daß der rasche und unbehinderte Zugriff zur gesamten einschlägigen Literatur eine wesentliche Voraussetzung für den wissenschaftlich-technischen Fortschritt darstellt.
In verschiedenen Ländern hat man bereits versucht, dem Problem an den Leib zu rücken. In Holland kennt man schon seit 1952 eine Vergütungspflicht für Kopien. Sie beträgt 10 Cents je Kopie, für Kopien zum Unterrichtsgebrauch in Schulen 2,5 Cents pro Kopie einer Druckseite. Auch in Schweden besteht eine ähnliche Regelung. In den USA gibt es seit heuer objektgebundene Gebühren, die an das „Copyright Clearande Centre“ der amerikanischen Verleger zu entrichten sind.
Eben jetzt hat der deutsche Börsenverein eine Denkschrift zu diesem Thema veröffentlicht, in der er Vergütungen für Kopien in Form von Gebühren beim Hersteller und Zusatzgebühren bei den „Betreibern“ solcher Geräte verlangt: Autoren und Verleger sind gleichermaßen daran interessiert, daß das Urheberrecht und der Schutz des geistigen Eigentums nicht durch eine billige Kopierflut unterlaufen wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!