
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Grabtuch und Ikone
Seit das Christenturh im Verlauf des ersten nachchristlichen Jahrhunderts sich in Rom durchsetzte, mußte es sich mit den vielen dort herrschenden Religionen auseinandersetzen, woraus sich eine völlige Ablehnung alles Heidnischen ergab.
Von römischer Seite aus waren alle Religionen erlaubt und zugelassen, soweit alle Bürger - gleich welcher Religion sie angehörten — den offiziellen römischen Kaiserkult akzeptierten. Das aber gerade war für die Christen unmöglich, da das Hauptelement des Kaiserkultes die Erklärung irgendeiner staatlich bedeutenden Person, vorwiegend der Kaiser, zum Gott und die damit verbundene Versetzung dieser Person in den Himmel war. Für die Christen konnte der Thron im Himmel aber nur die durch Christus verkündete Trinität einnehmen.
Aus dieser ablehnenden Einstellung entstand ein heftiger Konflikt, da für die Römer die Anerkennung des Kaiserkultes gleichzeitig die Anerkennung ihres Staates bedeutete. Wer diesen Kult verweigerte, wurde zum Staatsfeind erklärt und damit zu Marter und Tod verurteilt. Die daraus folgenden vielen Martyrien gingen also, römisch gesehen, den Christen zu Lasten. Im Laufe von drei Jahrhunderten gab es dabei aber mildere und strengere Richter, und so war es dem Christentum doch möglich, trotz zeitweiliger Verfolgungen weiter zu existieren und sogar bald eine verhältnismäßig große Zahl der Bevölkerung in seine Reihen zu binden.
In den „Ruhepausen“ der Verfolgungen entstanden daher auch christliche Kultstätten, nicht nur bei den Gräbern der Katakomben, sondern auch in gewöhnlichen Wohnhäusern, und damit verbundeh entwickelten sich auch eigene Formen von Kulthandlungen. Obwohl das Christentum im Judentum wurzelte, waren die neuen Christen in Rom vorwiegend Römer und Griechen, einschließlich einiger Provinzialen, die, ihrer Herkunft nach ursprünglich Heiden, an gewisse Kultvorstellungen gewohnt waren, denen sich der neue christliche Kult in irgendeiner Weise anschließen mußte. Da aber nun alle vorhandenen Kulte ein Kultbild als zentrales Element besaßen, mußten sich auch die Christen mit dieser Frage auseinandersetzen, obwohl durch das mosaische Gesetz ihrer geistigen Ahnen, der Juden, das Bild Gottes verboten war.
Als erster Kompromiß entstanden illustrative Szenenbilder von Begebenheiten aus dem Alten Testament, die formal mit römischen Szenenbildern völlig identisch waren, sich von diesen nur inhaltlich unterschieden und sicher von Heiden ohne weiteres als religiöse Bilder irgendeines Kultes angenommen wurden. Ergänzt hat man diese Bilder durch Symbole, unter denen das Kreuz oder gar die Kreuzigung, restlos vermieden wurden. So wurde auch das Bild des Gottes selbst vermieden.
Trotzdem tritt in diesen frühen Bildern Christus immer wieder auf, nicht aber als göttlicher „Genius“, wie bei den Heiden, sondern im römischen Gewand, etwa als Lehrender mit seinen Jüngern, als Heilender mit Kranken, als Wundertäter oder Erwecker von Toten. Wohl im Verband mit bereits vorhandenen antiken Vorstellungen, erscheint er auch als „Guter Hirte“ mit einem Lamm auf den Schultern.
Aus alldem resultiert, daß die Christen in den ersten Jahrhunderten nicht recht wußten, wie sie ihren Gott darstellen sollten oder ein eindeutiges Bild von ihm gar nicht wollten; es boten sich viele Möglichkeiten an, die aber alle der römischen Tradition entsprangen.
All dies änderte sich radikal durch das Eingreifen Kaiser Konstantins am Beginn des vierten
Jahrhunderts. Konstantin setzte, im entschiedenen Gegensatz zu seinem Vorgänger Diokletian, durch das Toleranzedikt von 312 den Kaiserkult ab, kam aber dadurch — staatlich gesehen — in die Gefahr, das einigende Band um die verschiedenartige Bevölkerung des Reiches zu verlieren. Weder der von ihm angebetete, unbesiegbare Sonnengott, noch Christus konnten an diese staatsnotwendige Stelle gesetzt werden. Nur ein langwieriger Prozeß würde die Frage lösen.
Einstweilen blieb das Bild des neuen Gottes indifferent in vielen verschiedenartigen Darstellungen. Auch durch die Errichtung großer kaiserlicher christlicher Basiliken in Rom (Lateran-Basilika, St. Peter), in Jerusalem und in Konstantinopel kam keine Entscheidung in der Kultbildfrage. Erst lange nach Konstantins Tod trat die endgültige Wendung ein. Theodosius der Große veröffentlichte im Jahre 388 ein Edikt, nach dem alle Bürger des Reiches jene Religion annehmen mußten, die Petrus und Paulus nach Rom gebracht haben. Damit wurde das Christentum zur Staatsreligion, aber auch dazu berufen, die frühere Staatsreligion, den Kaiserkult, der immer noch existierte, zu ersetzen.
Dieser Kult bestand in einem Weihrauchopfer jedes einzelnen vor dem Bild eines „Staatsgottes“: eines Kaisers. Bei der Weihe der Laterankirche im Jahre 324 übergab Konstantin dem Bischof ein Weihrauchfaß als sichtbares Zeichen der Ubergabe des Kultes. Damit erwuchs aber dem Christentum die Aufgabe, ein einwandfreies Bild seines Gottes zu zeigen, vor dem Weihrauch angezündet werden sollte. Dazu eigneten sich aber weder narrative Szenenbilder noch Symbole, denn das bisherige Bild war ein erkennbares Porträt. Notwendig also war die Suche nach einem Porträt Christi. Akut wurde dieses aber erst nach der Erklärung des Christentums zur Staatsreligion am Ende des vierten Jahrhunderts.
Wir ahnen nicht, auf welchem Wege in der Zeit zwischen 370 und 400 zuerst auf Sarkophagen, dann in Katakombenbildern und sogar in Apsismosaiken plötzlich em neues Christusbild auftauchte. Es ist jenes uns bestens bekannte Bild mit dem schmalen Gesicht, den langen Haaren, dem Bart, ein ernstes Gesicht, das der römischen Bildtradition nicht entspricht — ja, es gibt sogar Aussprüche aus dieser Zeit, die fragen, warum die Christen ihren Gott so häßlich und fremdartig zeigen. Und doch ist das jenes Bild, das sofort alle anderen verdrängte und sich durch fast zwei Jahrtausende erhielt. Dieses Büd wurde offiziell und konnte somit auch die Bilder des Kaiserkultes verdrängen.
Heute aber können wir feststellen, daß dieses Bild mit dem Abdruckbild auf dem Grabtuch Christi—der Santa Sindone in Turin — völlig übereinstimmt. Wieso die Christen der theodosianischen Zeit auf dieses Bild gestoßen sind, das nach einem apokryphen legendären Bericht im syrischen Emesa (heute Horns) aufbewahrt worden sein soll, bleibt ungeklärt. Die formale Ubereinstimmung aber ist nicht zu leugnen.
Daraus entstanddielkone Jesu Christi, die später durch Jahrhunderte hindurch sich als Panto-kratorbild, als nicht von Menschenhänden geschaffenes Büd in Tausenden Ikonen erhalten hat. Auf Holztafeln in Wachsfarbenmalerei hergestellt, wie ursprünglich die transportablen Büder der Kaiser, in Skulpturen und als Mosaik wurde dieses Bild mit erstaunlicher Treue immer wieder kopiert. E s ist die erste und bedeutendste Ikone, die das Porträt Christi zeigt, der gesagt hat: „Wer mich sieht, sieht den Vater.“ Eine unendliche Flut von Ikonen, Bildern Christi, Mariens und der Heiligen ist davon ausgegangen, deren Wesen immer war und ist: Durch das Heiligenbüd hindurch „das Heilige“ theologisch und philosophisch sichtbar zu machen.
Der Autor ist Professor für Kunstgeschichte an der Universität Salzburg und ehemaliger Direktor des österreichischen Museums für angewandte Kunst in Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




















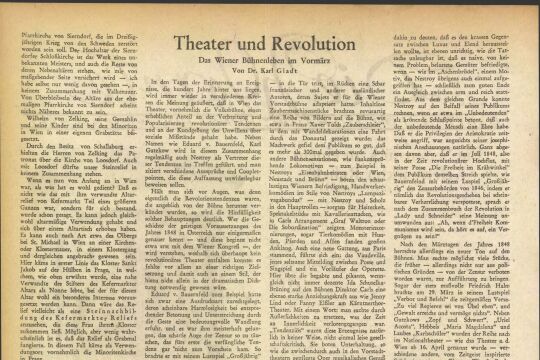




















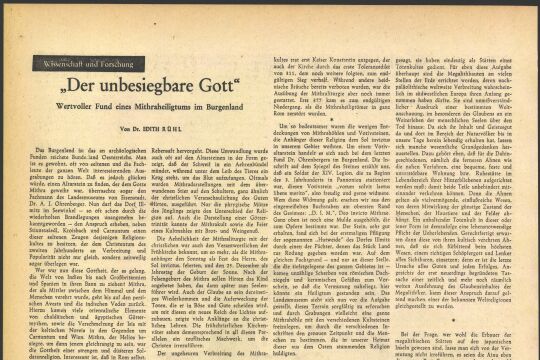



















































.jpg)


