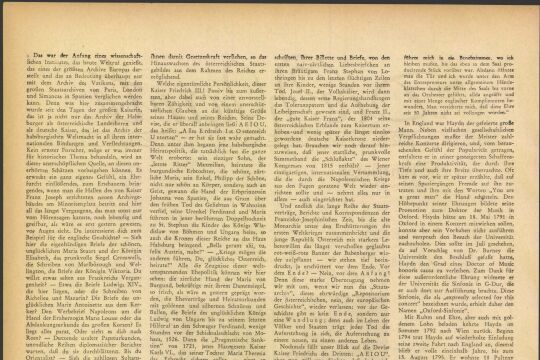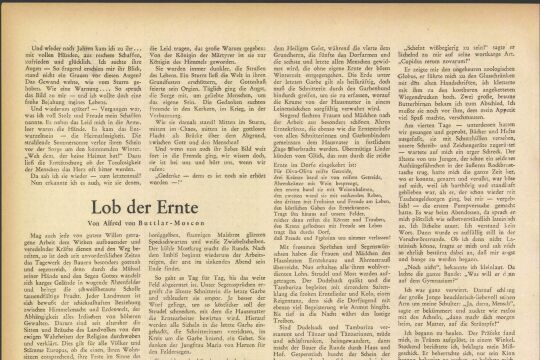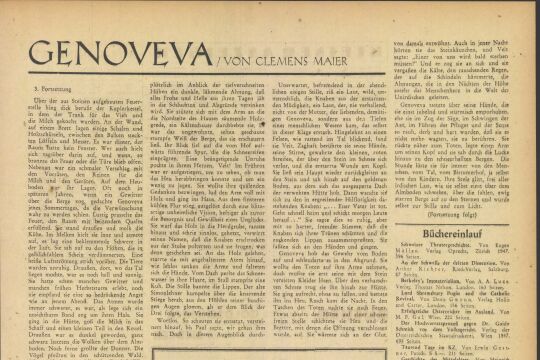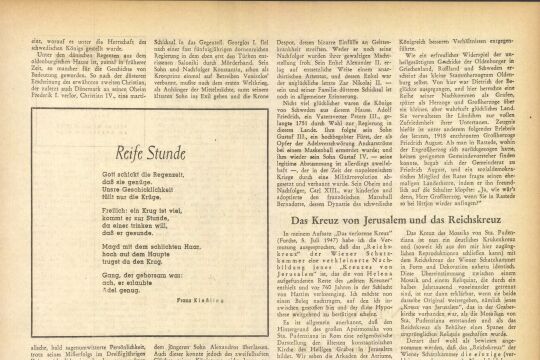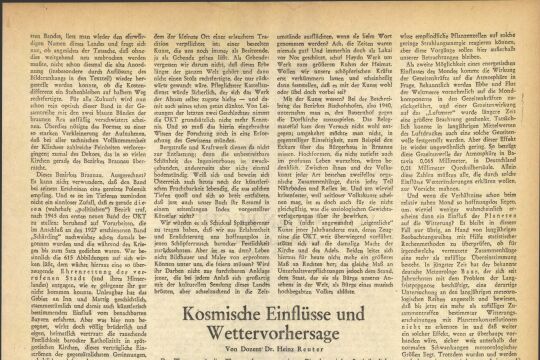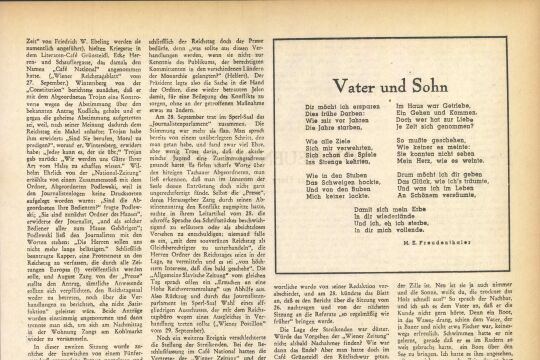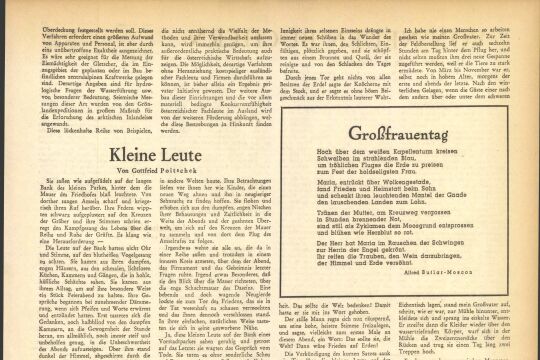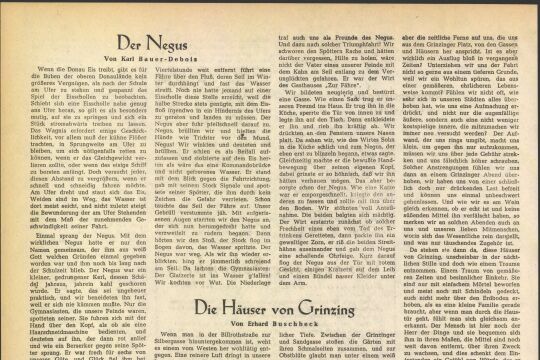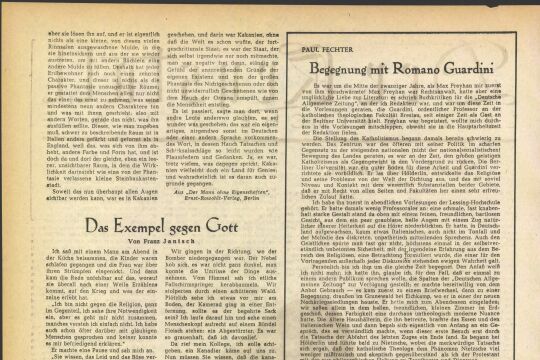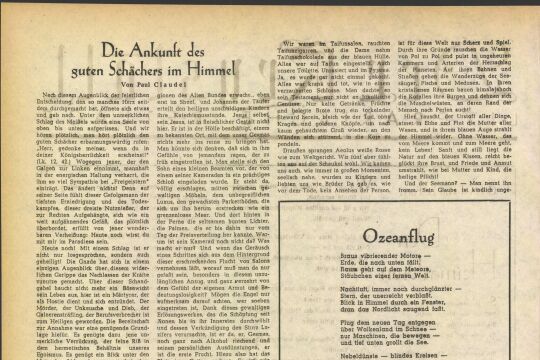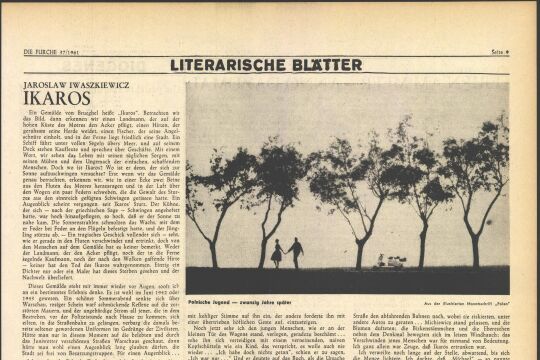Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Invasion am D-Day
6. Juni 1944: Um vier Uhr wurden wir auf offenem Deck versammelt. Die Landungsfahrzeuge pendelten an den Kränen, fertig zum Hinablassen. Die zweitausend Männer standen in völligem Schweigen, während sie auf den ersten Lichtstrahl warteten. Was immer sie auch denken mochten — es war so etwas wie ein Gebet.
Die Männer der ersten Welle stolperten in ihre Boote und schwebten — wie in langsamen Fahrstühlen — auf das Wasser hernieder. Die See war rauh, und wir waren naß, bevor unser Fahrzeug vom Mutterschiff absetzte.
Im Handumdrehen fingen die Männer an, sich zu übergeben. Doch diese Invasion war nicht nur sorgfältig, sie war auch höflich vorbereitet, denn für diesen Fall waren kleine Papierbeutel vorgesehen. Bald erreichte das allgemeine Erbrechen einen Höhepunkt, und ich dachte mir, daß alle künftigen Invasionen wohl aus Erbrechen hervorgehen würden.
Die Küste der Normandie war noch kilometerweit entfernt, als wir die unmißverständlichen Geräusche der Schießerei vernahmen. Wir duckten uns tief ins Fahrzeug hinunter, dicht über das mit Erbrochenem vermischte Kielwasser, und hörten auf damit, die näherkommende Küste zu beobachten.
Der flache Boden unseres Bootes schurrte auf Frankreichs Erde. Der Bootsmann ließ den stahlbewehrten Bug des Fahrzeugs herunter — und dort drüben, zwischen den grotesken Gebilden der stählernen Hindernisse, die aus dem Wasser ragten, lag ein schmaler Sandstreifen, über dem der Qualm hing: unser Europa; die „Easy-Red"-Küste.
Mein schönes Frankreich sah schmutzig und wenig einladend aus, und ein deutsches Maschinengewehr, das rings um unser Boot seine Geschosse spuckte, verdarb mir meine Rückkehr vollends. Die Männer aus meinen Boot wateten bis zu den Hüften im Wasser, die schußbereiten Gewehre in der Hand, im Hintergrund standen die Stahlhindernisse und die qualmende Küste.
Das Wasser war kalt und der Strand noch mehr als hundert Meter entfernt. Die Kugeln rissen Löcher in das Wasser rings um mich, und ich arbeitete mich an das nächstliegende Stahlhindernis heran. Ein Soldat kam dort gleichzeitig mit mir an, und eine kleine Weile lang benutzten wir es beide als Deckung. Er zog den wasserdichten Uberzug von seinem Gewehr und begann, ohne viel zu zielen, auf den rauchgeschwärzten Strand zu schießen. Das Knallen seiner eigenen Abschüsse gab ihm genug Mut, weiter vorzugehen, und er überließ mir das Hindernis für mich allein.
Jetzt war es einen Fuß breiter, und ich fühlte mich sicher genug, um Aufnahmen von den anderen Jungs zu machen, die sich genau wie ich versteckten. Es war immer noch sehr früh und zu früh für gute Bilder, doch das graue Wasser und der graue Himmel ließen die kleinen Burschen unter den surrealistischen Sperren, die sich Hitlers Gehirntrust ausgedacht hatte, sehr effektvoll erscheinen.
In meinen Hosen stand die kalte See. Zögernd versuchte ich, von meinem Stahlträger wegzukommen, aber die Kugeln trieben mich jedesmal wieder zurück. Fünfzig Meter vor mir ragte einer unserer halb ausgebrannten Amphibientanks aus dem Wasser und bot die nächste Deckung.
Ich wog meine Chancen ab und lief auf den Tank zu. Ich erreichte ihn zwischen treibenden Leichen.
Jetzt spielten die Deutschen mit vollem Orchester auf allen Instrumenten. Ich konnte keine Lücke zwischen den Kugeln und Granaten finden, die die letzten fünfundzwanzig Meter zum Strand blockierten. So blieb ich einfach hinter meinem Tank.
Die Flut setzte ein, und jetzt reichte mir das Wasser bis an den Abschiedsbrief an meine Familie in der Brusttasche. Gedeckt durch die zwei letzten Burschen, erreichte ich den Strand. Ich warf mich flach hin, und meine Lippen berührten Frankreichs Erde. Sie zu küssen, fühlte ich kein Bedürfnis. Der Jerry hatte noch eine Menge Munition übrig, und ich sehnte mich heiß danach, jetzt unter der Erde zu sein und erst später wieder obendrauf. Die Chancen für den umgekehrten Fall wuchsen jedoch zusehends.
St. Laurent-sur-Mer muß einmal ein farblos-langweiliges, schäbiges Seebad für französische Schullehrer in den Ferien gewesen sein. Jetzt, am 6. Juni 1944, war es die häßlichste Küste der ganzen Welt.
Von der Flut und von Furcht erschöpft lagen wir flach hingeworfen auf einem schmalen Streifen nassen Sandes zwischen See und Stacheldraht. Der flache Winkel, in dem der Strand sich senkte, gab uns etwas Deckung, solange wir unter dem MG- und Gewehrfeuer platt liegenblieben, doch die Flut drückte uns näher an die Stacheldrahtverhaue heran, wo die feindlichen Geschütze Hochsaison hatten.
Aus der Luft muß „Easy Red" wie eine offene Sardinenbüchse ausgesehen haben. Aus der Sardinenperspektive gesehen, war der Vordergrund meiner Bilder mit nassen Stiefeln und grünlichfar-benen Gesichtern angefüllt. Uber den Stiefeln und Gesichtern sah man nur noch Schrapnellrauch, ausgebrannte Panzer und im Hintergrund sinkende Landungsfahrzeuge.
Die nächste Mörsergranate fiel zwischen den Drahtverhau und die See, und jeder Granatsplitter fand seinen Mann.
Ein Landungsfahrzeug trotzte dem Feuer, und aus ihm quollen Sanitäter mit aufgemalten roten Kreuzen auf den Stahlhelmen. Ich dachte nichts und ich entschied auch nichts. Ich richtete mich einfach auf und rannte auf das Fahrzeug zu. In der See kam ich zwischen zwei Leichen zu stehen, das Wasser reichte mir bis zum Hals.
Meine Kamera hielt ich hoch über dem Kopf, und plötzlich wußte ich, daß ich davonlief. Ich wollte mich umwenden, aber ich hatte Angst vor dem Strand.
Unser Schiff krängte, und wir entfernten uns langsam von der Küste, um das Mutterschiff zu erreichen, bevor wir sanken. Ein Landungsfahrzeug kam längsseits und holte uns von dem sinkenden Schiff herunter. Das Fahrzeug brachte uns zur „U. S. S. Chase", dem gleichen Schiff, das ich erst vor sechs Stunden verlassen hatte. Auf der „Chase" wurde gerade die letzte Welle des 16. Infanterieregiments von Bord gehievt, aber die Decks waren bereits mit zurückgekehrten Verwundeten und Toten besät.
Dies war meine letzte Chance, zur Küste zurückzukehren. Ich ging nicht. Die Messeordonnanzen, die am Morgen unseren Kaffee in weißen Jacken und weißen Handschuhen serviert hatten, waren jetzt blutbeschmiert und nähten die Toten in weiße Säcke.
Gekürzter Auszug aus Robert Capas Erlebnisbericht „Die Invasion"; entnommen aus dem Buch „Das Gesicht des Krieges", Econ-Verlag, Düsseldorf-Wien 1965.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!