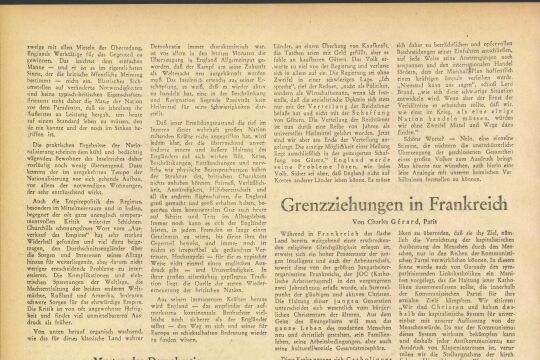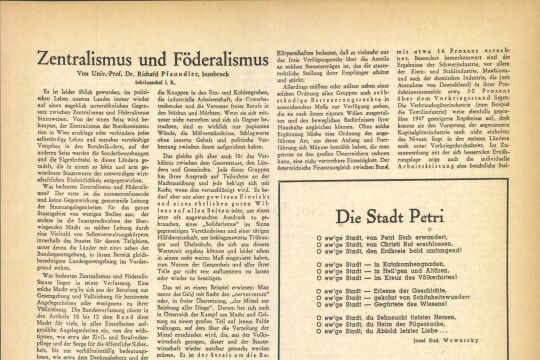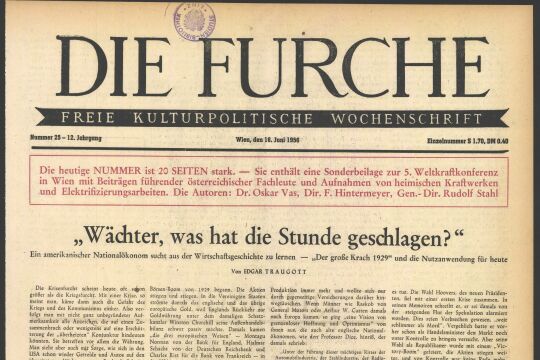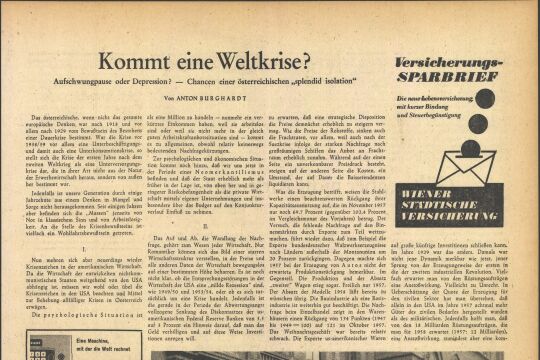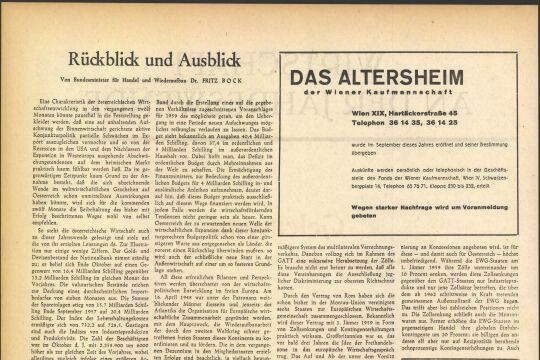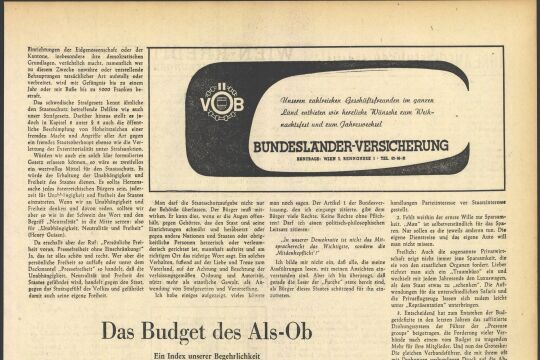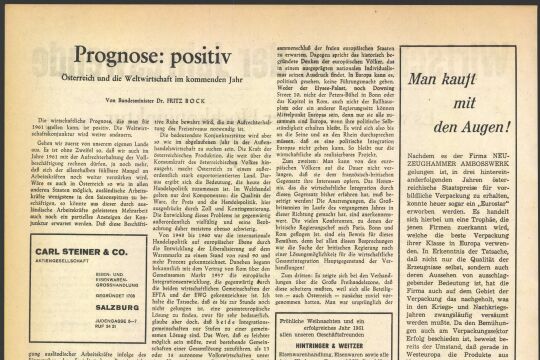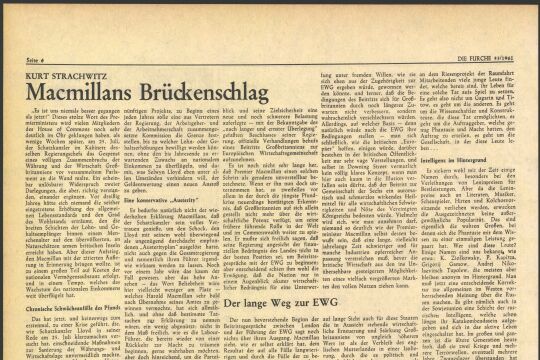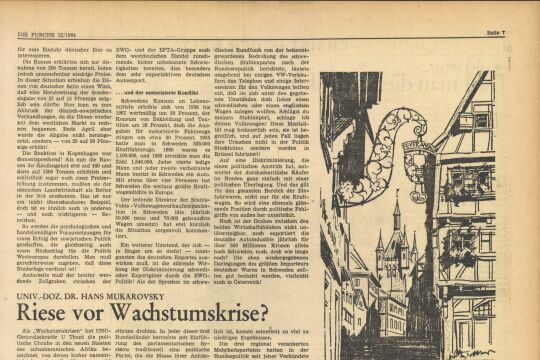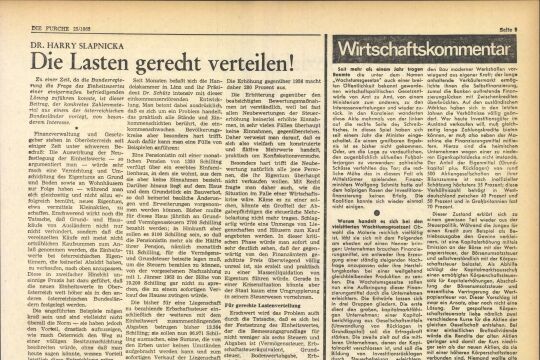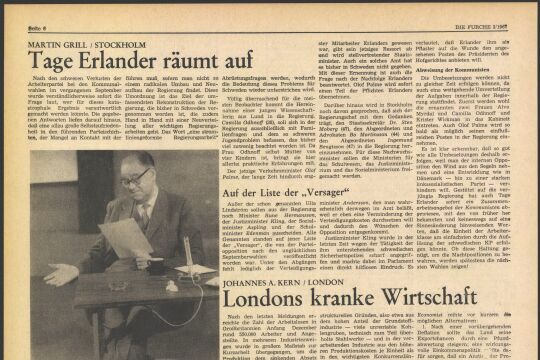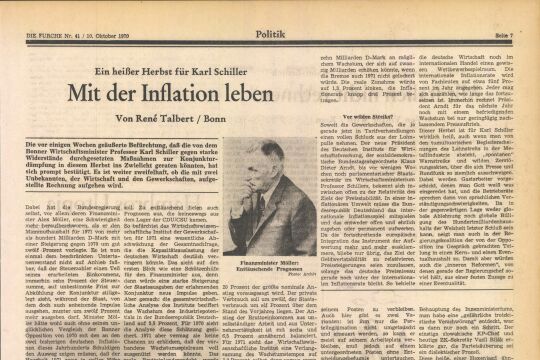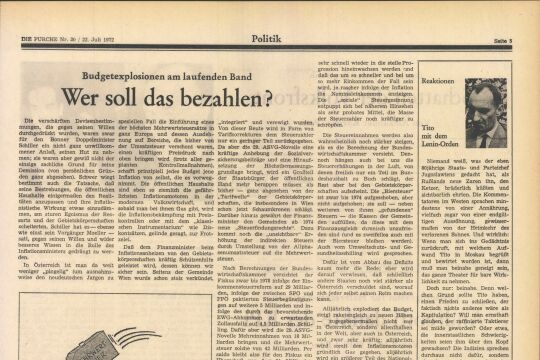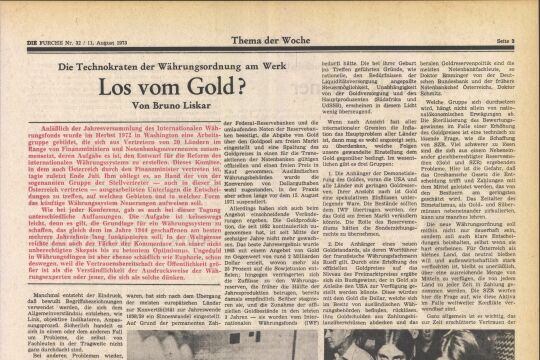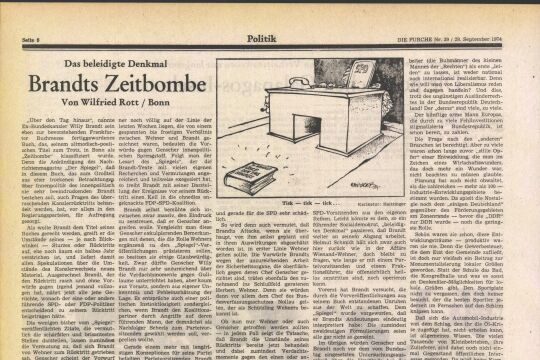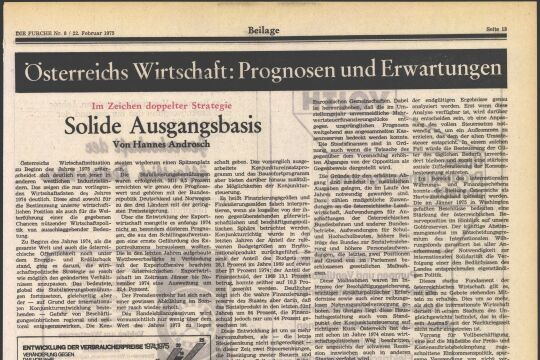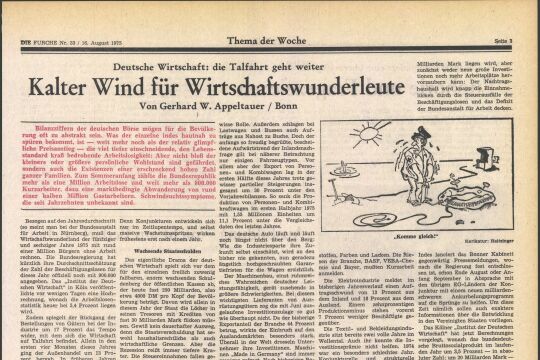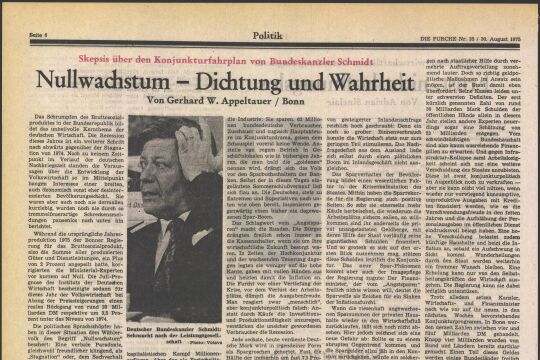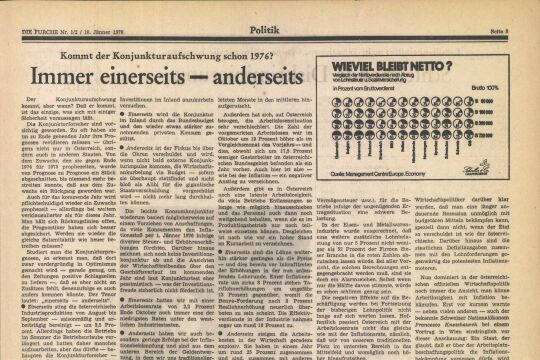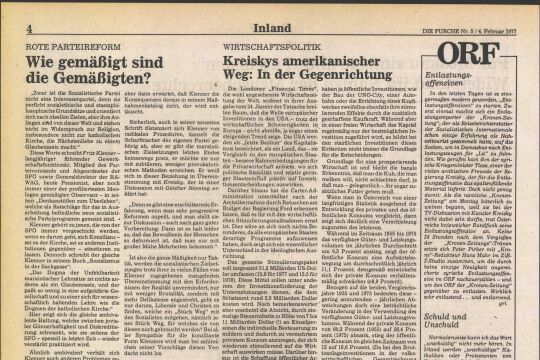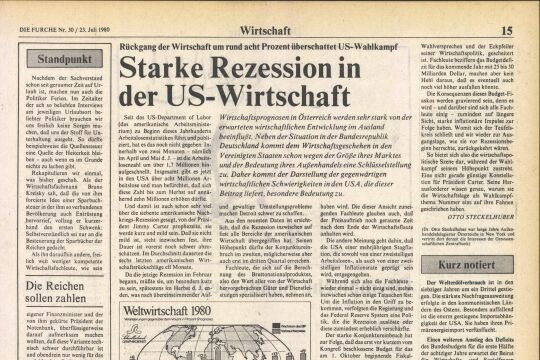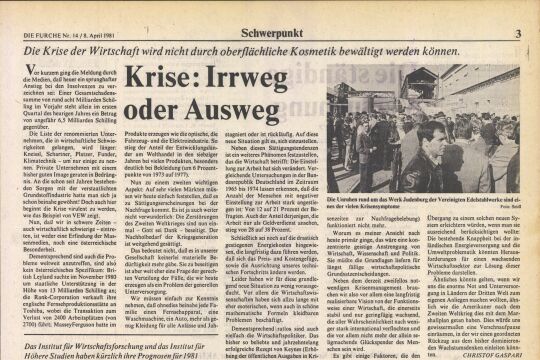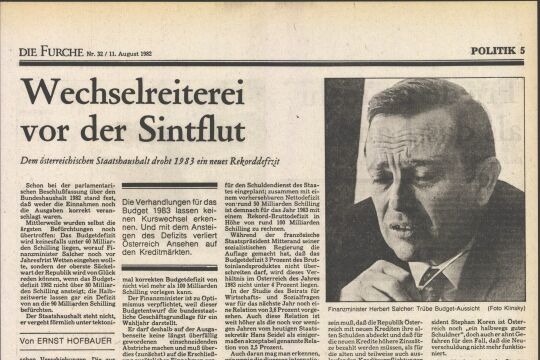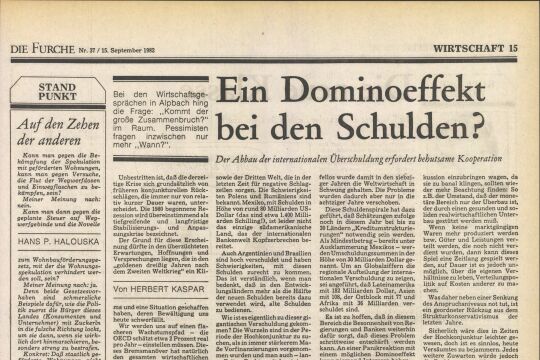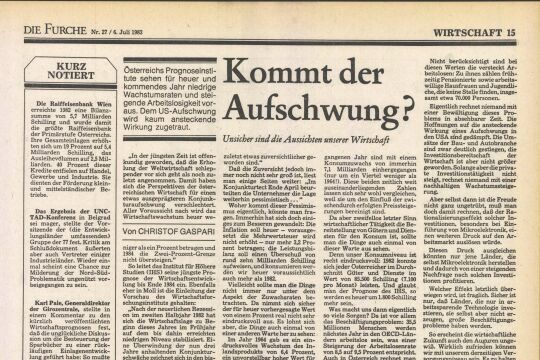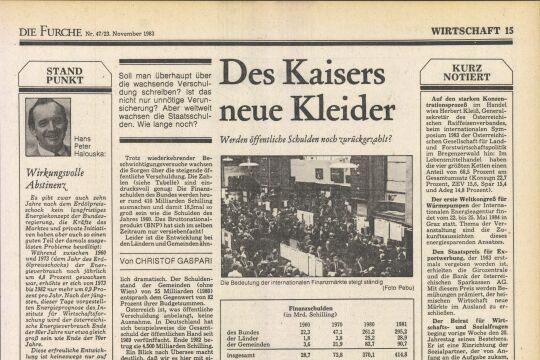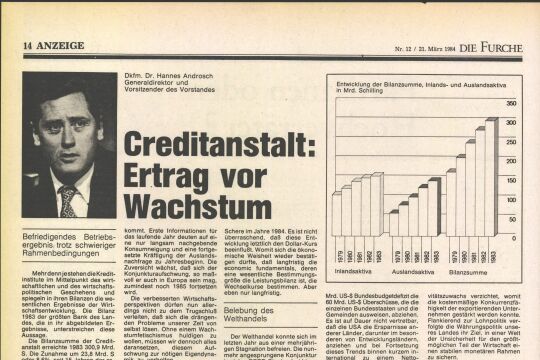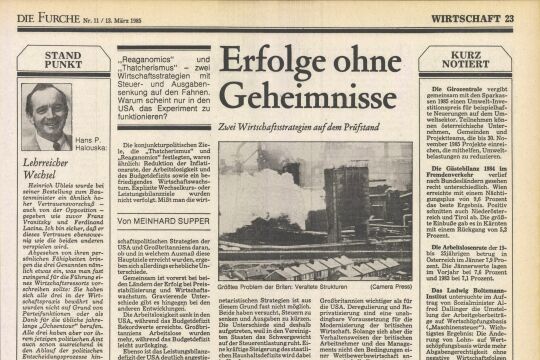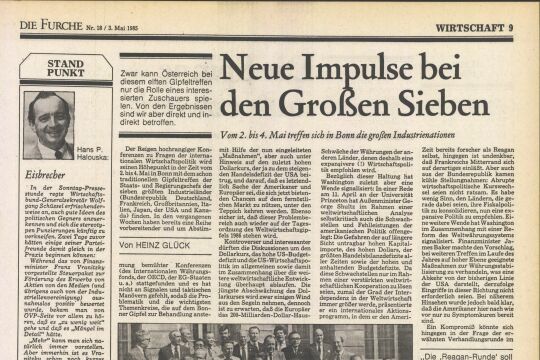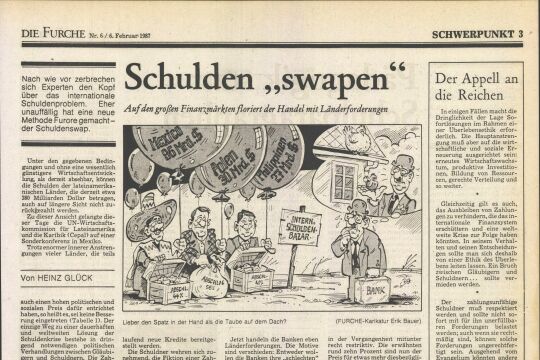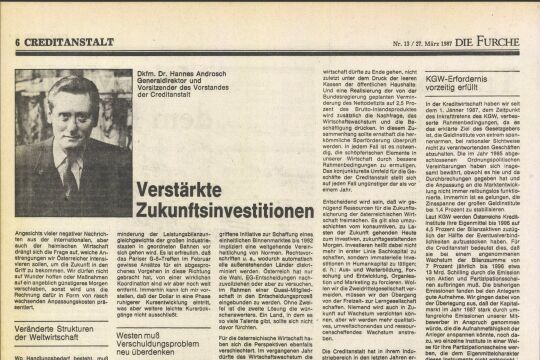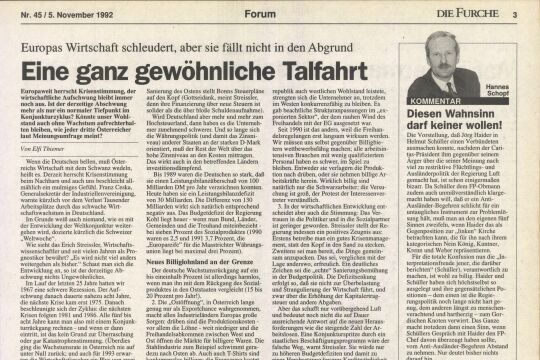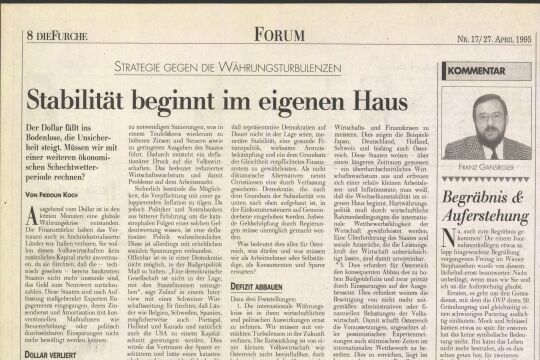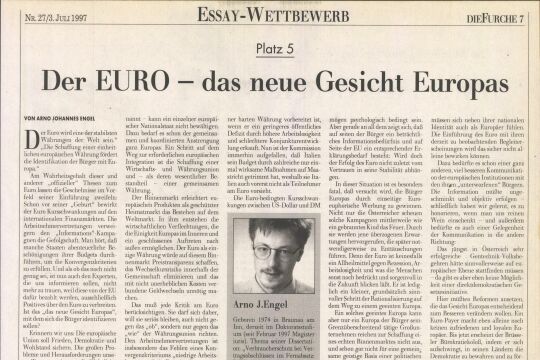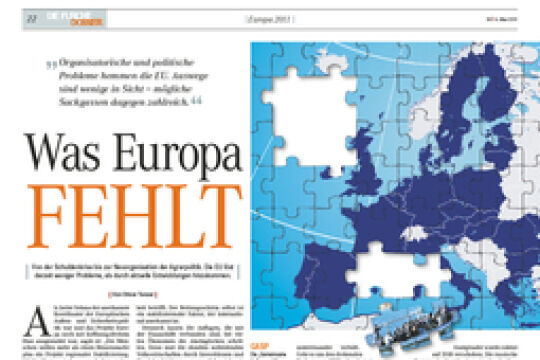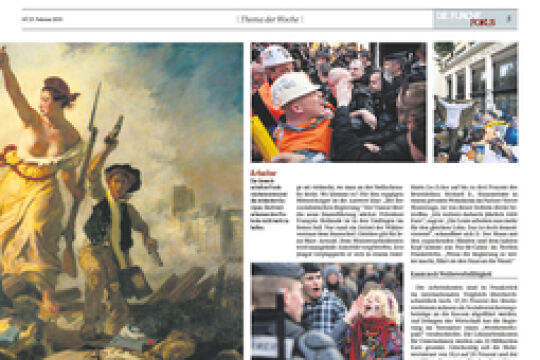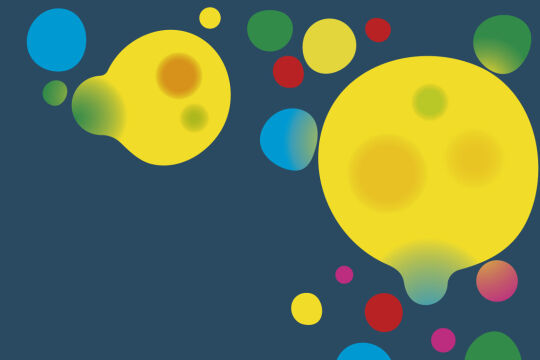Der EU-Gipfel wird die wichtigsten Themen der Union unberührt lassen. Das wird die Differenzen und Brüche unter den Staaten weiter verschärfen.
Selbst in Zeiten schrumpfender Wirtschaftskraft kann man auf einen Wachstumsbereich ganz sicher zählen: die Klasse der Millionäre. Elf Millionen Menschen waren es 2011, deren Reichtum über eine Million Dollar betrug. In Deutschland, der Wirtschaftsnation Nummer eins, leben gleich 951.000 davon - das sind immerhin um drei Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Würde man Anteilscheine am Vermögen der Superreichen der Erde ausgeben, man hätte auch dieses Jahr wieder ein blendendes Geschäft gemacht: Das Vermögen der Reichen wuchs weltweit um 9,7 Prozent. Der aktuelle "World Wealth Report“ nennt diese Entwicklung "nachhaltig“ gemessen an jener des Boomjahres 2009, als der Reichtum der Reichsten um 17 Prozent gestiegen war.
Eine Solidaritäts-Illusion
Das sind Wachstumsraten, die EU-Staaten derzeit nur in sehr zweifelhafter Art erreichen, etwa beim Budgetdefizit oder bei Arbeitlosenraten. Aber man kann es durchaus positiver sehen: Geld wäre genug da - ein Eintausenddreihundertstel der Millionärsvermögen würde ausreichen, um die Schulden Griechenlands zu tilgen.
Gäbe es eine solche Solidarität zwischen Individuen und Staaten, der am 26. Juni beginnende EU-Gipfel von Brüssel könnte ausführlich die ausgehende dänische Ratspräsidentschaft begießen oder die wenigen sonst anstehenden Leichtgewichtsfragen begackern, wie etwa die europäische Perspektive Montenegros.
Dass von solcher Entspannung keine Spur sein wird, dafür werden schon allein die 10 Milliarden Euro sorgen, die Zyperns Banken vom EU-Rettungsschirm brauchen werden und jene 60 Milliarden aus den EU-Töpfen, ohne die Spaniens Sparkassen in Wochenfrist in den Orkus stürzen würden.
Vielleicht war es die Fantasie, mit ein wenig Aderlass der Vermögenden ein optimales Ziel zu erreichen, das jene beflügelt hat, die in den vergangene Tagen einer EU-weiten Finanztransaktionssteuer das Wort geredet haben: Frankreich, Deutschland und Österreich.
Doch die Diskussion darüber zeigt schon, wie tief die Gräben innerhalb der Union sind. Die Steuer wird, wenn überhaupt, dann höchstens in einer kleinen Staatengruppe umgesetzt werden können. Ähnlich unharmonisch ist die Lage beim entscheidenden Thema Fiskalunion. Je mehr etwa Deutschland und Frankreich von vertiefter Integration reden, desto unklarer wird der Weg dorthin. Frankreich scheint darunter eine EU-Vermögensumverteilung bei intakter nationaler Souveränität zu verstehen - Deutschland das gerade Gegenteil.
Fortschritte relativiert
Andere üben sich im Erfinden neuer Gräben. Der britische Premier David Cameron empörte mit dem Vorschlag, französische Unternehmen, die sich von neuen Steuern der sozialistischen Regierung in Paris erpresst fühlten (75 Prozent Einkommenssteuer auf Millionäre, steigende Konzernabgaben), sollten doch nach Großbritannien übersiedeln, wo "für sie immer eine Türe offensteht“.
Eine solche Konkurrenz unter Partnern mag zu anderen Zeiten die Märkte beflügeln. Doch in Verbindung mit der britischen Debatte zu einem EU-Austritts-Referendum wirkt die Einladung doppelt brisant.
Dazu noch relativieren sich derzeit viele als große Fortschritte verbuchte Maßnahmen der Eurozonen-Regierungschefs. Der neue EU-Rettungsschirm, der den Gläubigerländern einen bevorzugten Status bei der Schuldenbegleichung eingeräumt hätte, wird selbst im Erfinderland Deutschland zum juristischen Wackelkandidaten. Das mit großem Pomp ausgerufene Wachstumspaket von 130 Milliarden Euro entpuppt sich als waghalsige Addition längst beschlossener EU-Programme.
Auch die Hoffnungen, dass Griechenland sich mit seiner neuen Regierung stabileren Zeiten nähert, haben sich nicht erfüllt. Im Gegenteil. Die neue Regierung fordert einerseits eine Streckung der Entschuldungsfristen - und damit nichts anderes als eine dritte Milliardenhilfe. Auf der anderen Seite stellt sich heraus, dass nur ein Bruchteil der in Athen beschlossenen Sparmaßnahmen auch tatsächlich durchgeführt wurde.
Wer sollte auf Basis solcher Meldungen noch Vertrauen in die Durchsetzbarkeit von Politik haben? Ein deutlicher Ausdruck der Unsicherheit ist die Stimmung der Bürger in den reichen Ländern. Jede fünfte Deutsche hält sein Vermögen für nicht mehr sicher. Und selbst die Millionäre dieser Welt scheinen vorsichtig zu werden. Laut World Wealth Report greifen sie seit 2010 massiv zur Anschaffung von "ewigen Werten“: Es gab ein Plus von 22 Prozent beim Kauf von Juwelen und Kunstgegenständen aus Edelmetall.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!