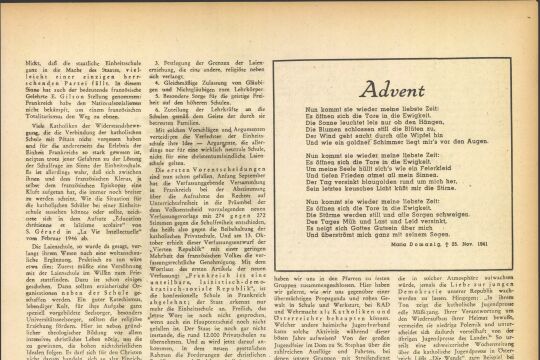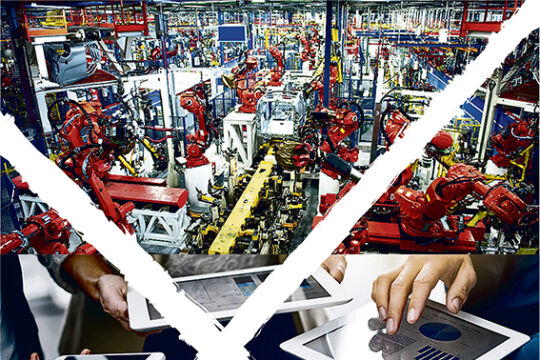Die Wertestudie 2000 attestiert den Österreichern eine zunehmend positive Einstellung zur Solidarität - aber eher in der Theorie als in der Praxis.
Im Rahmen der Gespräche über "Wirtschaft und Ethik" beim diesjährigen Forum Alpbach präsentierte Univ.-Prof. Paul Zulehner die Ergebnisse einer Studie zur Solidarität in Österreich. Die Österreicher denken zwar solidarischer als 1994, handeln aber weniger solidarisch. Offensichtlich seien die Menschen mit ihrem eigenen Vorankommen so beschäftigt, dass sie immer weniger Energie übrig haben, so Zulehners Kommentar.
Auch wünschten sich die Menschen, so Zulehner, dass der Frieden erhalten bleibe. Frieden stelle sich aber nur bei einer guten Balance zwischen Freiheit und Gerechtigkeit ein. Langfristig werde es keinen Frieden geben ohne ein hohes Maß an Gerechtigkeit. "Nicht ein militärisches Konzept, sondern Gerechtigkeit schafft Frieden." In den letzten Jahrzehnten haben die gesellschaftlichen Freiheiten durch Deregulierung stark zugenommen. Die Balance zwischen Freiheit und Gerechtigkeit könne nur gelingen, wenn Menschen bereit seien, eine entsprechende Politik zu wählen.
Der wirtschaftsnahe "Think Tank Austria Perspektiv" hat die Solidaritätsstudie finanziert, um das Potenzial an Solidaritätsbereitschaft herausfinden: "Ist die österreichische Bevölkerung bereit, eine Politik zu wählen, die nicht nur dem einzelnen dient, sondern auch der Gemeinschaft?"
Volk von "Ichlingen"?
Die Wertestudie 2000 habe gezeigt, so Zulehner, dass Österreich ein Volk von "Ichlingen" sei, von Menschen, deren Sorgen und Gedanken primär um das Ich kreisen. "Ist eine solche Bevölkerung von "Ichlingen" noch bereit und fähig, eine solidarische Politik zu unterstützen?" So lautete die Grundfrage der Studie. Hier die Ergebnisse:
Der Wunsch nach Solidarität und die Fähigkeit, solidarisch zu handeln, driften auseinander. Der Wunsch nach Solidarität ist in den letzten zehn Jahren sogar stärker geworden. "Wenn Herr und Frau Österreicher morgens in den Spiegel schauen, schaut ihnen zunächst ein solidarischer Mensch entgegen, übrigens auch ein religiöser Mensch", kommentierte Zulehner das Ergebnis.
Dabei unterscheidet die Studie die Solidarität nach ihrer Reichweite. Auf die Familie bezieht sich die Mikrosolidarität, zu der 95 Prozent der Befragten bereit sind. Auf die Gesellschaft, z. B. den Arbeitsmarkt, bezieht sich die Mesosolidarität (74 Prozent), die Makrosolidarität schließlich reicht über das eigene Land hinaus und erstreckt sich auch auf Fremde, auf Europa, die Entwicklungszusammenarbeit und die Welt als Ganze (unter 50 Prozent). Die Abnahme der Solidarität mit der Reichweite bringt Zulehner auf die Formel "Das Hemd ist uns näher als der Fremde".
Die Schere öffnet sich
Während der Wunsch nach Solidarität in allen drei Bereichen seit den Vergleichsstudien von 1994 und 1999 gestiegen ist, so ist die Bereitschaft zum solidarischen Handeln mit wenigen Ausnahmen gesunken. Eine erfreuliche Ausnahme bildet die gestiegene Bereitschaft der Österreicher, Ausländer auf dem Arbeitsmarkt gleichberechtigt zu akzeptieren.
Hingegen ist die Bereitschaft, Ausländer, Juden oder Zigeuner als Wohnnachbarn zu haben beängstigend zurückgegangen. Lehnten 1999 z. B. 15,4 Prozent ab, als Nachbarn Moslems zu haben, so sind es 2002 beachtliche 24,7 Prozent. Die Solidarität auf gewisse Distanz (am Arbeitsplatz) fällt Österreichern offensichtlich leichter, als das enge Zusammenleben mit benachteiligten Personengruppen.
Warum geht die Schere zwischen dem Wunsch nach Solidarität und dem solidarischem Handeln so sehr auseinander? Zulehner: "Wir haben den Verdacht, dass sich dazwischen Ängste schieben. Die Angst um den eigenen Wert oder die Angst, in einem knapp konzipierten Leben mit seinem Wunsch nach maßlosem Glück zu kurz zu kommen." Ängste entsolidarisieren, stellt der Theologe fest. Den Wunsch nach Solidarität hält er für ein Potenzial der Gesellschaft, das zu heben sei. Solidarisches Handeln könne durch die Familie, in den Schulen und auch über die Medien gefördert werden, wie bei der Flut-Katastrophe deutlich wurde. Schwieriger sei das allerdings bei der Alltagssolidarität.
Ängste entsolidarisieren
Die Tatsache, dass es Ängste seien, die entsolidarisieren, sei ein zweischneidiges Schwert. Einerseits könne man durch kluge Sozialpolitik Ängste mindern, indem man dem einzelnen die Sicherheit verschafft, nicht gefährdet zu sein, wenn er durch Krankheit oder einen Unfall in Bedrängnis kommt. Der Sozialstaat sollte daher völlig außer Streit stehen. Andererseits bildet es eine große Versuchung für Politiker, Ängste zu bewirtschaften, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Kurzfristig wäre das für die Parteien relativ ergiebig. Doch wer Ängste ausnützt, leistet dem Land langfristig einen Bärendienst. Damit würde die Grundlage für eine nachhaltige Solidarpolitik zerstört.
Bildung, so ergab die Studie, fördere die Makrosolidarität: Parteien, die starke Bildungsschichten integrieren, hätten daher eine hohe Ausstattung an Makrosolidarität. Die Parteien der kleinen Leute hingegen hätten Schwierigkeiten, für ihre eigene makrosolidarische Politik (Ausländerpolitik, Integrationspolitik, internationale Wirtschaftspolitik etc.) Unterstützung zu finden.
Anfällig für Totalitarismus
Ein wichtiger Aspekt sei auch die Anfälligkeit einer Person für Totalitarismus, also die Bereitschaft, ihre Daseinskompetenz an Gruppen oder Führungspersönlichkeiten zu delegieren. Nach der 68er-Revolution war der Autoritarismus stark rückläufig. Seit Mitte der neunziger Jahre nehme er jedoch wieder zu. Zulehner führt das darauf zurück, dass für den Einzelnen das Leben unübersichtlicher wird. Auch werde wegen des ramponierten Familiensystems die Daseinskompetenz der nachwachsenden Generationen geschwächt. Wenn die Schere zwischen Kompetenz und Freiheit auseinandergehe, werde die zugemutete unsolidarische Freiheit immer mehr zum Risiko.
"Wir beobachten, dass die Zahl der Menschen zunimmt, die die lästig werdende Last der Freiheit wieder los werden wollen," erklärte Zulehner. Der Autoritarismus, der entsolidarisiere, werde damit zu einem gesellschaftlichen und demokratiepolitischen Problem. "Denn wenn inmitten der Freiheitsgesellschaft immer mehr Menschen die Freiheit abwählen, ist das langfristig für den Bestand der Demokratie nicht belanglos."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!