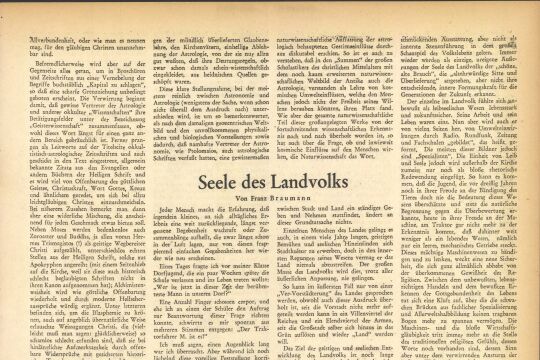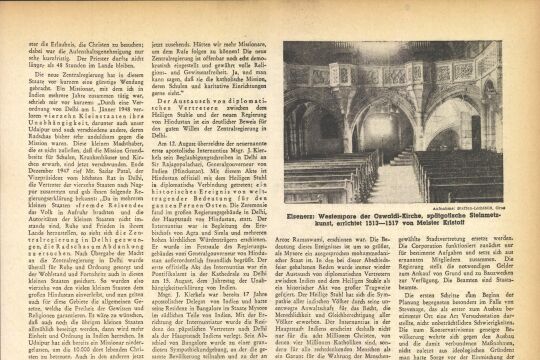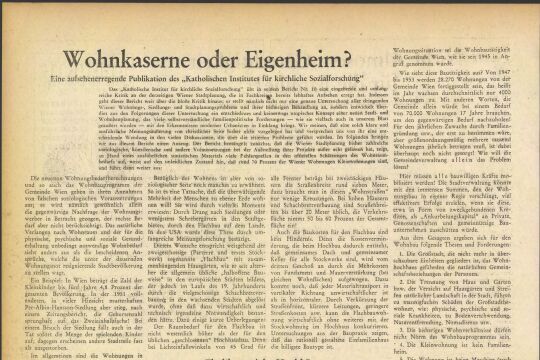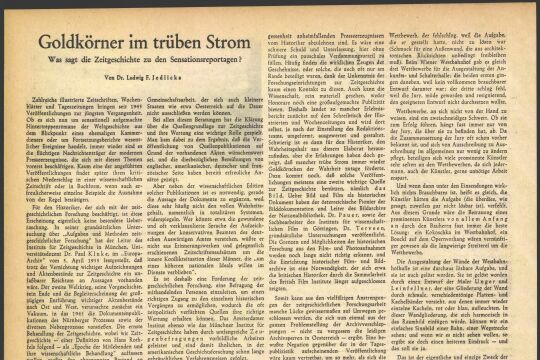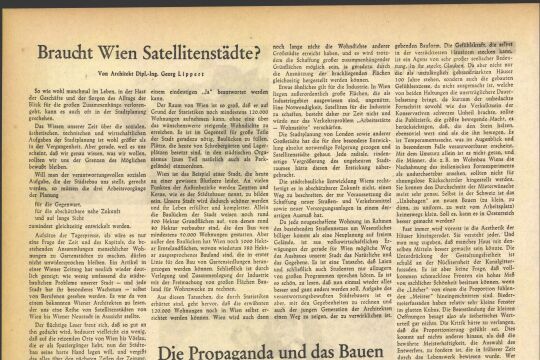Die Firma Olivetti wird ihr Lokal in der Wiener Kärntner Straße in Zukunft für Architekturausstellungen zur Verfügung stellen. Sie wird ihren Namen ins allgemeine Bewußtsein bringen, indem sie Aktionen ermöglicht, die zur Diskussion herausfordern, während österreichische Firmen im allgemeinen vorziehen, gängige Kulturware zu subventionieren.
Die erste Ausstellung ist nun tatsächlich geeignet, etwas Wind in einen stagnierenden Architekturbetrieb zu blasen. Die Arbeitsgruppe 4 (die nunmehr aus den
Architekten Friedrich Kurrent und Johannes Spalt besteht) zeigt ihren Vorschlag für ein „Wien der Zukunft”, der darin gipfelt, jenseits der Donau ein neues großstädtisches Zentrum zu errichten.
Eine Utopie?
Dort besitzt die Gemeinde sehr viel unbebauten Grund; sie soll das Hauptgewicht der neuen Bebauung dorthin verlegen. Im Anschluß daran soll eine neue Hochschulstadt errichtet werden; sie würde das Zentrum zwangsläufig mit der Jugend füllen, die ihm die Zukunft sichert. Für die Bebauung dieser „neuen Stadt” fordert die Arbeitsgruppe 4 einen internationalen Wettbewerb.
Ein Überblick der Geschichte der Wiener Stadtplanung — er nimmt die Hälfte der Ausstellung ein — weist nach, daß die Ausdehnung Wiens über die Donau der stehende Gedanke des Jahrhunderts ist, der nur in jüngster Zeit aus den Augen verloren wurde.
Zwar wächst die Einwohnerzahl Wiens nicht, wohl aber infolge der ungenügenden Ausstattung der Althäuser der Wohnungsbedarf. Für die nächsten fünf Jahre sind mindestens 45.000 neue Wohnungen vorgesehen. Die von der Arbeitsgruppe 4 veranschlagte Zahl von 200.000 Wohnungen wäre also in etwa 20 Jahren erreicht. Aber wenn erst die Masse der zwischen 1895 und 1914 gebauten Häuser die Altersgrenze erreicht, wird der Wohnungsbedarf ruckartig zunehmen.
Diese Wohnungen werden also gebaut werden. Neue Hochschulgebäude werden ebenfalls errichtet werden. Soll man also diese Vorhaben unabhängig voneinander den Amtsweg nehmen lassen und zusehen, wie sich jenseits der Donau ein riesiges Slum entwickelt, aufgeputzt mit einer oder zwei WIGs, in denen nachts die Leute überfallen werden? Oder soll man diese Notwendigkeiten zusammenfassen und etwas schaffen, was die Stadt wirklich weiterbringt?
Eine echte U-Bahn
Die Verkehrsvorschläge konzentrieren sich natürlich auf die Erschließung der „neuen Stadt”; primär ist die direkte Verbindung des neuen Zentrums mit dem Stephans- platz. Aber auch die übrigen Schnell- bahnvorschläge sollten studiert werden: Die brachliegende Vorortelinie, von den Bundesbahnen planmäßigem Verfall preisgegeben, soll in eine Schleife der Schnellbahn zur Innenstadt einbezogen werden. Ebenso sollen West- und Südbahnhof durch Radiallinien mit der Stadtmitte verbunden werden.
Man erinnert sich, mit welcher Plötzlichkeit die Gemeinde Wien in die zweite Ebene ging, ohne daß ein Gesamtplan gefaßt worden war. Die „Ustraba” ist eine halbe Lösung; bis heute existiert kein umfassendes Projekt für den Ausbau der Wiener Schnellbahn. Die Gemeinde plant nicht, sondern sie hofft, die Straßenbahntunnel würden sich im Ernstfall schon auch als Schnellbahntunnel eignen. Den Umbau überläßt sie der nächsten Generation. Der wird aber — wie am Matzleinsdorfer Platz — schneller notwendig werden als erwartet, und die Herren wenden ihre Blamage noch erleben.
Was die Straßen betrifft, fordert dieses Projekt vor allem die Schließung des Gürtels jenseits der Donau.
Diese Vorschläge stützen sich nicht auf Verkehrserhebungen, mögen also im einzelnen verbesserungsfähig sein. Die Idee als Ganzes -ist aber etwas, das wissenschaftliche Begründung ohnehin übersteigt. Überhaupt sollte man die Exaktheit der Stadtplanung als Wissenschaft nicht überschätzen. Ein komplexes Problem kann nicht durch Rechnung gelöst werden. Erst nachdem eirie Entscheidung gefallen, eine Form gefunden ist, kann sie durch Rechnung kontrolliert werden — sogar im vergleichsweise exakten Gebiet der statischen Bemessung. Die Lösung kann dann — nach der Methode „trial and error” — verbessert werden; niemals aber kann aus Rechnung, Statistik, Bestandsaufnahme oder
Eingriff in die Stadt
Zweifellos muß diese Idee mit dem großen Planungswerk konfrontiert werden, das Roland Rainer geleistet hat. Sie baut in vieler Hinsicht auf ihm auf; schon darum, weil es Stadtplanung in Wien erst wieder diskutabel gemacht hat. Hier mag es genügen, Unterschiede herauszuarbeiten.
Professor Rainer hat klassische Prinzipien des modernen Städtebaus, die er zum Teil mitgeschaffen hat,
was immer an wissenschaftlichem Apparat es sei, eine Idee destilliert werden.
Freilich kann wissenschaftliche Analyse eine Idee provozieren. Aber diese hier ist so einfach, daß elementare Geometrie ausreicht, sie zu verstehen. Ein Zweidrittelkreis ist zu einem ganzen vervollständigt worden. Jene selbstverständliche Ordnung der Stadt, die den Wiener immer wissen läßt, ob er sich in einer Radial- oder einer Parallelstraße befindet und in welcher Richtung die Stadtmitte ist, wird über der Donau weitergeführt. Der Schwerpunkt der alten City hat einen symmetrischen Gegenpol jenseits des Flusses.
Von ähnlicher Logik ist der zweite Vorschlag dieser Ausstellung. Alljährlich tauchen Projekte auf, welche die Schuldgefühle der Wiener, die sich auf die Flaktürme projizieren, zu Spekulationszwecken benützen und eine sinnlose und unwirtschaftliche „Umbauung” dieser wunderbaren Kolosse anstreben. Der Zweck ist natürlich, vor allem den Augarten für finanzkräftige Wohnungssuchende als Bauland zu erschließen. Aber Spekulation ist nicht an sich, sondern nur in schlechten Händen verwerflich; die Arbeitsgruppe 4 hat aus einem solchen Anlaß vorgeschla- gen, auf die Türme Hochhäuser aufzusetzen. Da die Türme aus militärischen Gründen paarweise in einem Dreieck um das Stadtzentrum angeordnet sind, würden diese Hochhäuser den Stephansdom einfassen, aber nicht beeinträchtigen. Die „Skyline” würde nicht willkürlich verändert, sondern erhielte wirkliche Orientierungspunkte.
Wie die Skizzen zeigen, setzen diese Hochhäuser die Formelemente der Flaktünme fort; dieselbe Form, die unten von schwerer Masse ausgefüllt ist, bildet oben den leichten Kristall. Die verschiedenen vertrauten Gestalten der Flaktürme machen auch diese Bauten zu Individuen. Auf den Bunker in der Stiftskaserne, der genau in der Achse des Helden- platzes liefet, soll kein Hochhaus, sondern ein breit auskrangender Hubschrauberlandeplatz kommen, wozu ihn die Lage im Citygebiet der Mariahilfer Straße prädestinieren würde. Im ganzen ist dieser Vorschlag von einer Einfachheit, die sich überzeugend mit der größeren Geometrie der ,jneuen Stadt” verbindet.
in den Vordergrund rückt: die Vorstellung von der Großstadt. Die Bemühung um hygienisches, menschenwürdiges Wohnen, um die Lösung der neuen Verkehrsprobleme, um die „Trennung der Funktionen” hat uns um das betrogen, was die Stadt anziehend macht: die Konzentration, die Freizügigkeit, die Anonymität der großen Menge. Eben die Dichte hat der moderne Städtebau beschränkt; aber es liegt nicht nur an der Dichte.
Ein Definitionsmerkmal der Großstadt ist, daß sie schon besteht. Bis heute hat keine neue Besiedlung, und sei sie noch so „richtig”, das Milieu hervorgebnacht, das man großstädtisch nennt. Großstadtplanung heißt nicht, etwas Neues schaffen, sondern: etwas Vorhandenes durch einen starken Eingriff umdeuten. Das ist es, was Haussmann in Paris, Wren in London, barocke Planungen in Wien und Salzburg getan haben. Das ist es, was den Wiener Stadtregulierungsplänen der Jahrhundertwende so großes Interesse .sichert. Nicht nur, daß eine große Stadtidee von elementarer Geometrie gefaßt wird, sie wird auf die bekannte und geliebte alte Stadt projiziert, und das ist das Erregende.
Eine „Bandstadt” im Süden Wiens würde auf die alte Stadt keinen Einfluß nehmen. Aber die Überhöhung dieser Südachse zu einer zentralen Stadtidee hat die geometrische Vorstellung vom alten Stadtkörper vollends zerstört. Nur so sind die drei lustlosen „Zentren”, die jetzt jenseits der Donau geplant sind, zu erklären — Kagran, jener klägliche Wettbewerb, hat nicht einmal einen Schnellbahnanschluß. Sie seien „kleinstädtisch wirksam”, schreibt die Arbeitsgruppe 4, aber das ist noch weit übertrieben.
Die „neue Stadt” jenseits der Donau schafft jedoch nicht nur neues und wirklich anziehendes Bauland; sie gibt dem alten Zentrum, obwohl sie es entlastet, neues Gewicht. Sie stellt — wie das Flakturmprojekt — überraschende Beziehungen im Bestehenden her. Sie deutet die vorhandene Stadt um, gibt ihr eine neue Gestalt, die — einmal vorgestellt — zwingend ist.
Im historischen Teil der Ausstellung sind zwei bedeutende städtebauliche Einzelprobleme Wiens erwähnt, für die Skizzen oder eingehende Planungen von Wagner, Loos, Hoffmann, Welzenbacher bestanden. Es sind dies der Donaukanal und der Karlsplatz. Für den Karlsplatz hat Otto Wagner zehn Jahre lang gearbeitet, ohne daß etwas ausgeführt worden wäre, wenn man von den Stadtbahnhaltestellen absieht. Er stellt noch immer eine ungenützte Möglichkeit dar; auf das unglückliche Museum soll es nicht ankommen.
Georg Lippert als Wagner-N achfolger?
Am Donaukanal ist die Chance verpaßt. Für seine „Verbauung” ist im wesentlichen der Wiener Architekt Professor Diplomingenieur Georg Lippert verantwortlich. Voraussichtlich wird er auch den Neubau an der Stelle des Dianabads errichten. Nun wird gerüchtweise bekannt, daß dieser Architekt, dessen letzter Bau am Stephansplatz fertiggebracht hat, daß die anderen geradezu sympathisch wirken, an Planungen für den Karlsplatz arbeitet.
Noch 1957 — um die Zeit der Erbauung des Opemringhofs — hat Architekt Lippert sich in einer Zuschrift an „Die Furche” über Le Corbusier mokiert. Heute, da er seine Klischees bereits aus dessen Generation bezieht, würde er das wohl nicht mehr tun. Man könnte eine Entwicklung vermuten, wäre inzwischen die Qualität gestiegen. Aber im Gegenteil; es wird die Zeit kommen, da man den Opernringhof den jüngsten Vorhangfassaden noch vorziehen wird. Hingegen hat sich die öffentliche Meinung entwickelt. Beim Donaukanal ist es noch gut gegangen. Beim Karlsplatz wind es nicht mehr gut gehen. Nach der derzeitigen Lage der Dinge ist zu vermuten, daß sich eine „Verbaung” des Karlsplatzes durch einen Architekten, der seine Bauherren anerkanntermaßen nicht durch künstlerische, sondern durch kaufmännische Qualitäten zu überzeugen pflegt, zu einem internationalen Fall auswachsen wird.
Selbst beim Karlsplatz ist es für einen internationalen Wettbewerb nicht zu spät. Überhaupt ist das Mittel des Wettbewerbs weniger dazu geeignet, für fertige Bauabsichtein die Fassaden zu liefern, als dazu, die Planungsideen selbst zu sondieren.
Daß eine Regierung, eine Gemeindevertretung, ja selbst eine Partei oder eine Person einer Stadt ihren Stempel aufdrücken will, ist durchaus nicht verwerflich. Freilich, wer ein Turmplagiat und ein paar talentlose Späßchen als weltstädtisches Ereignis ausgibt, wer mit Be- serlparks überzeugen will, macht sich lächerlich. Wer aber ein großes Werk der Zukunft in Angriff nimmt, dessen Name wird — wie der Luegers — Schilder, Schiffe und Denkmäler überdauern.
auf die Stadt Wien — spät genug — angewendet: Dezentralisierung einer überlasteten Altstadt, Schaffung sinnvoller neuer Bebauungsformen. Diese Prinzipien konkretisierten sich zu dem Vorschlag, die Stadt in ihr südliches Umland auszudehnen, in die Idee einer „Bandstadt Wien”.
Kann ein Band eine Stadt sein? Der moderne Städtebau hat etwas vernachlässigt, was jetzt — eben im Bewußtsein des Mangels — wieder