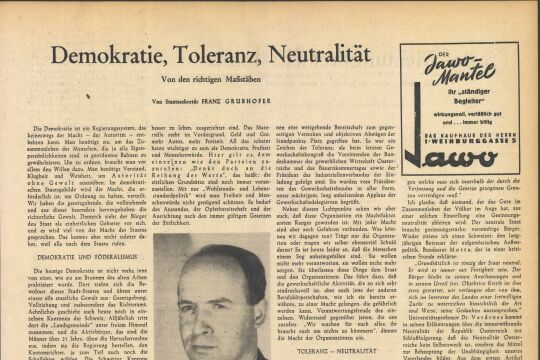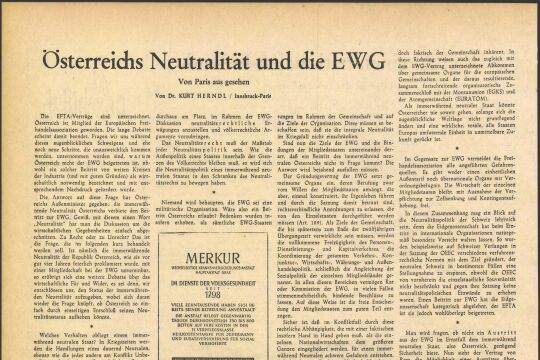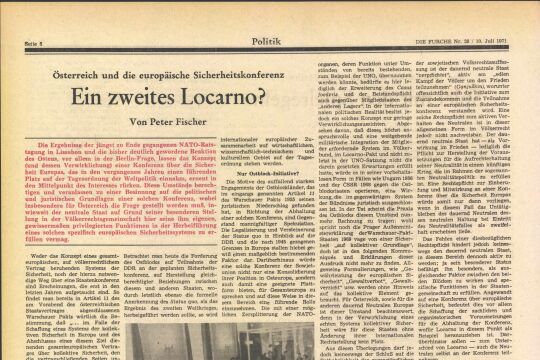Ein EU-Mitgliedsstaat der Kandidatenländer an anderen Kriterien als jenen des EU-Rechts misst, macht sich des Rechtsbruchs schuldig.
Zu den wirklich heißen Themen der Innenpolitik gehört die Forderung nach einem Volksentscheid über die Erweiterung der Europäischen Union. Sie und die themenverwandte Forderung, Österreich solle wegen des Atomkraftwerks Temelín gegen eine Aufnahme Tschechiens ein Veto einlegen, sind der einzige wirkliche Sprengstoff für die gegenwärtige ÖVP-FPÖ-Koalition. Alle Spar- und Restrukturierungsmaßnahmen, wessen Klientel sie im Einzelnen gerade treffen mögen, können unter dem höheren, von einer grundsätzlich breiten Zustimmung in der Bevölkerung getragenen Ziel der Budgetkonsolidierung durchgezogen werden. Gemeinsam kann Schwarz-Blau sogar den Sozialpartnern, wo sich diese als Nebenregierung verstehen, trotzen; aber an der Europapolitik könnten sich die Geister scheiden.
Rechtlich ist die Sache klar. Mit seinem Beitritt zur Europäischen Union ist Österreich Teil einer Staatenvereinigung geworden, die schon seit ihren Anfängen die Entschlossenheit, durch ihren "Zusammenschluss Friede und Freiheit zu wahren und zu festigen", bekundet, und dies "mit der Aufforderung an die anderen Völker Europas, die sich zu dem gleich hohen Ziel bekennen," verbunden hat, "sich diesen Bestrebungen anzuschließen." (So die Präambel des EG-Vertrags aus 1957.) Demgemäß heißt es in Artikel 49 des Maastrichter Vertrags von 1992, dass "jeder europäische Staat [...] beantragen [kann], Mitglied der Union zu werden". Einzige ausdrückliche Voraussetzung ist, dass es sich um einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat mit Achtung der Menschenrechte handelt; doch muss der betreffende Staat selbstverständlich auch fähig und bereit sein, den gesamten Rechtsbestand der Union (den "acquis communautaire") zu übernehmen und innerstaatlich zu vollziehen. Hievon gibt es keine Ausnahme, doch können im Beitrittsvertrag Übergangsfristen vereinbart werden, die übrigens (wie das gerade für Deutschland und Österreich "heiße Eisen" der Arbeitnehmerfreizügigkeit zeigt) auch zugunsten der Altmitglieder wirken können.
In das Zustandekommen eines Beitrittsvertrages ist ein Mitgliedstaat mehrfach eingebunden. Dies gilt einmal für das "decision shaping", also darüber, wie dieser Vertrag inhaltlich beschaffen sein soll. In dieser Phase der von der Kommission mit dem/n Beitrittswerber/n geführten Verhandlungen gibt es laufende Konsultationen mit den einzelnen Mitgliedstaaten, deren Experten und Interessenvertretern. Erst mit einer hier zustandegekommenen inhaltlichen Einigung sind die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen. Beim "decision making" kommt ein Mitgliedstaat gleich zweimal zum Zug. Zuerst im Rat, wo für die Billigung des Beitrittsvertrags Einstimmigkeit gefordert ist; danach im Ratifikationsverfahren, weil hier die Ratifikation durch alle Vertragsstaaten (die alten wie den/die neuen) gefordert ist.
Aus den Erfordernissen der Einstimmigkeit im Rat und der Ratifikation durch alle Mitgliedstaaten wird gelegentlich die doppelte Möglichkeit eines Vetos gegen die Aufnahme eines bestimmten Staates abgeleitet. Dieses Argument übersieht jedoch, dass ein Staat, der im Beitrittsverfahren seine Stimme abgibt und danach für sich den Ratifikationsprozess einleitet, verpflichtet ist, bei der Entscheidung über die Aufnahme eines Staates allein jene Kriterien zugrundezulegen, die der Unionsvertrag vorgibt oder die sich aus dem Wesen der Union ergeben. Dies ist ein für die Aufnahme in die UNO vom Internationalen Gerichtshof schon bald nach deren Gründung näher ausgeführter Grundsatz, der von seiner ratio her für alle internationalen und supranationalen Organisationen und damit auch für die EU gilt. Das jedem Mitgliedstaat im EU-Vertrag durch das Einstimmigkeits- beziehungsweise All-Vertragsstaaten-Prinzip eingeräumte Recht, über die Aufnahme eines Staates mitzuentscheiden, ist in seiner Ausübung durch die Vorgaben ebendieses Vertrags gebunden und darf zu keinem anderen als dem im Vertrag genannten Zweck ausgeübt werden. Ein Mitgliedstaat, der seine Zustimmung an andere Vorgaben knüpft oder mit seiner Ablehnung andere Zwecke verfolgt, macht sich des Rechtsmissbrauchs und damit einer Verletzung von Ziel und Zweck des Vertrags schuldig.
Keine Stolpersteine
Überdies ist jeder Mitgliedstaat aufgrund des im EU- beziehungsweise EG-Recht mehrfach verankerten Loyalitätsgrundsatzes gehalten, "alle Maßnahmen [zu unterlassen], welche die Verwirklichung der Ziele [der EU beziehungsweise EG] gefährden könnten." Dazu gehört auch, dass er unterlässt, sich selbst auf dem Weg zur Zustimmung rechtliche Stolpersteine zu legen, die von seiner Verfassung für diese Akte an sich gar nicht vorgesehen sind. Da jede Form von Volksentscheid erfahrungsgemäß ein zusätzliches und unkontrollierbares Risiko in sich schließt, würde ein innerösterreichischer Beschluss, die Zustimmung zur bevorstehende EU-Erweiterung ganz allgemein oder hinsichtlich bestimmter Staaten vom positiven Ausgang einer Volksabstimmung abhängig zu machen, gegen seine Loyalitätspflichten gegenüber den Zielen der Union verstoßen.
Die FPÖ, die im Koalitionsabkommen ein grundsätzliches Bekenntnis zur EU-Erweiterung abgegeben hat, täte gut daran, dasselbe nicht nachträglich durch das Aufstellen damit unvereinbarer inhaltlicher oder verfahrensmäßiger Bedingungen zu unterlaufen. Da von vornherein allen klar sein musste, dass die EU-Erweiterung - was die Reformstaaten Mittel- und Osteuropas anlangt - gerade in wirtschaftlicher Hinsicht auch einen Akt solidarischer Hilfe darstellt, wären Fragen an das Volk wie "Sind Sie dafür, dass sich im Falle der EU-Erweiterung der Beitrag Österreichs als Nettozahler erhöht?" der blanke Hohn. Die ÖVP, auf deren politischer Habenseite die positive Haltung zur europäischen Integration den vielleicht wichtigsten Posten darstellt, könnte sich einer derartig populistischen Vorgangsweise unmöglich anschließen. Stellt doch die EU-Erweiterung das nach dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich wichtigste politische Projekt für ein friedliches Europa dar, durch das die Eingliederung der mit dem Zusammenbruch des Ostblocks entstandenen Reformländer in die Familie aller freien europäischen Staaten unumkehrbar gemacht würde.
Mehr Missbrauch?
Gegenüber diesen rechtlichen, politischen und moralischen Argumenten wird gelegentlich mit (fast) entwaffnender Naivität die Frage gestellt, was man denn in einem Staat und einer EU, die auf der Grundlage der Demokratie stehen, gegen einen Volksentscheid haben könnte. Diese Frage ignoriert völlig den in allen wichtigen Werken der Allgemeinen Staatslehre und der Politikwissenschaft nachzulesenden Unterschied von direkter und indirekter Demokratie sowie die aus der politischen Erfahrung gewonnenen Einsichten, dass nicht jede der beiden Varianten für jede Art der Entscheidung taugt. Dabei wird als Vorzug der indirekten oder mittelbaren Demokratie, bei der ein Parlament von auf das Gemeinwohl verpflichteter, aber sonst mit einem freien Mandat ausgestatteter und daher nur ihrem Gewissen verantwortlicher Abgeordneten im Mittelpunkt steht, darin erblickt, dass diese Einrichtung ein gerütteltes Maß an Sachverstand mit einem (vergleichsweise) hohen Maß an Leidenschaftslosigkeit verbindet. Voraussetzungen, die für die Behandlung gerade komplexer Probleme unabdingbar sind. Umgekehrt leiht sich die plebiszitäre Demokratie leichter dem Missbrauch seitens der Populisten und Demagogen. Diese sind umso gefährlicher, je mehr die Massenmedien ihren Schlagworten Raum geben und gleichzeitig verabsäumen, durch eine niveauvolle Information dem Bürger die Fällung eines eigenen, wohlabgewogenen Urteils zu ermöglichen.
Freilich, das B-VG lässt rechtlich die Möglichkeit einer Volksabstimmung über die EU-Erweiterung offen. Die faktische Möglichkeit einer sachlichen, leidenschaftslosen, nicht von populistischen, vielleicht demagogischen Argumenten beherrschten breiten Debatte hingegen erscheint nach den Erfahrungen der letzten ein, zwei Jahrzehnte - auch mit einem Teil unserer Medien - verschlossen. Der politischen Möglichkeit, sich durch eine solche Volksabstimmung der Verantwortung für eine klare Entscheidung in der EU-Erweiterungsfrage zu entziehen, muss, als einer Versuchung, widerstanden werden. Der dafür zu zahlende Preis - ein schwerer Rückschlag für das europäische Einigungswerk - wäre viel zu hoch, als dass er auch nur in Kauf genommen werden dürfte.
Der Autor ist Professor der Institute für Völkerrecht und Internationale Beziehungen und für Europarecht an der Johannes Kepler Universität Linz und Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.