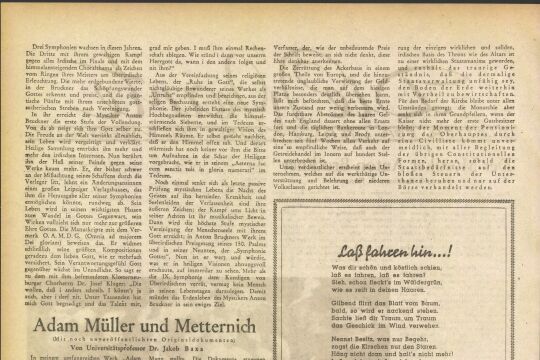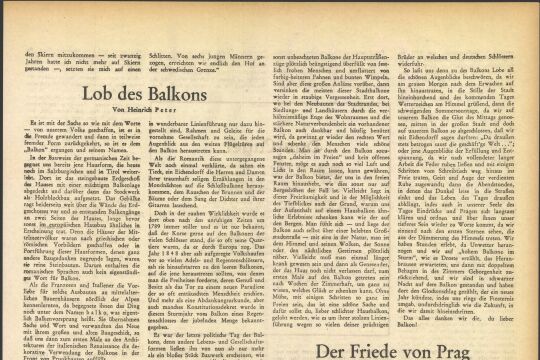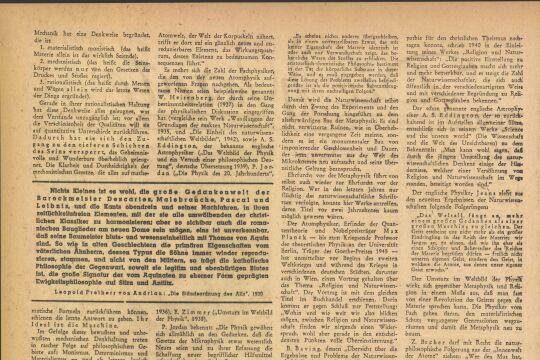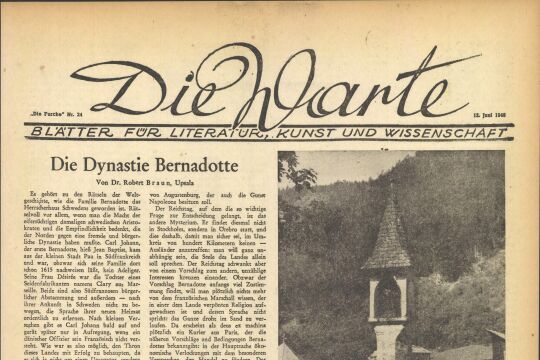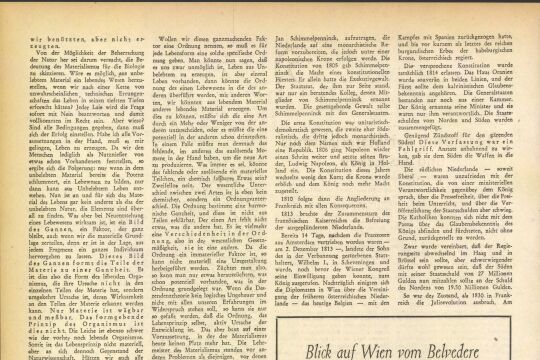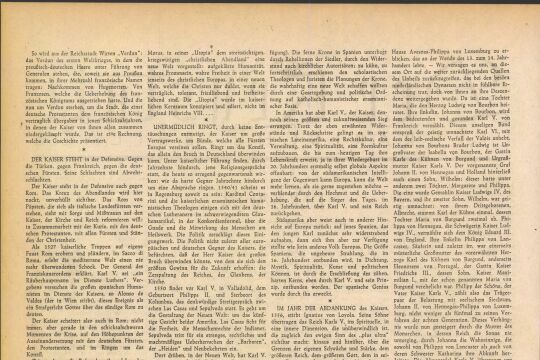Oberst Josef Maria v. R a d o w i t z, der im Jänner 1842 zu Besprechungen über Fragen der gemeinsamen österreichisch-preußischen Bundespolitik nach Wien geschickt worden war, hatte zu seinen diplomatischen Aufträgen auch noch einen sehr persönlichen Wunsch König Friedrich Wilhelms IV. auf den Weg mitbekommen. Angeregt durch in der deutschen Presse lebhaft besprochene Nachrichten von der Absicht der Erben Goethes, das Haus am Frauenplan zu Weimar und die reichen wissenschaftlichen und künstlerischen Sammlungen des Dichters im Versteigerungswege veräußern zu wollen, und von einem Kreis begeisterter Goethe-Verehrer, voran Friedrich Rückert, auf den drohenden Verlust hingewiesen, hatte der Romantiker auf dem preußischen Königsthron den Plan gefaßt, die deutschen Bundesfürsten für eine gemeinsame Erwerbung des gesamten Nachlasses Goethes und seine Widmung als „Nationaleigentum“ zu gewinnen. Diesen Gedanken seines königlichen Herrn zu verwirklichen, legte Radowitz dem Staatskanzler Fürsten Metternich, an den er die Sache herantrug, nahe, der Stellung eines gemeinsamen österreichisch-preußischen Antrages im Frankfurter Bundestag zuzustimmen. Metternich versicherte nun zwar Herrn von Radowitz seiner Bereitwilligkeit, aber die in Aussicht gestellte endgültige Antwort ließ auf sich warten — auch als Radowitz in einem Brief vom 11. März 1842 den Fürsten um die baldige Mitteilung seiner Ansichten über die „dem Bunde gemeinschaftlich zu machende Eröffnung“ bat, blieb Metternich stumm.
Diese Zurückhaltung des Staatskanzlers befremdete in Berlin um so mehr, als Oesterreich noch 1825 Goethe in Würdigung des „ausgezeichneten Werthes“ seiner „literarischen Producte“ das von ihm nachgesuchte Druckprivilegium „für den ganzen Umfang der österreichischen Monarchie“ gewährt und Metternich selbst den „Herrn Staatsminister von Goethe“ von dieser Bewilligung als einer Maßregel in Kenntnis gesetzt hatte, „die seinem eigenen Anerkenntnisse der Verdienste, die Goethe sich um die deutsche Literatur erworben, auf eine sehr willkommene Weise entspreche“. Radowitz gegenüber hatte der Fürst allerdings bereits von der Notwendigkeit gesprochen, „zunächst die Ansichten der kaiserlichen Familie, bei welcher vielleicht abweichende Meinungen bestehen könnten, über die Angelegenheit einholen“ zu müssen. Nun, Erzherzog Ludwig,
das Haupt der damals für den regierungsunfähigen Kaiser Ferdinand I. die Geschäfte führenden Staatskonferenz, zeigte sich über das Ansinnen auch wirklich sehr wenig erfreut, schon wegen der damit verbundenen „außer allem Interesse Oesterreichs liegenden, nicht unbedeutenden Auslagen“. Aber auch Metternich selbst, der Radowitz gegenüber mit seiner wahren Meinung nicht herausgekommen war, fand diesen „Goetheischen Ankauf“ „absurd“, wie er dem ihm sehr ergebenen Hofrat der Staatskanzlei, Sebastian Josef Freiherrn v. Gervay, anvertraute — leider gebe es jedoch „Lagen, in denen man auch, ohne sie zu lieben, Medizinen verschlucken müsse“. Diese Einstellung des Staatskanzlers war zuvorderst auf die Schwierigkeiten der reichlich spießigen Bundespolitik und die prekäre Finanzlage zurückzuführen, die dem Fürsten die ganze Angelegenheit zu einer unwillkommenen zusätzlichen Belastung machten.
Wenn freilich Metternich gehofft hatte, doch noch irgendwie um das ihm einigermaßen unbequeme „Geschäft“ herumzukommen, zu dessen Scheitern er seinerseits, wie er Gervay offenherzig bekannte, sein möglichstes beitragen wollte, so hatte er die Hartnäckigkeit des preußischen Königs stark unterschätzt. Denn als die „im allervertraulichsten Wege und selbst mit Vermeidung jedes Anscheins officieller Verhandlung“ durch Radowitz eingeleitete Fühlungnahme ohne Ergebnis blieb, beschritt Berlin nunmehr den amtlichen Weg und beauftragte seinen Gesandten in Wien, Freiherrn von Canitz, dem Staatskanzler die Anregung des Königs vorzutragen und, falls dem Fürsten die Einbringung eines gemeinsamen Antrages in Frankfurt nicht genehm wäre, anzufragen, „ob Seine königliche Majestät nicht wenigstens auf die Zustimmung des kaiserlichen österreichischen Hofes rechnen dürfe, wenn Allerhöchstdieseiben sich veranlaßt finden sollten, Ihrerseits allein“ an den Bundestag heranzutreten. Damit war Metternich der weitere Weg vorgezeichnet: da zu erwarten stand, daß „die Realisierung dieses Projektes im deutschen Volke großen Anklang finden werde“, erschien es dem Fürsten unmöglich, sich des „Einflusses auf die Sache zu begeben“, im Gegenteil, Oesterreich mußte sich seiner Meinung nach „beeilen, diese Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen“. Jetzt, am 28. Mai 1842, übersandte der Staatskanzler dem Grafen Trauttmansdorff, dem österreichischen Gesandten in Berlin, einen Entwurf der von Oesterreich gemeinsam mit Preußen im Bunde abzugebenden Erklärung, über deren Wortlaut er mit dem preußischen Kabinettsminister Bülow Rücksprache pflegen sollte. Der König, der zu seiner großen Freude mit diesem Schritte die schwerste Hürde genommen glaubte, war bis auf eine sachlich belanglose Aenderung, der man in Wien keinerlei Schwierigkeiten bereitete, mit der Fassung des Antrages einverstanden. Um aber seine Annahme im Bundestage sicherzustellen, wollte er die bedeutenderen Bundesstaaten noch vor seiner Einbringung von der gemeinsamen Absicht Oesterreichs und Preußens in Kenntnis setzen und „ihre Zustimmung in Anspruch nehmen“, ein Vorgang, dem auch Oesterreich sich anschloß.
Die Aufnahme, die der österreichischpreußische Vorschlag bei den Regierungen der befragten Bundesstaaten fand, war wenig erfreulich. Einzig der großherzogliche Hof in Weimar begrüßte das Vorgehen der beiden deutschen Großmächte „in wahrhaft enthusiastischer Weise“, den übrigen Ländern kam die Sache vielfach wenig gelegen, und einzelne zeigten ihre geringe Freude über das zu erwartende materielle Opfer, so bescheiden es auch sein mochte, wenn die bevoranschlagten 50.000 bis 60.000 Taler auf die 38 Regierungen aufgeteilt wurden, recht unmißverständlich. Dänemark, Hannover, die Niederlande und Sachsen wiesen wenigstens, ohne Einwendungen zu machen oder einer Mißstimmung Ausdruck zu geben, ihre Gesandten an, dem österreichisch-preußischen Antrag beizutreten. Auch Württemberg machte, keine Schwierigkeiten, wenngleich der König erklären ließ, er werde — offenbar, um jeder Auseinandersetzung mit den Landständen auszuweichen — „seinen Antheil aus Privatmitteln zuschießen“. Aber schon der Karlsruher Hof konnte sich nicht enthalten, seiner Zustimmungserklärung anzufügen, daß er „keine besondere Sympathie für dieses Projekt empfinde“, und in München hoffte man, der Preis werde „ein nicht allzu bedeutender“ sein und dem Bund aus der Beaufsichtigung und Erhaltung der Erwerbung kein „fortlaufender, aus Bundescassen zu bestreitender Aufwand“ erwachsen — obwohl König Ludwig die Erhaltung des Goetheschen Nachlasses als seinen alten Wunsch bezeichnete. Hessen-Darmstadt wurde noch deutlicher: man „vermuthe, daß die Ausführung dieser Idee den Zweck habe, etwas für die Familie Goethe zu thun, keineswegs aber der Plan damit verbunden wäre, etwa unter der Obhut des Bundes ein deutsches Museum zu errichten“, denn „dem Bunde bleibe noch soviel anderes Wichtigeres zu thun, daß man vorerst an die Ausführung solcher Pläne nicht denken könne“. Eine glatte Ablehnung aber erfuhren Oesterreich-Preußen in Kurhessen. Die Kasseler Regierung hatte mit den Landständen bereits so viele Schwierigkeiten, um die Bewilligung selbst der verfassungsmäßigen Pflichtbeiträge zu den Bundesausgaben zu erlangen, daß sie sich scheute, mit einer Anforderung hervorzutreten, die zurückzuweisen man den Ständen das Recht nicht abstreiten konnte. Minister v. Steuber leugnete aber auch gar nicht, daß „die Herren Stände im allgemeinen nicht sehr empfänglich seien für den poetischen Ruhm Deutschlands“. Man hatte auch in Kassel das ganz richtige Gefühl, „das österreichische Cabinet nehme sich der Sache weniger aus eigenem Antrieb an als vielmehr aus höflicher Complaisance für den poetisierenden und teutonisierenden König von Preußen“. Und erst als der preußische Gesandte vorstellte, daß es seines Herrn „ganz persönlicher Wunsch wäre, daß die Stimme Kurhessens nicht als die einzige disharmonierende erscheinen möchte und daß Seine Majestät es als etwas für Höchstdieselbe Verbindliches ansehen würde“, wenn Hessen nachgeben wollte, gingen entsprechende Weisungen nach Frankfurt ab.
Inzwischen hatte auch Metternich, sich der politischen Notwendigkeit fügend, unter Hinweis auf die Unmöglichkeit, Preußen in dieser in der deutschen Oeffentlichkeit so starken Widerhall findenden Sache die Führung zu überlassen, die kaiserliche Genehmigung erwirkt — sie trägt das Datum vom 24. August 1842 —, „die Erledigung des Gegenstandes in der proponirten bundesgeschäftsgemäßen Weise einzuleiten“. Und nun hätte eigentlich die Verwirklichung des vom Preußenkönig so lebhaft vorangetriebenen Planes ohne weiteren Aufschub vor sich gehen können, um so mehr, als die wegen weiterer finanzieller Belastung besorgten Bundesglieder durch die Erklärung der großherzoglich-weimarischen Regierung, die Betreuung der Sammlungen und des Hauses auf sich nehmen zu wollen, beunruhigt werden konnten.
Aber nun stieß das Unternehmen — wem eigentlich, sieht man von Weimar und Berlin ab, zum Mißvergnügen? — erst auf sein entscheidendes Hindernis: auf den kaum zu erwarten gewesenen Widerstand der Goetheschen Erben, deren „zerfahrene Gemütsverfassung“ sie zunächst untereinander zu keiner Einigung kommen, dann aber in eine hoffnungslose Sackgasse verrennen ließ, wobei materielle und (allerdings in geringerem Maße) ideelle Antriebe in kaum zu lösender Verschlingung ihre Rolle spielten. Ottilie v. Goethe war von Anfang an gegen den Hausverkauf und wollte nur die Sammlungen veräußern, Walther war anfänglich dafür, alles loszuschlagen, und brachte dann doch durch seinen unverständlichen Eigensinn jede Verhandlung zum Scheitern. Sein jüngerer Bruder Wolfgang war der Spielball zwiespältigster Gefühle und ordnete sich schließlich, wenn auch widerstrebend, ganz dem Willen Walthers unter. Die noch nicht volljährige Alma aber, deren Vormünder die Absicht des Deutschen Bundes kräftigst zu fördern bemüht waren, tat unter dem Einfluß der Mutter das mögliche, um eine Einigung zu hintertreiben; sie hat übrigens — gestorben am 29. September 1844 — den Ausgang der Angelegenheit nicht mehr erlebt.
Der vom Bundestag mit der Führung der Verhandlungen betraute Ausschuß war nicht abgeneigt gewesen, über sein erstes, auf 60.000 Taler lautendes Anbot hinauszugehen, als man bei den Goetheschen Erben das Bestreben erkannte, einen höheren Preis zu erzielen. Aber 90.000 bis 100.000 Taler schien den Vertretern aller Länder eine übermäßige Forderung, und der Vorschlag, den die Brüder im Oktober 1843 machten, die Sammlungen ohne das Haus um 41.000 Taler zu kaufen, unannehmbar. Jetzt befahl auch Friedrich Wilhelm IV. den Abbruch der Verhandlungen: „Die deutsche Nation mochte nun durch das verfassungsmäßige Organ .. . erfahren, daß die Absicht des Bundes lediglich um deswillen vereitelt wurde, weil Goethes Enkel die Ehre, welche das gesamte Deutschland ihrem Großvater zu erweisen bereit war, unter dem nichtigen Vorwande, durch Rücksichten der Pietät dazu bestimmt zu werden, zurückwiesen“. Ein die Angelegenheit beendigender Bundesbeschluß wurde allerdings nicht gefaßt. Und zuletzt hat Walther v. Goethe, der seinen jüngeren Bruder Wolfgang um zwei Jahre überlebte, die Schuld, die er durch seine beharrliche Ablehnung des schönen Planes auf sich geladen hatte, wieder gutgemacht: durch seine letztwillige Verfügung gingen das Haus am Frauenplan und die Sammlungen Goethes nach seinem 1885 erfolgten Tode in den Besitz des weimarischen Staates über, dessen Regierung am 3. Juni 1886 das „Goethe- Nationalmuseum“ der Oeffentlichkeit übergeben konnte. j