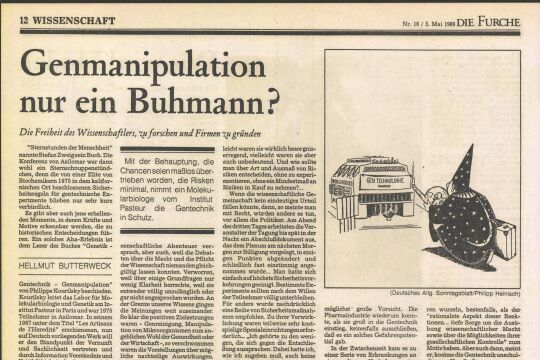Nicht nur der Missbrauch des Wissens, auch das Wissen selbst kann gefährlich sein. Philosophische Annäherung an ein uraltes Phänomen.
Die Rede von gefährlichem Wissen geht uns seit einiger Zeit leicht von den Lippen. In der Tat gibt es Beispiele zuhauf. Versicherungen etwa verfügen über Daten zu den finanziellen Verhältnissen oder zu den Krankheitsgeschichten ihrer Kunden. Die weltweit beliebten sozialen Netze speichern persönliche Daten ihrer Benutzer und versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Staatliche Organe, insbesondere Geheimdienste (selbst die fremder Staaten, wie wir nunmehr wissen), spähen unsere Telefongespräche und andere elektronische Kommunikationsinhalte aus. Nicht erst ungeplante Datenlecks, sondern schon offiziöse Verfahren schaffen Unsicherheiten, statt die innere und äußere Sicherheit zu gewährleisten. Hinzu kommt eine grundlegend andere Art gefährlichen Wissens: Teils auf traditionelle, teils auf neuartige Weise kennt man Erbkrankheiten, unter denen man selber oder das eigene Kind womöglich irgendwann leiden wird.
Dieser Liste brisanter Beispiele liegen zwei stillschweigende Annahmen zugrunde: jene, dass gefährliches Wissen ziemlich neu ist, und jene, dass die Gefahren vornehmlich erst bei Missbrauch von Wissen drohen. Dagegen behaupte ich, dass das Phänomen gefährlichen Wissens weit älter ist als wenige Jahrzehnte - und dass nicht erst der Missbrauch, sondern das Wissen selber gefährlich sein kann.
Nutzenfreies Wissen als Kontrapunkt
Eine der berühmtesten Schriften der gesamten Philosophie, Aristoteles’ Metaphysik, beginnt mit einem erfahrungsgesättigten Satz anthropologischer Relevanz: "Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen.“ Von dieser Wissbegier erklärt Aristoteles, dass der Mensch sie frei von allen Bedürfnissen und Nützlichkeiten um ihrer selbst willen suchen kann. Rein für sich genommen ist ein nutzenfreies Wissen ungefährlich. Trotzdem birgt es - nicht in Form von Missbrauch, wohl aber als Kontrast und Kontrapunkt - dreierlei Gefahren:
Erstens hat die Erkenntnis von Ursachen einen aufklärerischen Charakter. Im überlieferten Mythos ist etwa der Regenbogen die Erscheinung einer Göttin namens Iris. Im Gegensatz dazu erklärt der Vorsokratiker Xenophanes: "Und was sie Iris nennen, auch das ist nur eine Wolke, purpurn und hellrot und gelbgrün anzuschauen.“ Hier tritt ein zweifaches Gefahrenpotential von veritablem Wissen zutage: die Aufhebung des Mythos durch eine "rationale“, kognitive Erklärung der Natur; und die Kritik der überlieferten Religion. Die Gottheit gilt nicht länger als eine sichtbare Naturerscheinung, sondern ist vielmehr ihr gegenüber das ganz Andere.
Zweitens besteht die Höchstform des Wissens - im Gegensatz zu dem in der Menschengeschichte meist vorherrschenden utilitären Denken - gerade in jenem nutzenfreien Wissen, das um seiner selbst willen gesucht wird und damit den Rang eines Selbstzwecks erhält, was ihm eine Würde in sich verleiht. Darin liegt eine grundlegende Kritik an Technisierung und Ökonomisierung.
Die dritte Gefahr nutzenfreien Wissens lernen wir im Umkehrschluss im christlichen Denken kennen. Der Kirchenlehrer Augustinus gibt der Forschung eine Qualifikation, die ihr einen neuen Rang verleihen soll, sie in Wahrheit aber mit einer Zusatzaufgabe belastet. Diese besteht in einem "religiose quaerere“, einem "gottesfürchtigen Forschen“. Das bloße Wissenwollen, die curiositas, wird als eine Begierde (concupiscentia) verstanden, die sich zu einem Laster auszuwachsen droht.
Missbrauch der Klugheit
Nicht erst seit Aristoteles weiß man, dass es für ein glücklich-gelungenes Leben ein andersartiges Wissen braucht, eine sittliche Urteilskraft: die Klugheit. Charaktertugenden wie Besonnenheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit sind zwar für die Grundausrichtung des Lebens auf seine Eudaimonia, auf das eu (Glück) genannte Gelingen zuständig. Die intellektuelle Tugend der Klugheit sorgt dagegen unter Voraussetzung dieser Grundausrichtung für deren situationsgemäße Konkretisierung. Auch hier droht eine Gefahr, die nicht erst bei einem konkreten, sondern einem generellen Missbrauch beginnt. Die moralische Urteilskraft kann nämlich zu einer "machiavellistischen Klugheit“ verkommen, zur sprichwörtlichen Klugheit der Schlange bzw. Schlauheit des Fuchses, die, wo es ihr als tunlich erscheint, zu Lug und Betrug bereit ist.
Eine dritte Grundform des Wissens besteht in einer Kunstfertigkeit, die nach dem Muster von Handwerkern und Ingenieuren Häuser, Brücken und Straßen, Autos, Smartphones und Computertomographen, aber auch Kanonen, Sprengstoff und Atombomben zu bauen vermag. Ohne Zweifel setzt der Siegeszug der modernen Technik unter humanitären Vorzeichen an. Nach einem Propheten der modernen Naturforschung, René Descartes, sollen die Menschen sogar zu "maîtres et possesseurs de la nature“, zu Herren und Besitzern der Natur, werden. Spätere Kritiker verstehen darunter eine Aufforderung zur Ausbeutung der Natur. "Maître“ meint hier aber nicht den Herrn, der die Natur zu seinem Knecht macht, sondern den "Meister“, der sich aus souveräner Kenntnis die Naturkräfte zunutze macht. Durch die Erfindung "unendlich vieler mechanischer Künste“ soll man "mühelos die Früchte der Erde und all ihre Annehmlichkeiten genießen“ können. Und in der Medizin soll die Naturerkenntnis den Traum vom Jungbrunnen erfüllen und den Menschen von "unendlich vielen Krankheiten sowohl des Körpers als auch der Seele, vielleicht sogar von der Altersschwäche“ befreien. Unmittelbar auf humanitäre Zwecke lässt sich die Kenntnis der Naturkräfte aber nicht festlegen, denn der Entdeckungszusammenhang entscheidet nicht über die Verwendung. Auch die Kräfte, die nur um humanitärer Zwecke willen erforscht worden sind, können am Ende für beliebige Zwecke eingesetzt werden.
Humanitäre Technik?
Nehmen wir als Beispiel die Genforschung: Als erstes experimentiert man mit den Bausteinen des Lebens; als zweites lassen sich die Folgen auf die Welt außerhalb des Labors kaum abschätzen. Ob tatsächlich Gefahren drohen, vermag die philosophische Ethik nicht zu entscheiden. In die Debatte über die "Risiken der Genforschung“ greift sie nicht mit Fachgutachten ein; sie leistet aber eine vielfältige Begründungshilfe. Dazu gehört die Forderung, eine Risikodebatte schon im Stadium der Grundlagenforschung zu starten. Wo das Handeln an der gemeinsamen Welt möglicherweise große Gefahren heraufbeschwört, hat eine Risikodebatte den Rang einer Bringschuld. Solange die Risikoforschung nicht gründlich erfolgt ist, sind neuartige Experimente moralisch so erlaubt wie Autos, die man dem Verkehr überlässt, ohne eine zuverlässige Bremstechnik einzubauen.
Die Kernenergie bietet ein gutes Negativbeispiel: Dass es radioaktive Abfälle zu versorgen gibt, wusste man seit Beginn; wie eine Endlagersicherheit möglich ist, wusste man - wenn überhaupt - erst viel später; und noch einmal später werden die Endlager tatsächlich gebaut.
Gefährlich ist weiters auch ein Imperialismus des Wissens. Seit der Antike herrscht ein Dualismus vor, wonach dem Meinen, dem Nicht- oder Noch-nicht-Wissen, das wirkliche Wissen, die Wissenschaft, gegenübersteht. An diesem Dualismus nimmt der große Denker der Moderne, Immanuel Kant, eine zweifache Veränderung vor: Erstens führt er eine neue mittlere Stufe, den Glauben, ein. Zweitens platziert er sie nicht etwa in der Mitte, zwischen Meinen und Wissen, sondern an die Spitze. Denn das Wissen bezieht sich nur auf Gegenstände, deren objektive Realität bewiesen werden kann. Dabei werden die existenziell wichtigen Dinge, Freiheit, Dasein Gottes und Unsterblichkeit der Seele, verdrängt. Mit dieser Einsicht benennt Kant eine andere Gefahr von Wissen aufmerksam: Wer nur das übliche, kognitive Wissen kennt, versperrt sich existentiell wichtigen Fragen.
Eine neue, andersartige Gefahr bergen schlussendlich auch Diagnosen: nämlich jene, eine bisherige Sicherheit zu erschüttern. Hier ist das Wissen nicht in dem üblichen Sinn gefährlich, dass es, sobald es verwendet wird, eine Gefahr heraufbeschwört. Vielmehr ist schon der gewusste Sachverhalt gefährlich, weshalb ihn viele lieber gar nicht zur Kenntnis nehmen.
Beispiele gibt es sowohl im öffentlichen als auch im persönlichen Leben. Schon seit längerem ist die Politik für das Thema "Gerechtigkeit zwischen den Generationen“ sensibel geworden. Dazu herrschte aber über viele Jahre eine auffallende Selektion vor. Im Namen der Generationengerechtigkeit setzte man sich recht bald für den Umweltschutz ein. In den Hintergrund drängt man dagegen die andere Frage der Generationengerechtigkeit. Sie besteht in jenem veritablen Skandal, dass die immer noch wachsende Staatsverschuldung von den künftigen Generationen zu bezahlen ist.
Im persönlichen Leben sind medizinische Diagnosen Beispiele gefährlichen Wissens: Wenn etwa eine bislang gesunde Person erfährt, dass sie an einer schweren, eventuell sogar lebensgefährlichen Krankheit leidet; oder wenn mittels Präimplantationsdiagnose an Embryonen Erbkrankheiten detektierbar werden (vgl. Artikel Seite 12).
Philosophen sollen nicht nur vorgegebene Probleme lösen, sondern zunächst einmal das Problembewusstsein erweitern und schärfen. Aus diesem Grund legt dieser Essay vornehmlich auf die zweite Aufgabe wert, zumal die Lösungssuche dann - hoffentlich - etwas leichter fällt.
* Der Autor ist Direktor der Forschungsstelle Politische Philosophie an der Universität Tübingen. Im März erschien sein Buch: "Ethik. Eine Einführung“ (Beck)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!