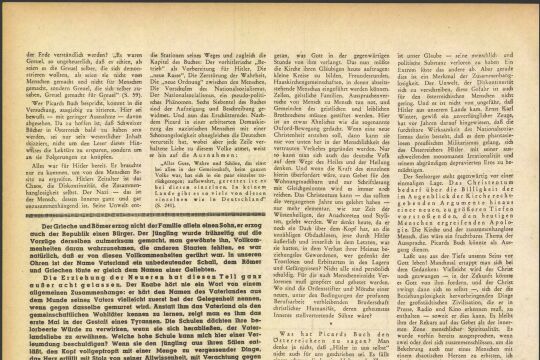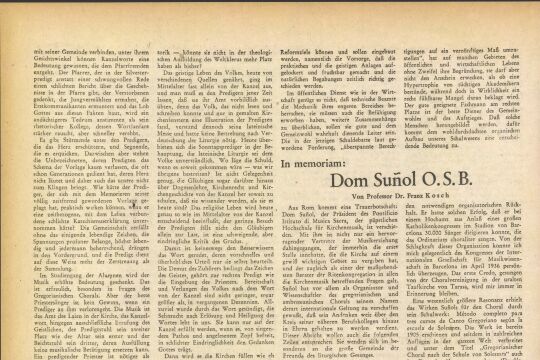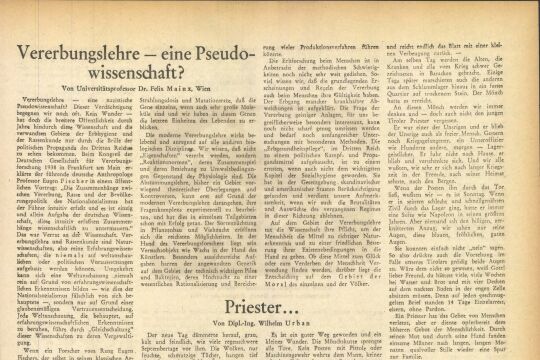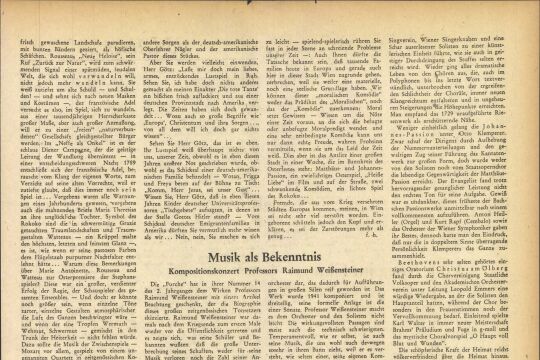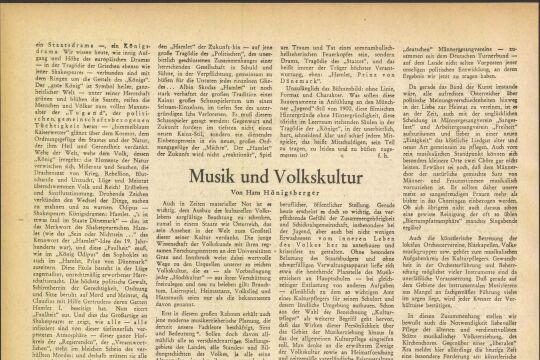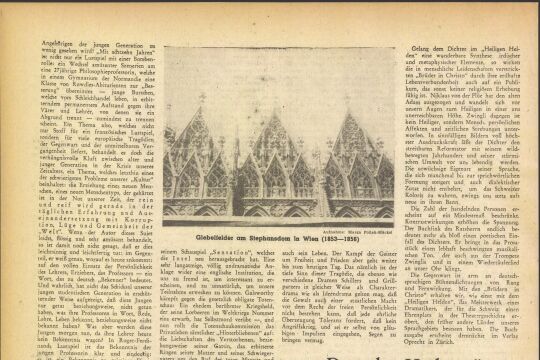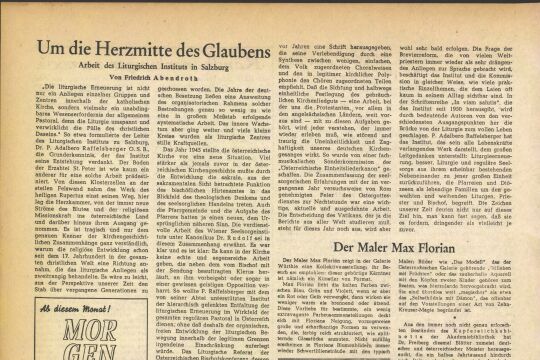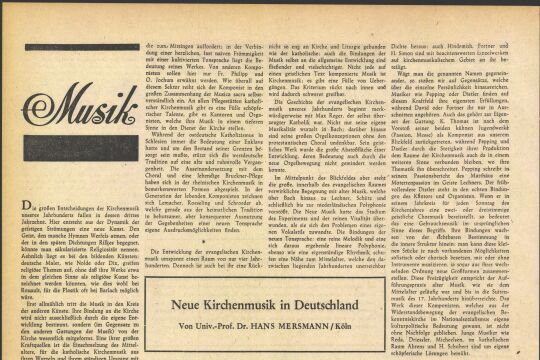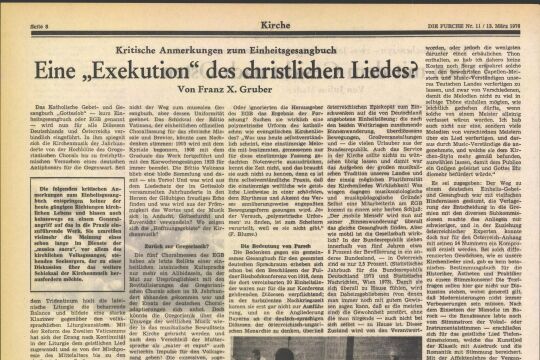Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Musikalische Krise des Hochamts
Wie jede Kunst, trägt auch die Kirchenmusik, von der die Kirche fordert, daß sie wahre Kunst sei, das Gewand ihrer Zeit mit der Aufgabe, darin zeitlos Gültiges zu manifestieren. Letzteres wird von ihr als einem Bestandteil des Gottesdienstes in erhöhtem Sinn und Maß gefordert. Sie hat auch immer vermocht, dieser Aufgabe — im Rahmen ihrer Zeit — zu entsprechen; über diese hinaus nur in den größten Meisterwerken der einzelnen Entwicklungsepochen, die von einer form- und ausdrucksmäßig oft völlig anders eingestellten Gegenwart als bleibend übernommen wurden und selbst diese Gegenwart überdauerten, da sie als letzte Vollendung eines Stils oder einer geistigen Haltung jeder weiteren Entwicklung entzogen waren und sind.
Die kompositorische Entwicklung in unserer liturgisch betonten Zeit ist vom gregorianischen Choral und der alten Polyphonie her stärkstens inspiriert, während die praktische Kirchenmusikpflege zumeist die spätbarocke Instrumentalmesse in den Mittelpunkt stellt. Das führt, insbesondere durch die epigonale Nachkomposition der letzteren, zu stets wachsender Spannung, zur Spaltung des Empfindens und seiner Fortrückung aus dem liturgischen Zentralpunkt. Dabei geht es keineswegs um die künstlerische Pflege der barocken Instrumentalmesse an sich, die nicht nur berechtigt, sondern unschätzbares Erbe, österreichische Besonderheit und österreichischer Stolz ist. Wo die Kräfte reichen, sollen auch die „Klassiker“ musiziert werden. Auch, aber nicht nur oder in erdrückender Überzahl. Und vor allem nicht ihre Nachfahren mit den gekürzten Texten, dem epigrammatischen Credo und dem Rondo-Bene- dictus — wie es leider vielfach noch geschieht. Es ist zweifellos absurd, in der Zeit eines Heiller und Tittel Messen von Zangl und Kemptner im Hochamt zu musizieren.
Daß solche und ähnliche Praktiken (sentimentale deutsche „Einlagen" im lateinischen Hochamt kommen selbst an Orten vor, wo man sie nicht einmal vermuten dürfte) durch ihre Liturgieferne die Vorrangstellung des Hochamts als höchste und feierlichste Form des Gottesdienstes von der Musik aus gefährden, es zum Torso und zum — oft recht zweifelhaften — Konzert machen, muß immer wieder festgestellt werden, selbst wenn die Vertreter dieser Praktiken da und dort den schwarzen Mann spielen.
Hiezu treten als neues Problem die volksliturgischen Formen, die immer mehr das Hochamt ersetzen. Auf einer kantonalen Tagung des Cäcilienvereins soll bereits auf das abschreckende Beispiel Österreichs hingewiesen worden sein, wo das Hochamt immer mehr ab- und die Betsingmesse immer mehr aufkomme. Dazu wollen wir allerdings feststellen, daß eine richtig eingeführte Bet- s'ngmesse uns weit wertvoller (und litur- gischerl) erscheint als ein Hochamt mit unvollständigem Text, mit Einlagen , konzertanter Musik oder völlig unzulänglichen Mitteln. Dies vorausgesetzt, sollte allerdings das Hochamt als das höchst erstrebenswerte Ziel jedes Pfarrers und jeder Pfarrgemeinde selbstverständlich sein.
Die Betsingmesse hat musikalischkünstlerische Gestaltungsversuche verschiedenster Art aufzuweisen. Kirchliches Volkslied, deutsche Gregorianik, mehr- stiinmige Chorsätze sind die angezoge- hen Elemente. In Österreich haben die Brüder Hermann und Joseph Kronsteiner (Linz) auf diesem Gebiet Bedeutendes geleistet. Ihnen gesellt sich in anderer Art Pfarrer Paul Beier (Maria-Wörth). Alle diese Versuche stellen indes mehr oder weniger Anforderungen an die Ausführung, müssen erlernt werden — und es ist die Frage, ob in der gleichen Zeit nicht auch ein Choralamt erlernt würde, womit zweifellos liturgisch Vollkommeneres erreicht wäre. Die Form des Volkshochamtes hingegen mit ihrer durchgehenden Zweisprachigkeit und ihrem Sammelsurium von Liedern, Stilen und Strophen erscheint in ihrer Primitivität kirchenmusikalisch nicht diskutabel. Hier ist der letzte Rest'von wahrer Kunst dahin.
Da nun bei festlichen Veranstaltungen, die von Massen besucht werden, die Messe in der Regel in einer der volksliturgischen Formen gefeiert wird, um das Volk singen zu lassen, erscheint die Betsingmesse erst recht im Mittelpunkt des liturgischen Gedankens und das Hochamt noch ferner gerückt.
Es soll hier nicht überheblich geurteilt werden, wie denn alle Probleme nur am Rande berührt erscheinen. Dennoch sei die Frage erlaubt, ob so vielseitige ideale Arbeit, einheitlich eingesetzt, nicht bereits dahin geführt hätte, das Choralamt im ganzen Volk heimisch zu machen. Das gäbe auch dem Ausland die Möglichkeit, einzustimmen — während man sich die Volksliturgie beispielsweise in der Schweiz viersprachig zu denken hätte.
Wie dem aber auch sei, muß den volksliturgischen Formen zugestanden werden, daß sie — künstlerisch oder nicht — keinerlei eigenstrebigen Ehrgeiz besitzen, keine symphonischen und konzertanten Dimensionen aufweisen, sondern nur einzig nach dem liturgischen Gedanken ausgerichtet sind. Das ist ihre Stärke vor mancher künstlerisch hochwertigen Hochamtsmusik. Womit dieser der Weg gezeigt ist, zwei großen Gefahren zu entgehen: dem Absinken in Epigonie und Liturgieferne einerseits und andererseits dem überholtwerden durch die in dieser Hinsicht völlig einwandfreien volksliturgischen Messeformen. Ein neuer Geist tut not, den Kirchenchören vor allem; ein Geist, der das Alte, Gültige nicht verachtet, sich aber daran nicht genug sein läßt, sondern es mitten hineinstellt ins heutige Schaffen, das entscheidend für uns bleibt. Denn hat uns Gott in diese Zeit gestellt, so ist es sein Wille, daß wir mit allen Mitteln dieser Zeit (und nicht bloß der vergangenen) sein Lob singen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!