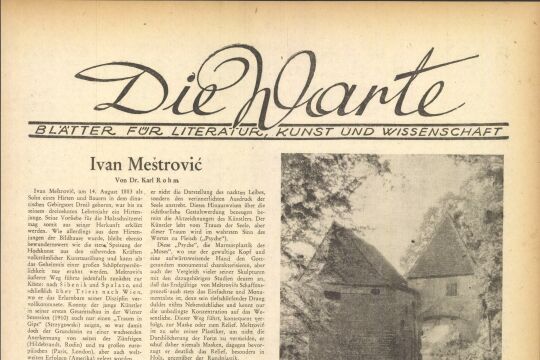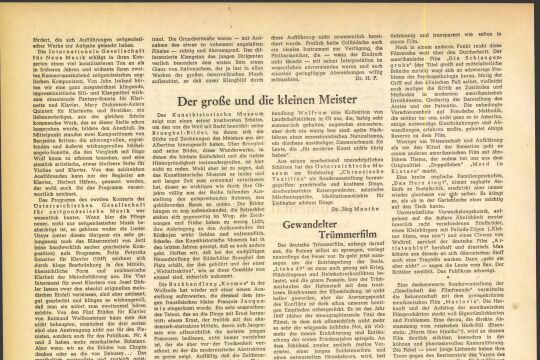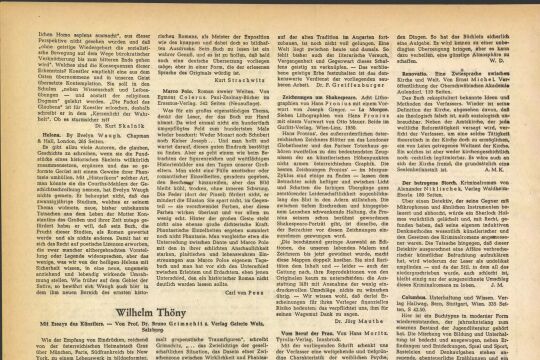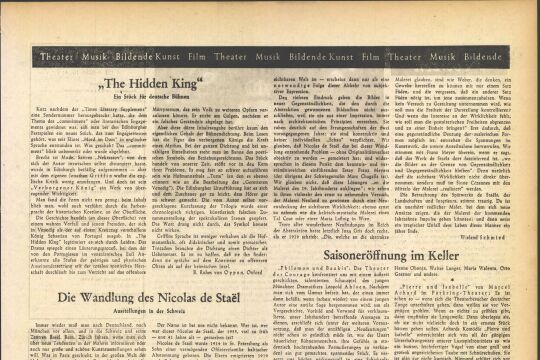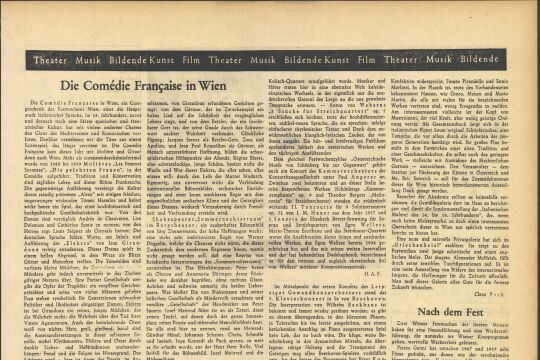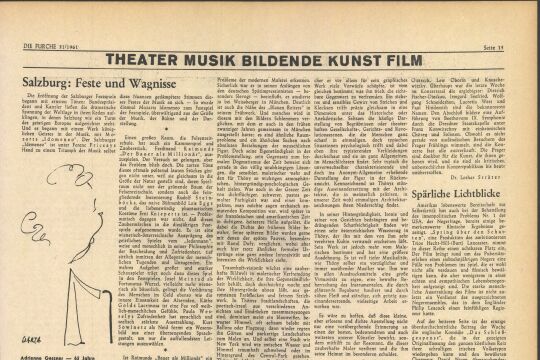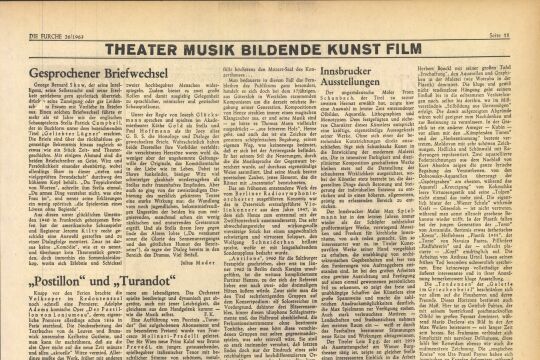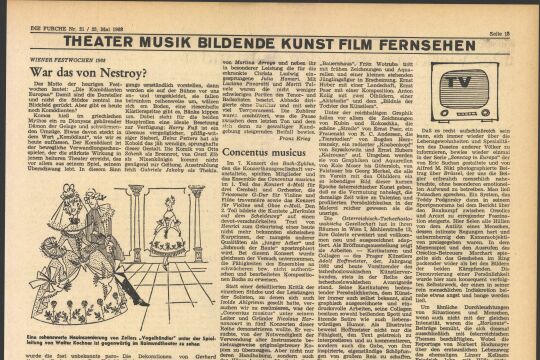Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Post festum
Ohne Zweifel muß der 1944 verstorbene Carl Anton Reichel eine interessante Persönlichkeit gewesen sein. Wie wäre es sonst zu erklären, daß schon zu Lebzeiten ein Schlüsselroman erschien, in dem er als eine Art Magier auftrat? 1874 in Wels geboren, hatte Reichel sein Medizinstudium abgebrochen, um sich im Paris des Dr. Charcot und des Joris Karl Huysmans mit medizinischen Grenzwissenschaften, der Hypnose und der Suggestion, aber auch mit dem Spiritismus und dem Okkultismus zu befassen. Dort begann auch seine Beschäftigung mit der Kunst — er besuchte die Academie Julian —, die ihn zu einem beachtlichen Kunstsammler vor allem von Aslatlca machte. Nach Österreich zurückgekehrt, lebte er schließlich im Schulhof in Wien und widmete sich als Di le Hout nicht nur dem Studium des Buddhismus und der Geheimwissenschaften, sondern auch der Druckgraphik. Er muß beachtliche Faszination ausgestrahlt und sich mit einem beachtlichen Nimbus umgeben haben.
Das alles macht ihn weder zu einem großen noch zu einem bedeutenden Künstler, wie die Ausstellung in der Albertina beweist, die ihn gerne als einen „Vorläufer“ der Wiener Schule der phantastischen Realisten etikettieren möchte. Abgesehen davon, daß viele seiner sogenannten Naturstudien nach Photographien — die noch vorhanden sind — nachgezeichnet wurden, ist sein Zeichenstil akademisch, trocken und leblos. Das gilt auch für die Druckgraphik, die vom Jugendstil beeinflußt ist, in der aber dessen freie Ornamentik dazu verwendet wird, die pseudomystischen Inhalte ebenso pseudomystisch aufzuputzen. Reichels künstlerische Form ist viel zu schwach, die literarische Gedankenfracht zu fassen, abgesehen davon, daß deren Darstellung sich dem Bereich der bildenden Künste entzieht, ihnen nicht wesensgemäß erscheint Reichel deshalb als „Surrealisten, Abstrakten und Expressionisten“ vor dem „Bekanntwerden dieser Richtungen“ zu feiern und in ihm den „genialen Weitblick auf die abstrakte Kunst“ zu sehen und „ihre Vorwegnahme durch Reichel verwirklicht, noch ehe Kan-dinsky damit bekannt wurde“, geht angesichts der historischen und künstlerischen Tatsachen, die damit verdreht und auf den Kopf gestellt werden zu weit. Reichels Werk ist lediglich eine Vignette innerhalb der Zeiterscheinungen — mehr kann man ihm an künstlerischen Meriten nicht zubilligen.
Rudolf Hoflehners Werkzedahnungen, Studien- und „Tagebuchblätter“ rufen unwillkürlich in ihrer gepflegten Ästhetik, in ihrem raffinierten, fast kunstgewerblichen Ausspielen des Vortrags und der Mache, die Erinnerung an ähnliches bei Henry Moore hervor. Nicht an dessen wirklich bedeutende, im letzten Krieg entstandene „Tube“-Zeichnungen, aber an Entwürfe für Plastiken, die der englische Bildhauer sehr überflüssigerweise mit zuckrigen Wasserfarben geschmacklich aufpolierte. Überflüssigerweise, da die Farbe nicht als gestaltendes Element eingesetzt war, nur kolorierte und „verschönte“ und aus dem Schritt in der geistigen Konzeption einer Plastik, dem Teil eines Arbeitsvorganges, diesen verselbständigend, ein selbstgenügsames, dekoratives Blatt, eine „Graphik“ machte. Hoflehner zeichnet zwar nicht mit der plastischen Eindringlichkeit seines Kollegen — im Gegenteil —, seine Blätter und Entwürfe sind von einer für einen Bildhauer erstaunlich geringen räumlichen Suggestion. Er beweist aber beträchtlichen dekorativen Geschmack, der allerdings bei der Farbigkeit der großen, mit Acrylfarben gemalten Studienblätter wieder stark nachläßt. Die beiden ebenfalls ausgestellten Stahlflguren von 1966 zeigen gegenüber den etwas älteren anderen beiden Arbeiten eine deutliche Entwicklung zu neuen rhythmischen Zusammenhängen. Eine stärkere Durchdringung des räumlichen Problems ist bei ihren nur auf Seitenansichten festgelegten fragmentarischen Formationen nicht festzustellen. In der Galerie Würthle bis 26. März.
In der Galerie „Basilisk“ erweist sich der junge Graphiker Sige Schenk als ein sehr begabter Illustrator, dessen Zeichnungen und Radierungen zu — unter anderem — „Biedermann und die Brandstifter“, „Die Merowinger“. „Ein Yankee am Hofe des Königs Arthur“ sowohl Witz wie eine sich mehr und mehr freiwerdende Zeichenfeder verraten. Das gesunde Maß an Konkretheit, das sie noch besitzen, wird Schenk hoffentlich nicht zugunsten dekorativerer Wirkungen aufgeben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!