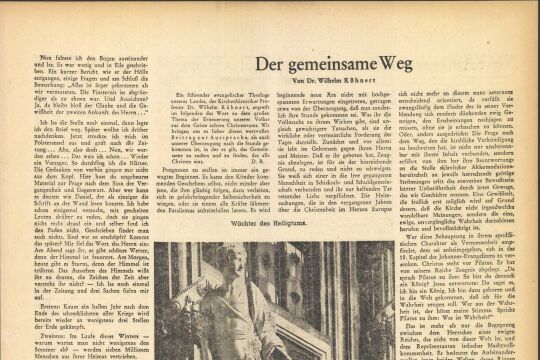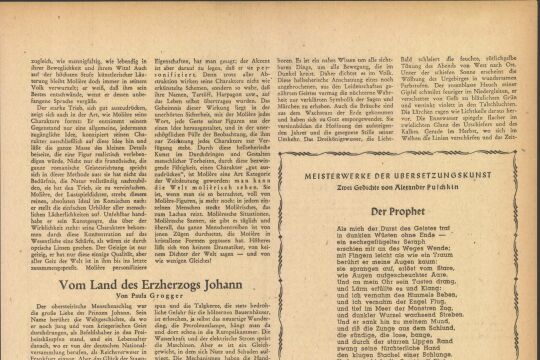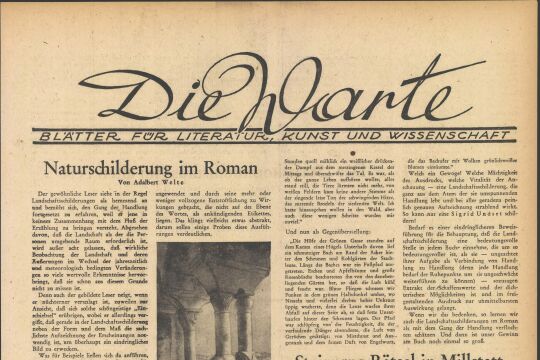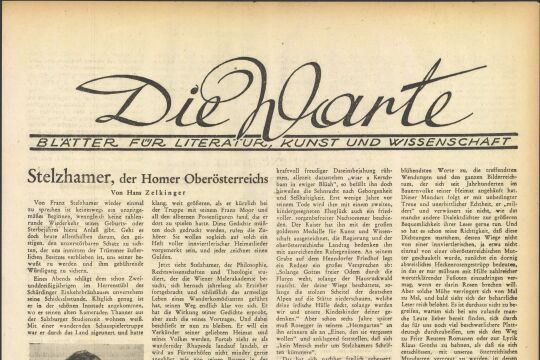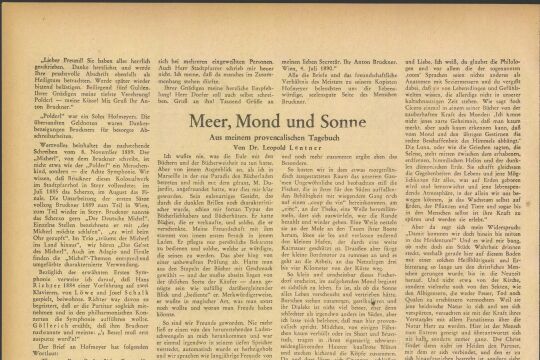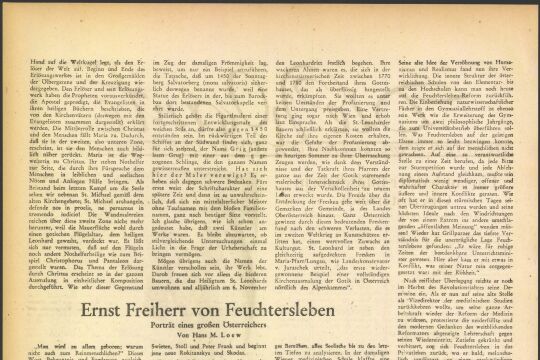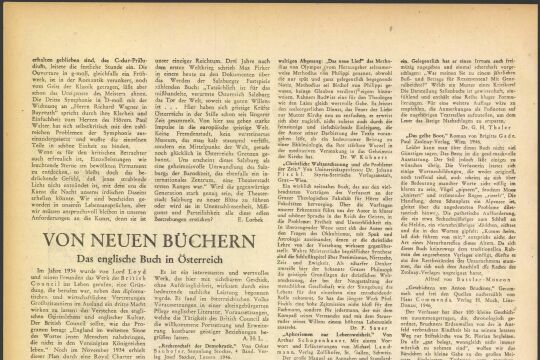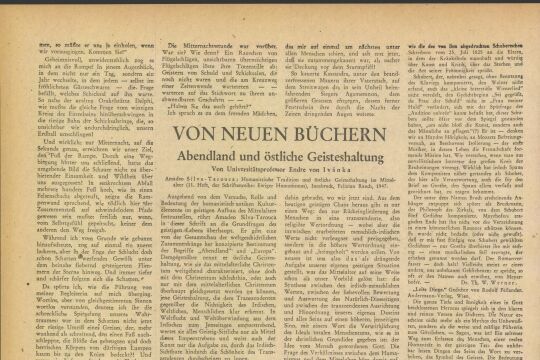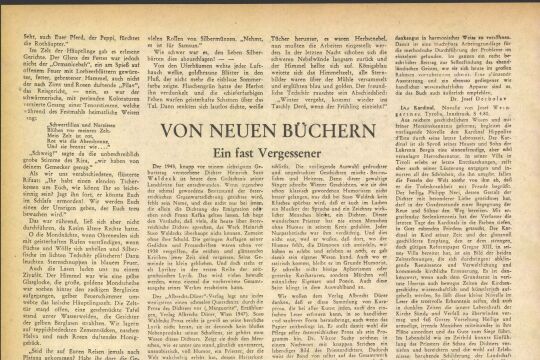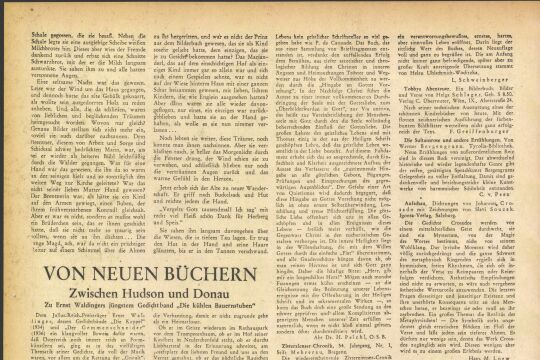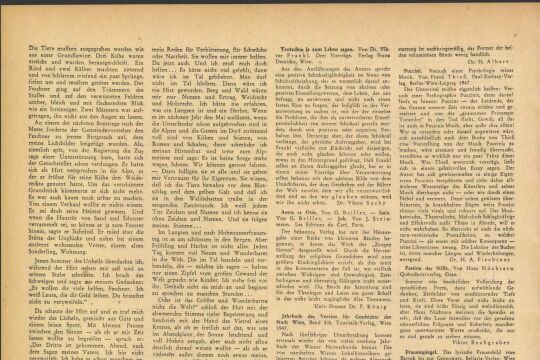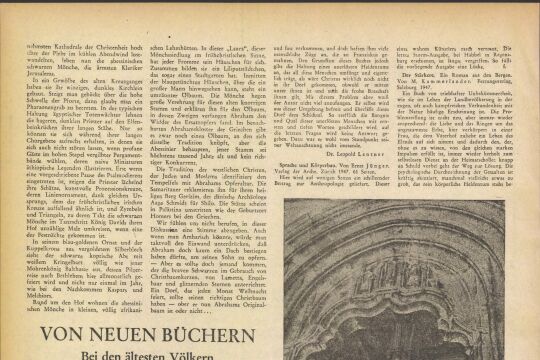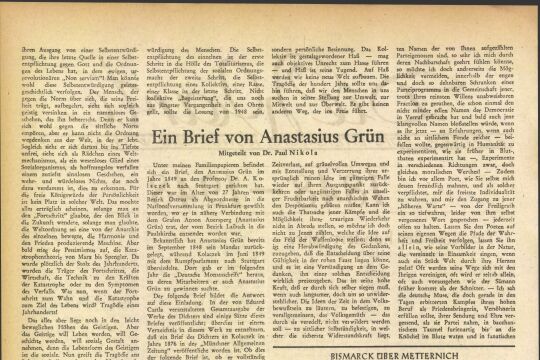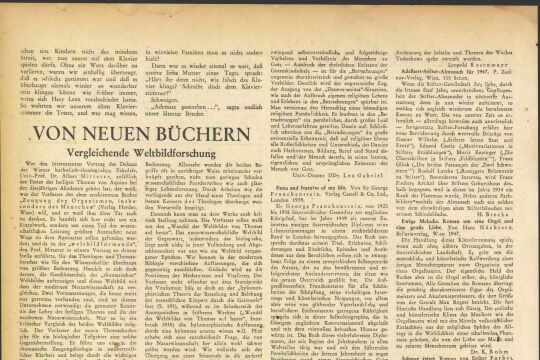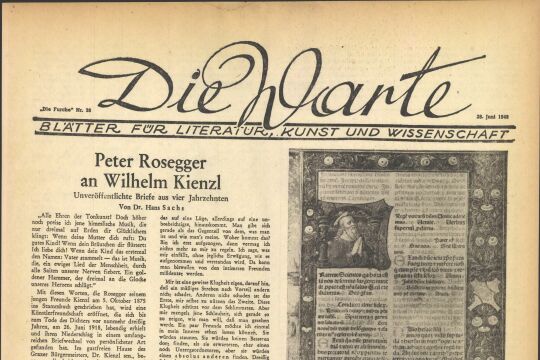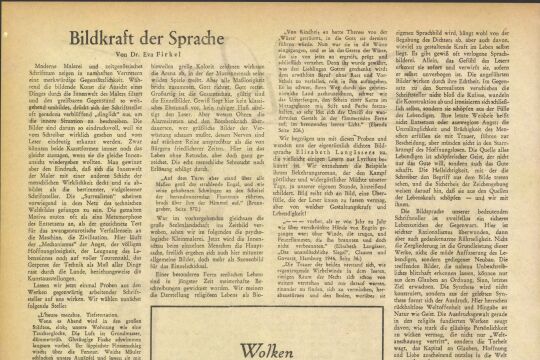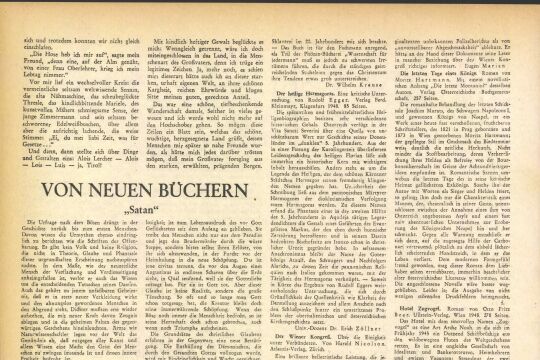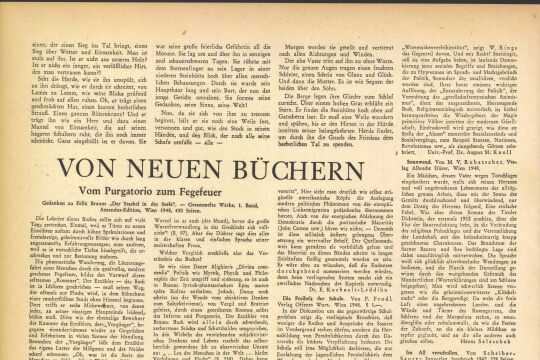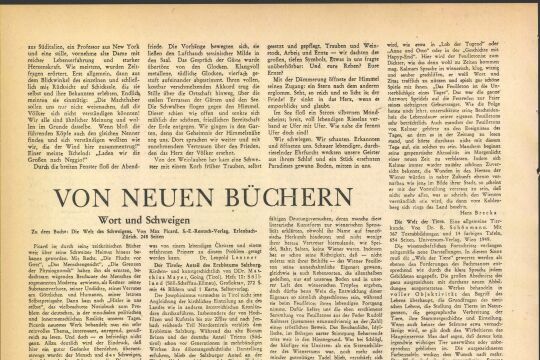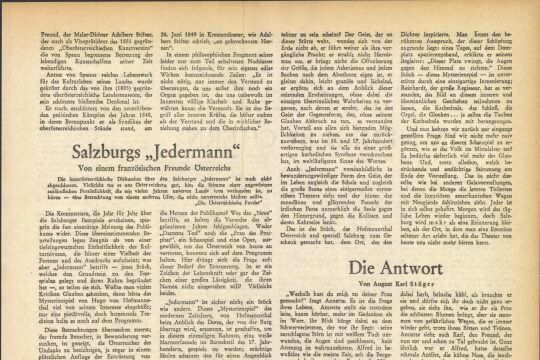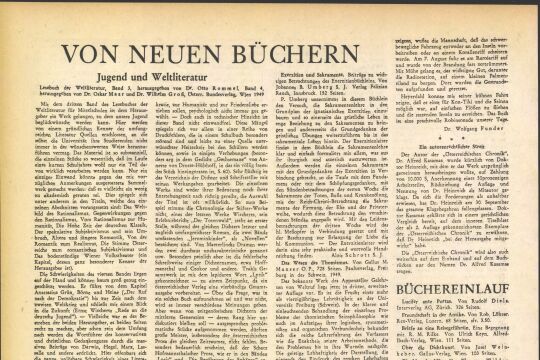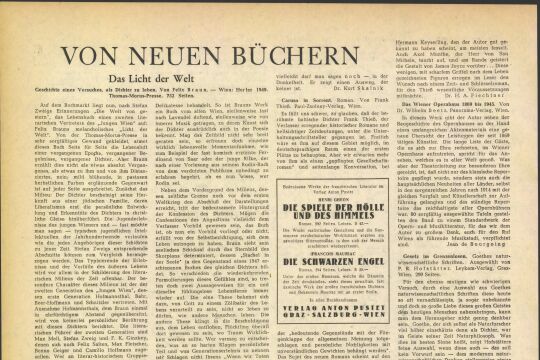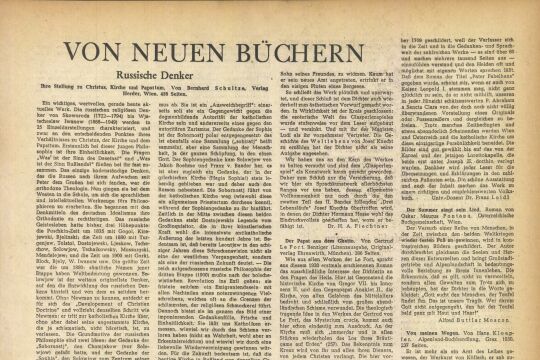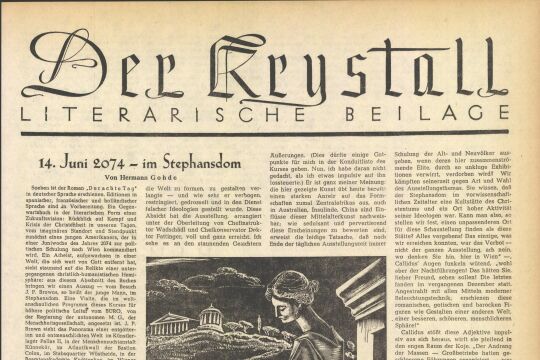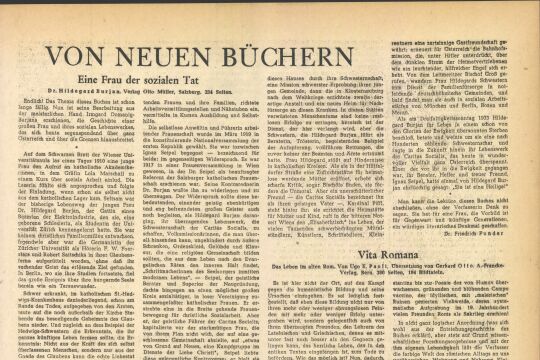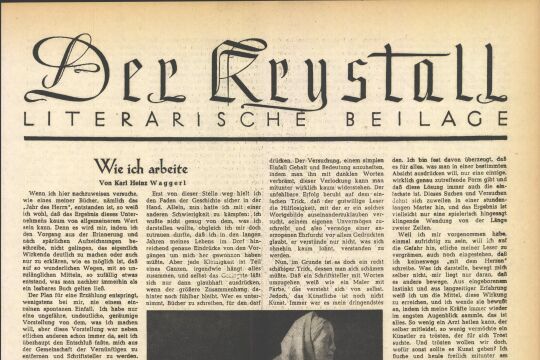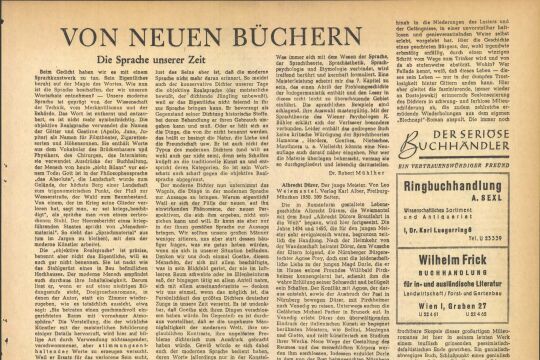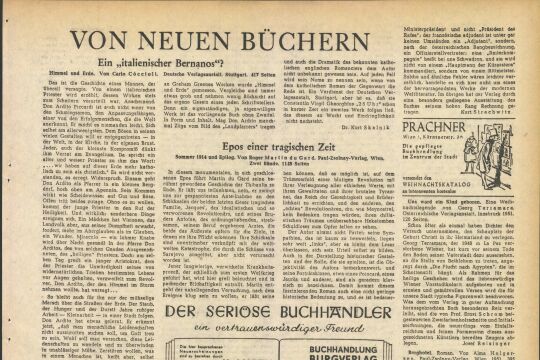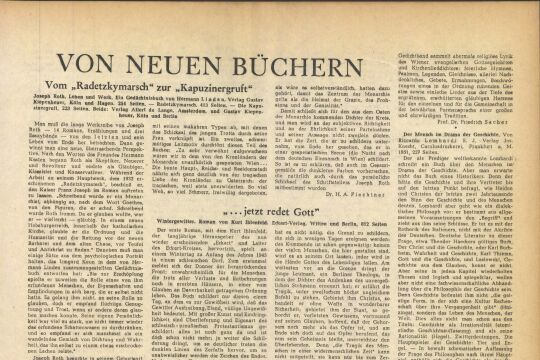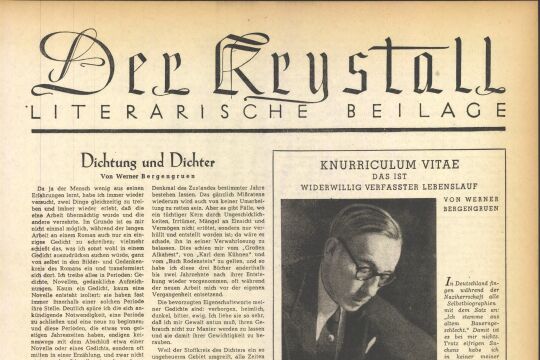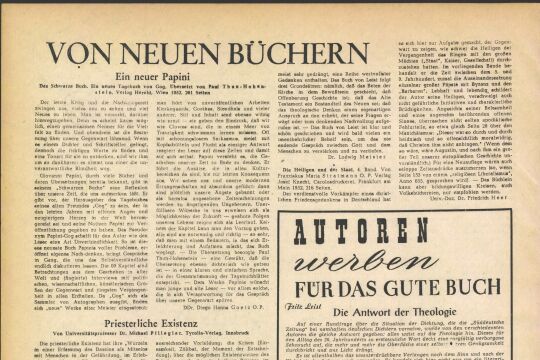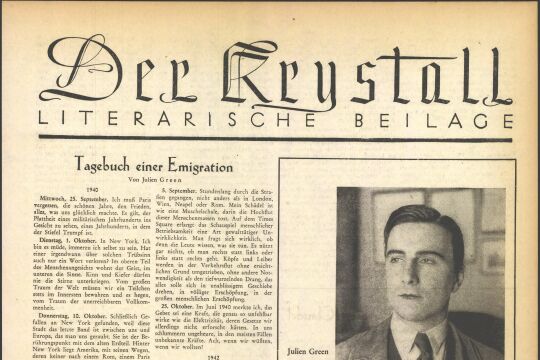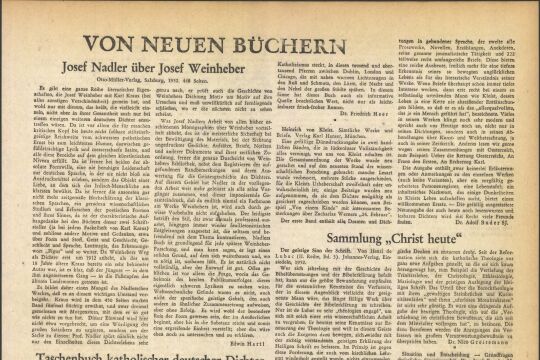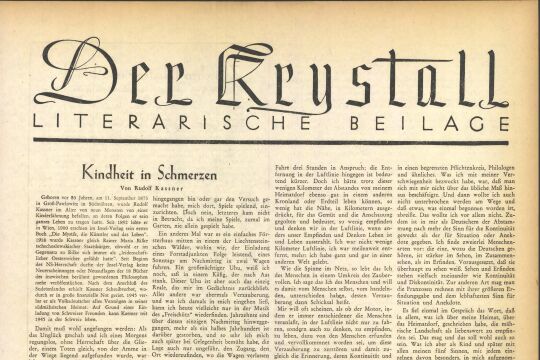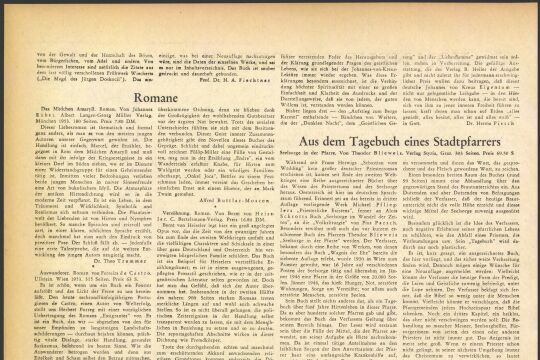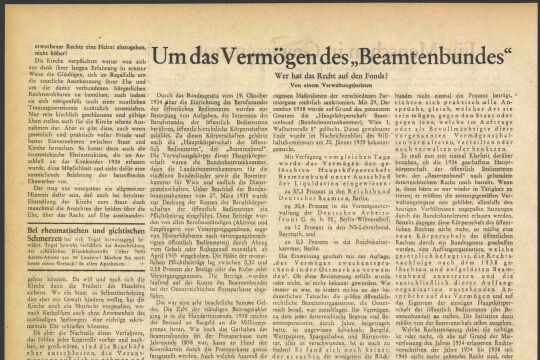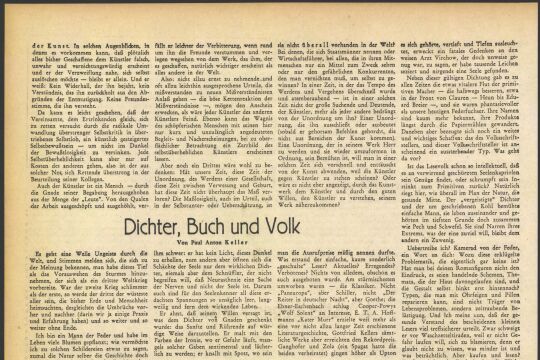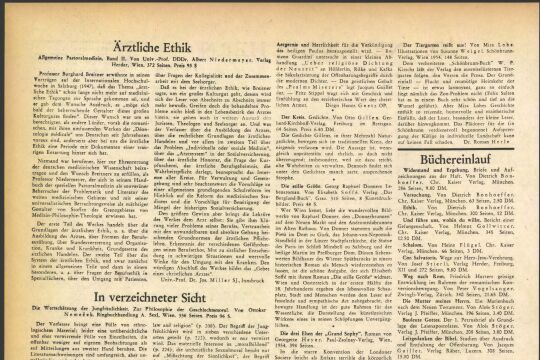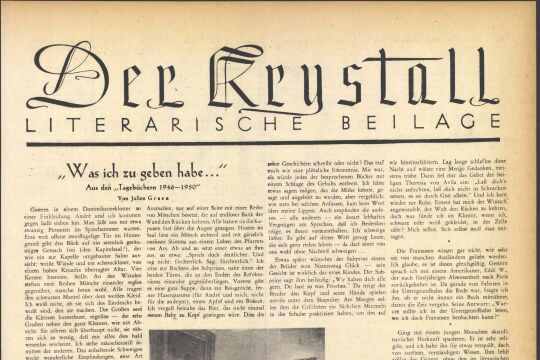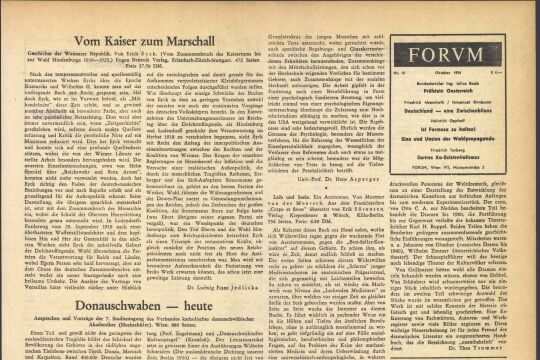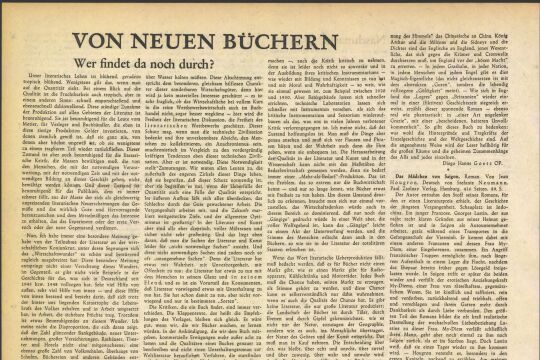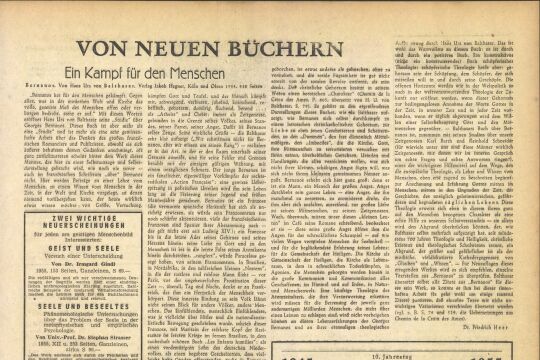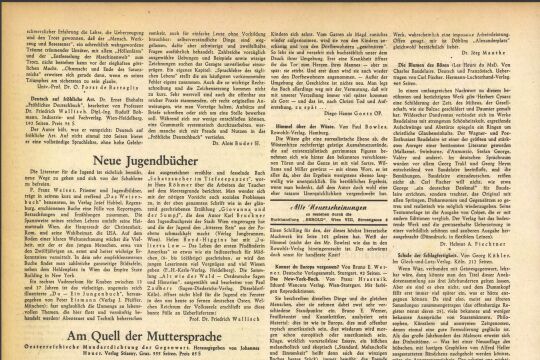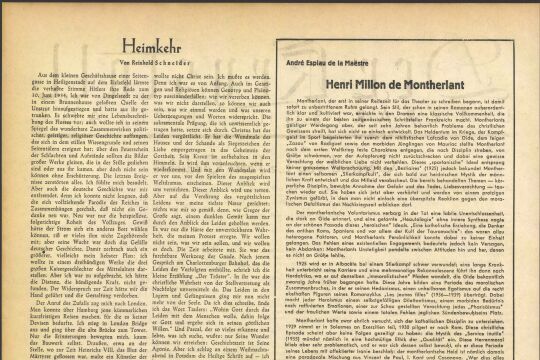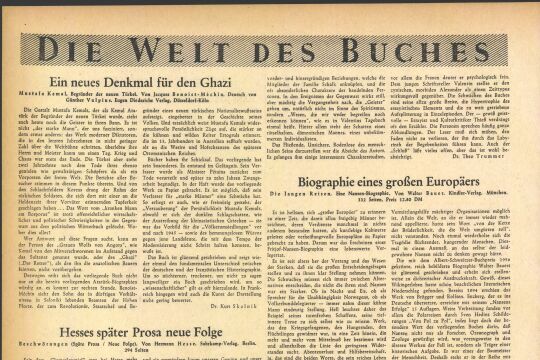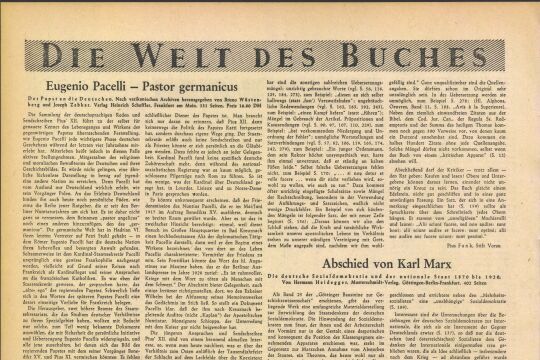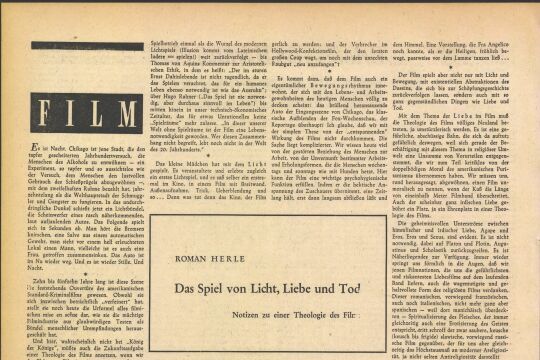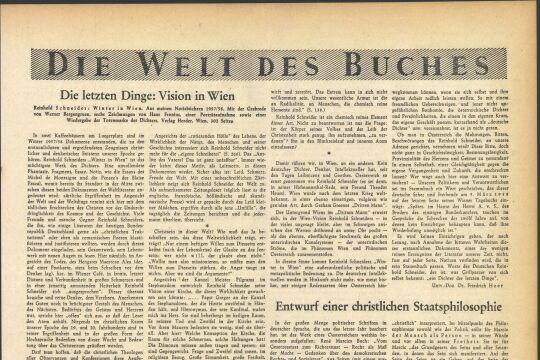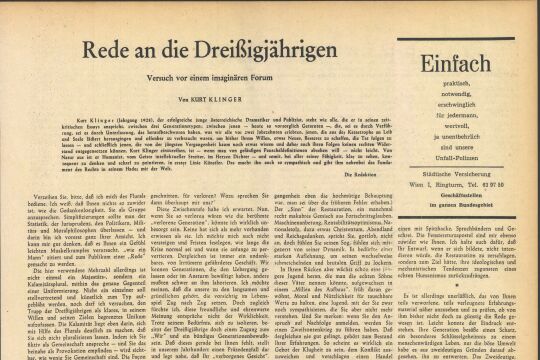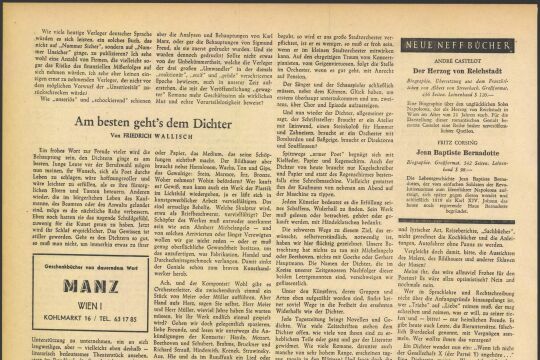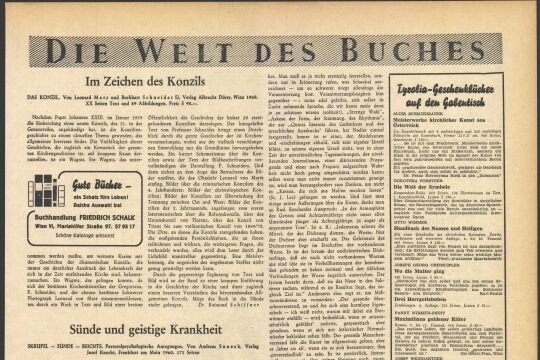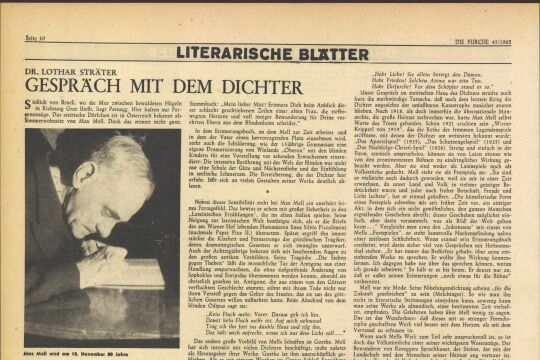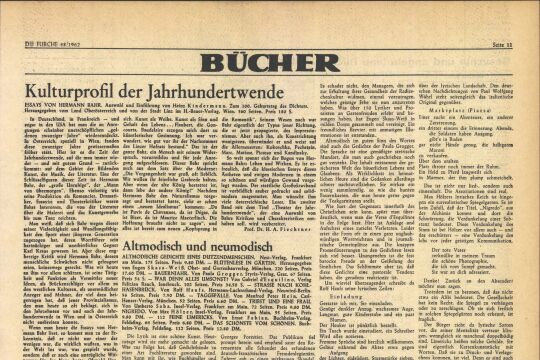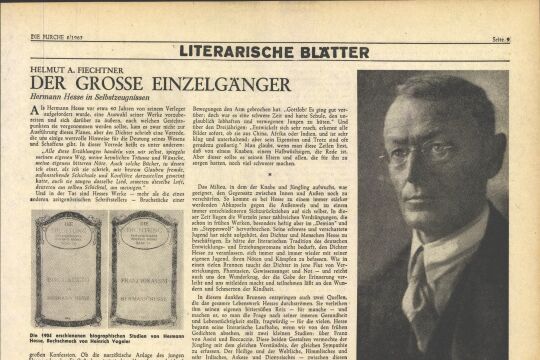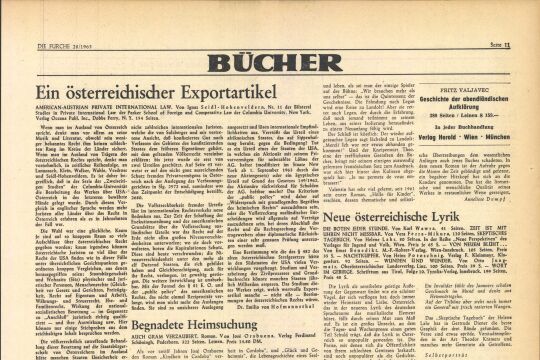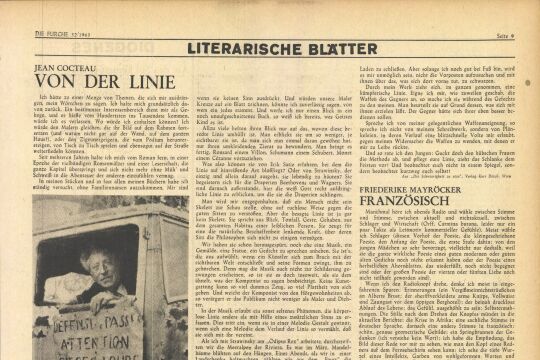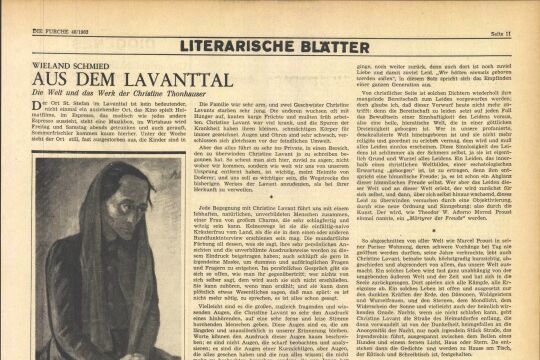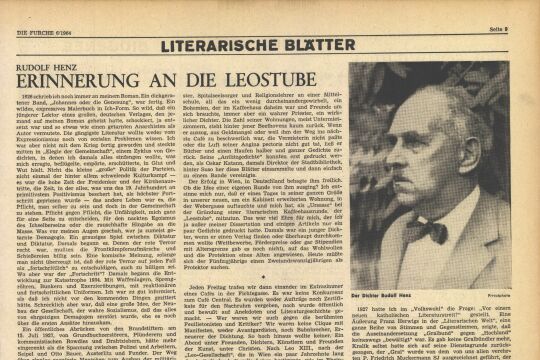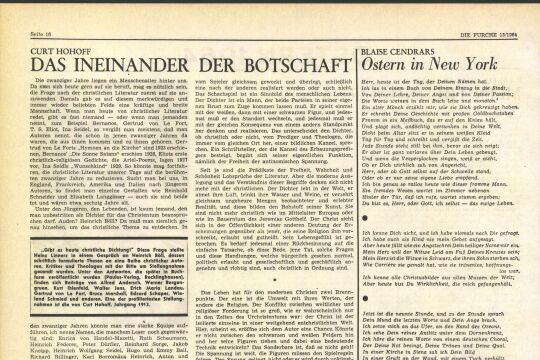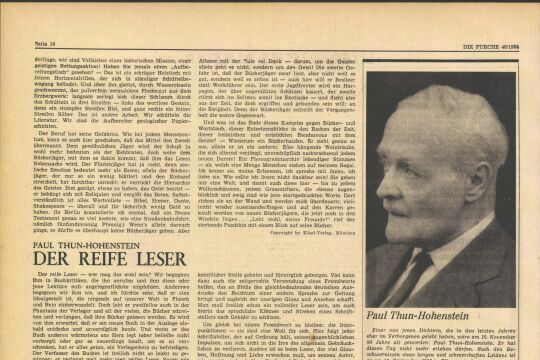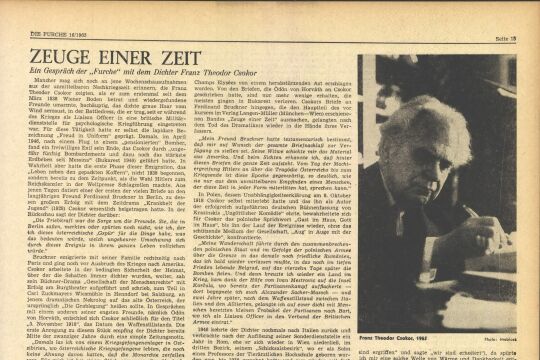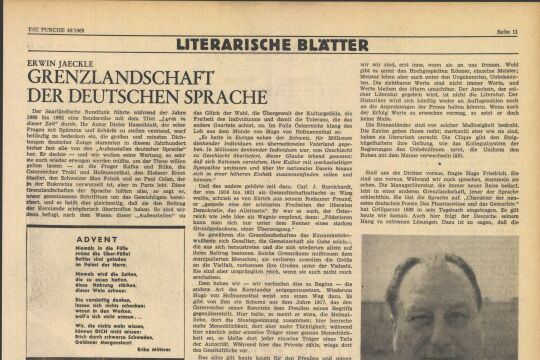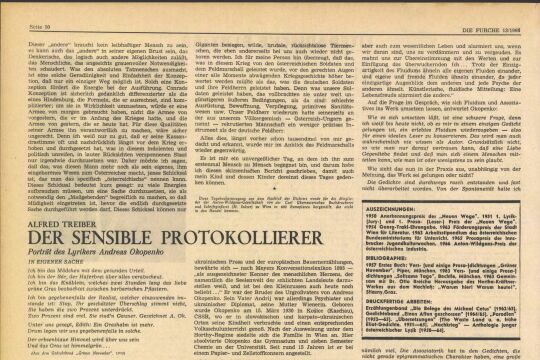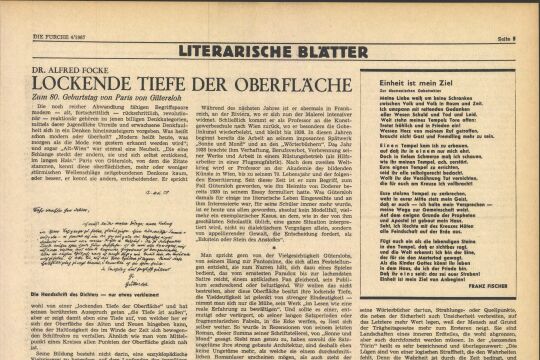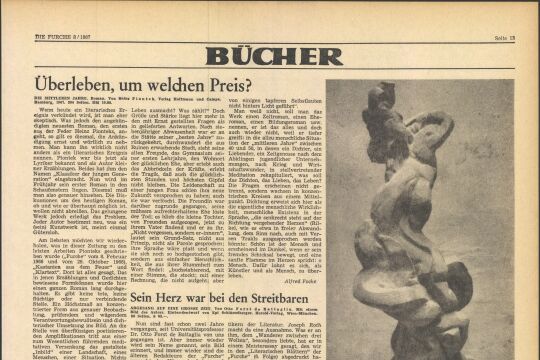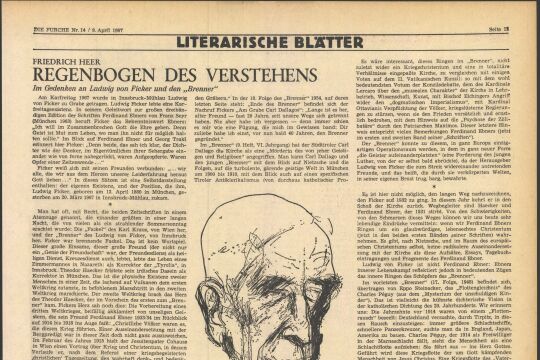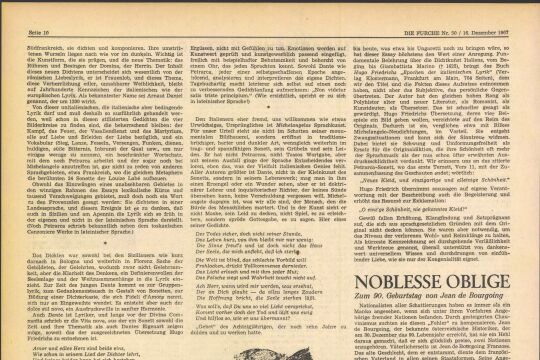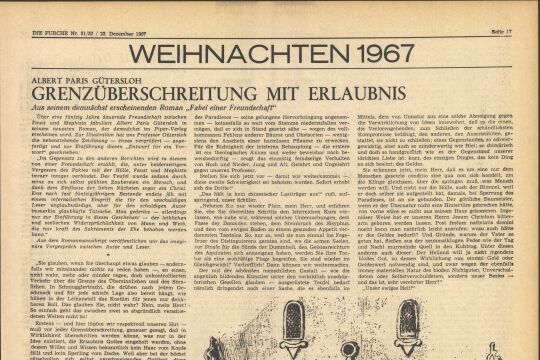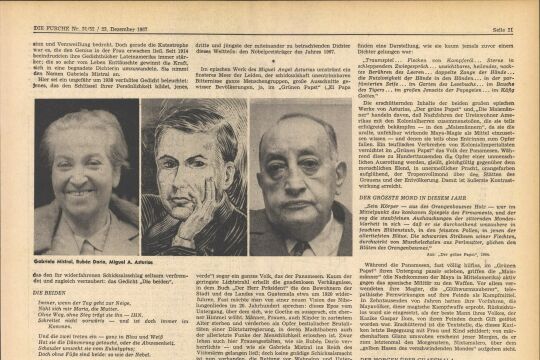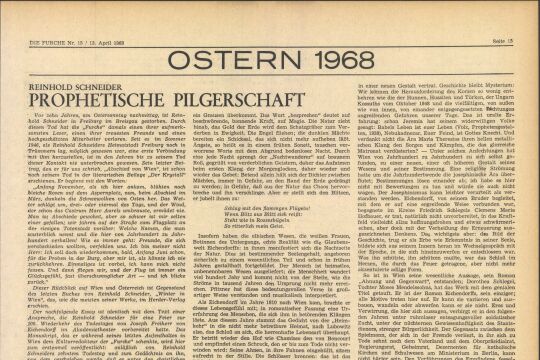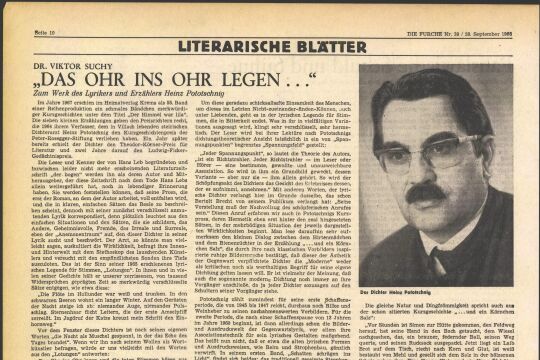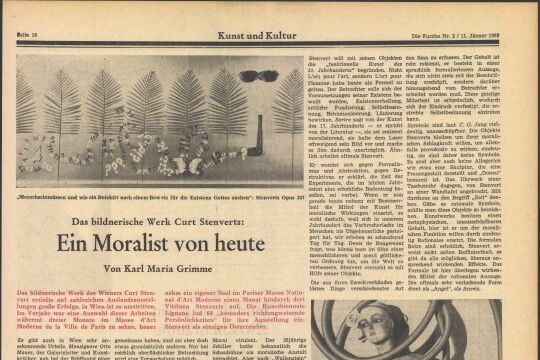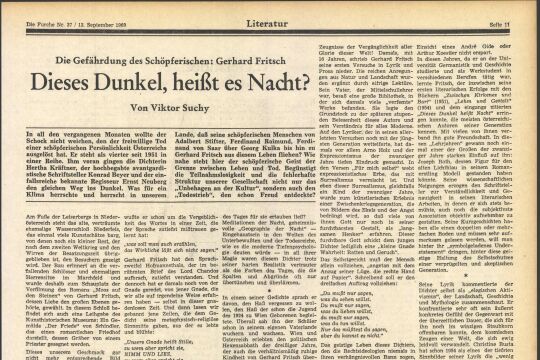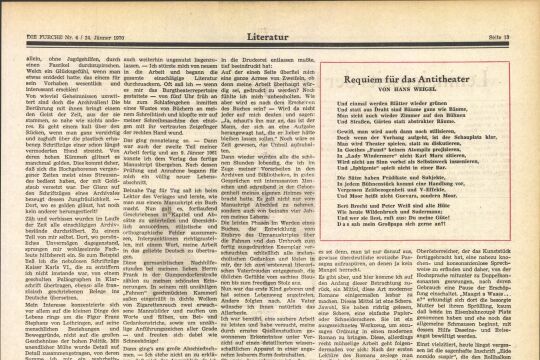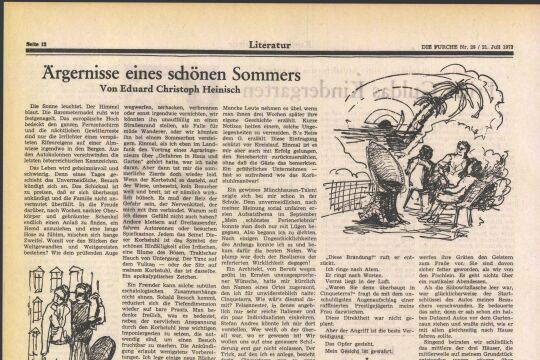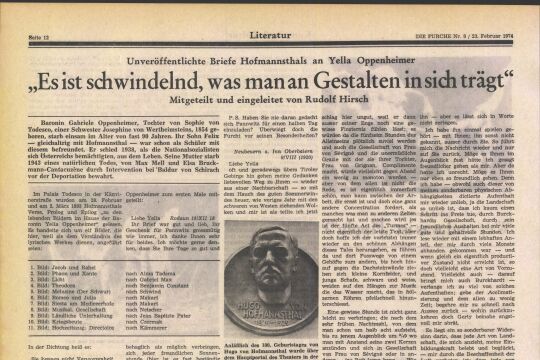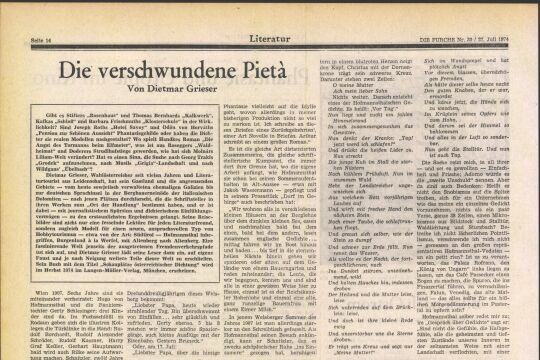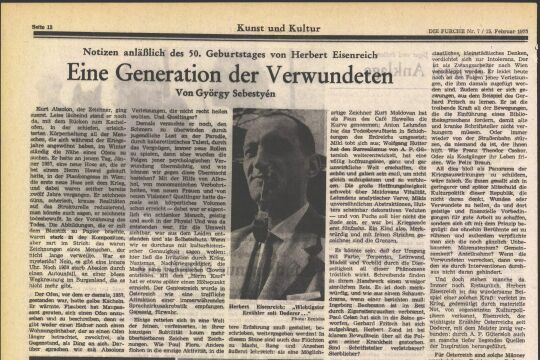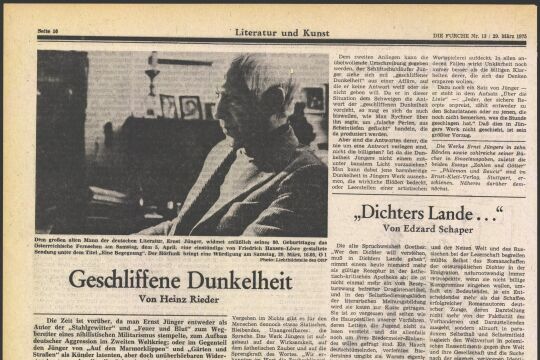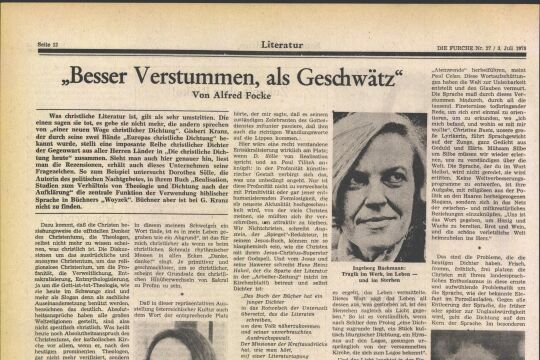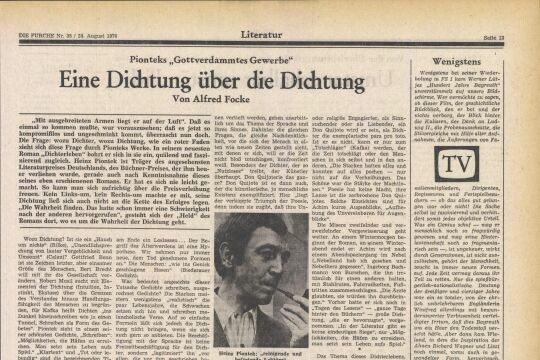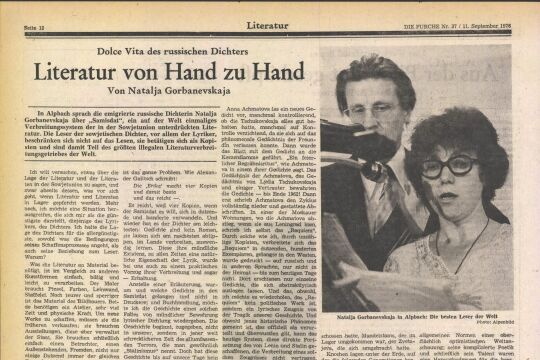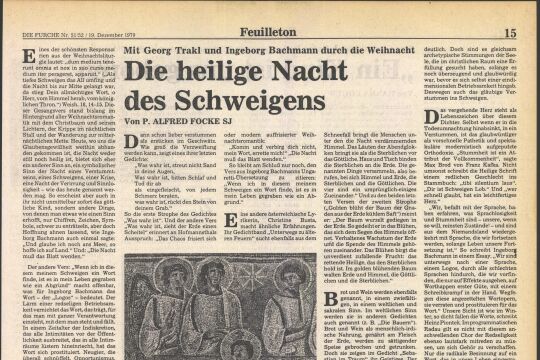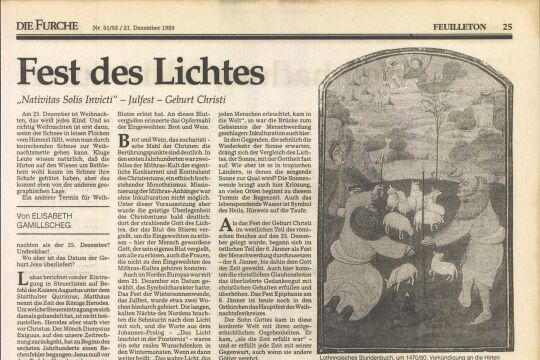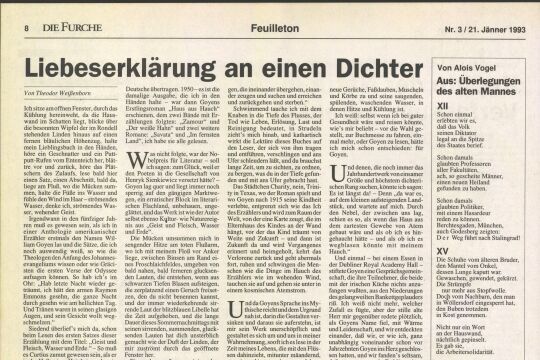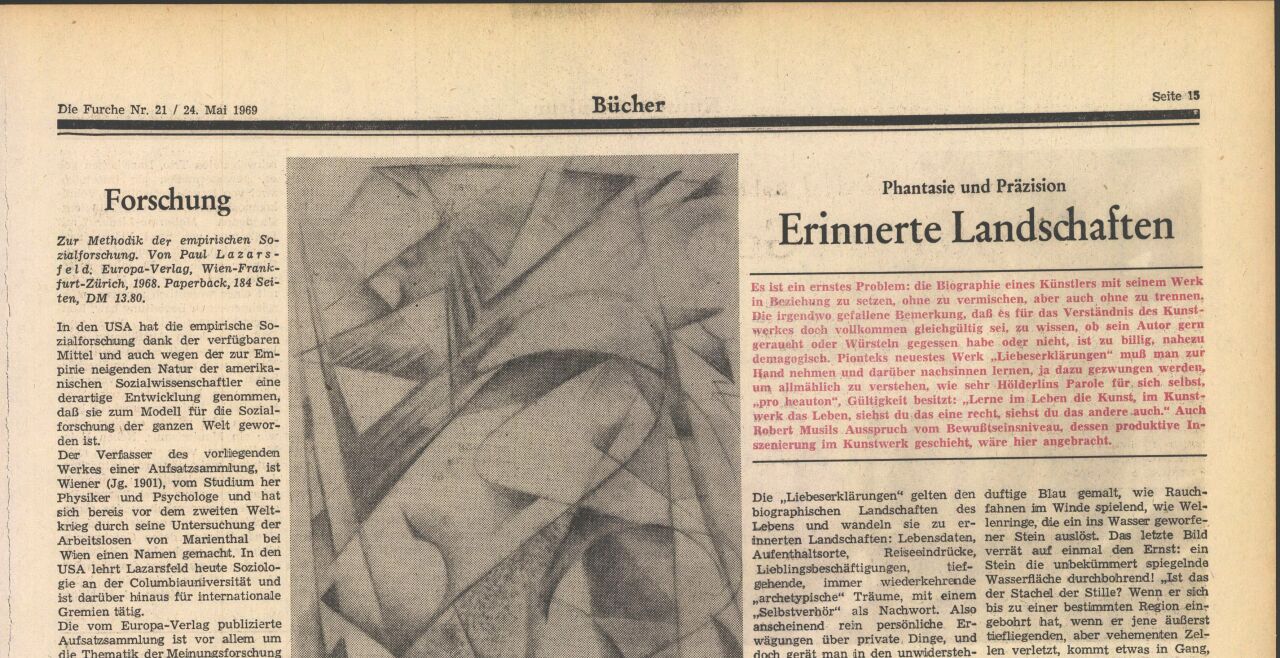
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Erinnerte Landschaften
Es ist ein ernstes Problem: die Biographie eines Künstlers mit seinem Werk in Beziehung zu setzen, ohne zu vermischen, aber auch ohne zu trennen. Die irgendwo gefallene Bemerkung, daß es für das Verständnis des Kunstwerkes doch vollkommen gleichgültig sei, zu wissen, ob sein Autor gern geraucht oder Wursteln gegessen habe odep nicht, ist zu billig, nahezu demagogisch. Pionteks neuestes Werk „Liebeserklärungen“ muß man zur Hand nehmen und darüber nachsinnen lernen, ja dazu gezwungen werden, um allmählich zu verstehen, wie sehr Hölderlins Parole für, sich selbst, „pro heauton“, Gültigkeit besitzt: „Lerne im Leben die Kunst, im Kunstwerk das Leben, siehst du das eine recht, siehst du das andere auch.“ Auch Robert Musils Ausspruch vom Bewußtseinsniveau, dessen produktive Inszenierung im Kunstwerk geschieht, wäre hier angebracht.
Es ist ein ernstes Problem: die Biographie eines Künstlers mit seinem Werk in Beziehung zu setzen, ohne zu vermischen, aber auch ohne zu trennen. Die irgendwo gefallene Bemerkung, daß es für das Verständnis des Kunstwerkes doch vollkommen gleichgültig sei, zu wissen, ob sein Autor gern geraucht oder Wursteln gegessen habe odep nicht, ist zu billig, nahezu demagogisch. Pionteks neuestes Werk „Liebeserklärungen“ muß man zur Hand nehmen und darüber nachsinnen lernen, ja dazu gezwungen werden, um allmählich zu verstehen, wie sehr Hölderlins Parole für, sich selbst, „pro heauton“, Gültigkeit besitzt: „Lerne im Leben die Kunst, im Kunstwerk das Leben, siehst du das eine recht, siehst du das andere auch.“ Auch Robert Musils Ausspruch vom Bewußtseinsniveau, dessen produktive Inszenierung im Kunstwerk geschieht, wäre hier angebracht.
Die „Liebeserklärungen“ gelten den biographischen Landschaften des Lebens und wandeln sie zu erinnerten Landschaften: Lebensdaten, Aufenthaltsorte, Reiseeindrücke, Lieblingsbeschäftigungen, tiefgehende, immer wiederkehrende „archetypische“ Träume, mit einem „Selbstverhör“ als Nachwort. Also anscheinend rein persönliche Erwägungen über private Dinge, und doch gerät man in den unwiderstehlichen Sog dieser Ereignisse, wird von den Liebeserklärungen an sie, sei es auch nur an den Rauch der Pfeife, erfaßt und steht plötzlich „nach Worten suchend“ vor „erinnerten Landschaften“, vor „Kennworten“ jedes Lebens: „Wir alle, die wir lesen, suchen wir nicht aus der Übereinstimmung mit dem Gelesenen Mut zu schöpfen? Solidarität: das Menschenmögliche der Dichtung.“ Auf den letzten Seiten der „Träume“ und des „Selbstverhörs“ angelangt schlägt alles um: nicht mehr die private Biographie eines Dichters haben wir gelesen, sondern das Gültige einer Dichtung. Doch jetzt keine falschen Schlüsse: Piontek ist alles andere als ein „engagierter“ Dichter, der Partei ergriffe oder Lebenshilfe, gar Pädagogik böte. Dafür ist seine Symbolsprache — Rauchfahnen, Wasserfarben, Düfte und Perspektiven — viel zu „leicht“, wiegt letztlich aber schwerer als der pathetische Ernst akademischer oder politischer Programme, sie formuliert Liebeserklärungen, in ihrem Plural anscheinend wie leichtfertig klingende Schellen, in ihrer Liebe aber alles zu Grunde ziehend, zu Grunde gehend. , ■
Piontek hütet sich vor „tiefsinnigen“ Liebeserklärungen, ein Hauch von Unbekümmertheit und Verliebtheit um Dinge, „die in der Geschichte unserer Zärtlichkeit eine Rolle gespielt haben“, mit Wasserfarben ins duftige Blau gemalt, wie Rauchfahnen im Winde spielend, wie Wellenringe, die ein ins Wasser geworfener Stein auslöst. Das letzte Bild verrät auf einmal den Ernst: ein Stein die unbekümmert spiegelnde Wasserfläche durchbohrend! „Ist das der Stachel der Stille? Wenn er sich bis zu einer bestimmten Region einr gebohrt hat, wenn er jene äußerst tiefliegenden, aber vehementen Zellen verletzt, kommt etwas in Gang, das sich in ausgedaehten Wörtern Luft schafft“
Der Schauplatz der Spiele, „ihr leichtes Gestöber aus Atemlosigkeit und Herzenslust“, wird durch das Wort, das, den Reflex der Spiele reflektierend zu fassen suchend, plötzlich stockt und „buchstabiert“, zum bestürzenden Schicksalsort, zur „schiefen Ebene“, hinabreißend und „nicht mehr aufzuhalten“, „in das dunkle Loch der Geschichte“. Das letzte „Kolleg über den Rauch“ führt es unter Chiffre aus: in Rauch aufgehend, im Winde schweifend, die Luft verpestend, von lebendigem Herdfeuer zeugend, Opferrauch. „Rauch ist gewichtlos gewordene Welt. Er gehört zu den Sachen, die über sich hinausweisen, etwas anderes meinen. Das hat er mit der Sprache gemein. Aber was ist er wirklich? Das, was einmal Feuer gewesen istt,„Heute, habe ich, nicht mehr ,ajs, den Rauch meiner Pfeife... 'Rauchend und schreibend sehe ich zu, wie sich etwas verzehrt, um dann neu aus der Asche zu steigen': leicht, nicht zu fassen.“ Und doch liegt dort unsere Heimat. „Bin ich nun auf heimatlichen Boden? Endlich zu Hause?“ Jedenr falls an einem Ort „menschlicher als die Welt“.
Kürzlich hörten wir vom Mond als einer Welt von grandioser Öde, einem gräßlichen Leichnam im All. Viele bezweifeln daher, daß man von ihm heute noch dichten könnte, als dem geheimen Verbündeten der Liebenden. Er steht für eine Welt auf der „schiefen Ebene“. Und doch ist es möglich. Man lese Pionteks Deutung des alten Romantikerliedes „Bei einem Wirte wuindermild“ und das Gedicht ,An die Schüler Heisenbergs“ (aus „Klariert“). Manche Gedichtarten mögen in Verruf geraten sein, „die Arbeitsgänge sind heute komplizierter und langwieriger denn je“. Doch der „utopische Gedanke“ einer Vereinigung von „Phantasie und Präzision“, auch in Liebeserklärungen, macht es möglich. Die Prosaerzählungen Pionteks, in der „Furche“ ausführlich besprochen (6, 1964), jetzt neu gesammelt, auch aus längst vergriffenen Bänden, unter dem Titel „Außenaufnahmen“, verraten ebenfalls den „durchscheinenden Grund einer Sinnfigur“; ihre Sprache keineswegs epische Breite, sondern buchstabierende Genauigkeit, Phantasie und Präzision, dichterische Verwandlung und Klartext, seltene Einheit von exakter Beobachtung, strengem Wahrheitswillen und verwandelnder Phantasie des Dichters, Schönheit als zweckloses Spiel und „als etwas Anstößiges, an dem sich die Geister scheiden“, eine Balance, die ihm die Bezeichnung „Klassiker der jungen Generation“ eingebracht hat, Alfred Pocke
LIEBESERKLÄRUNGEN, IN PROSA. Von Heinz Piontek, Hoff-mann und Campe, Hamburg, 1969, 215 S., Ln. DM 14.80. — AUSSEN-AUFNAHMEN, ERZÄHLUNGEN, von Heinz Piontek, Signal-Verlag Hans Frevert, Baden-Baden, 1968, 168 Seiten, Taschenbuch der Signal-Bücherei, Band 11.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!