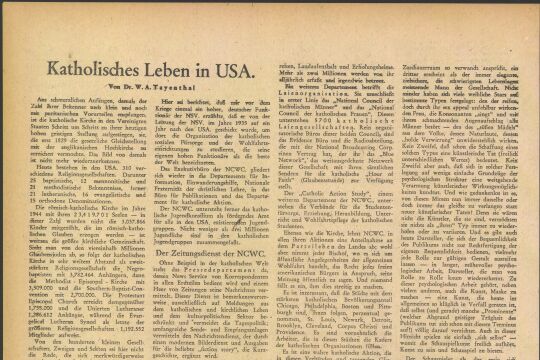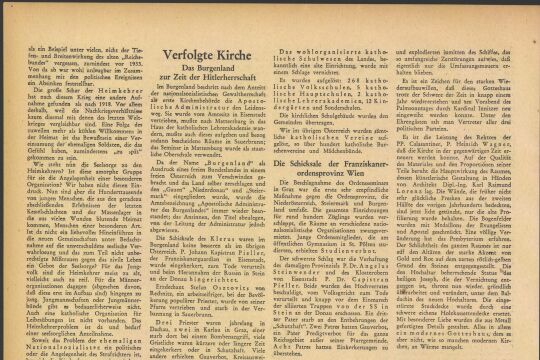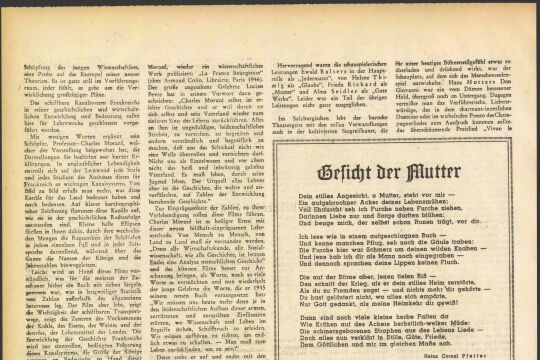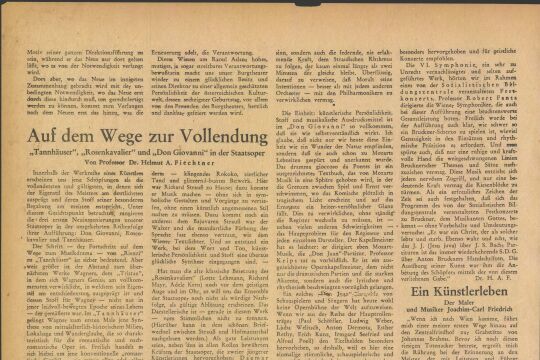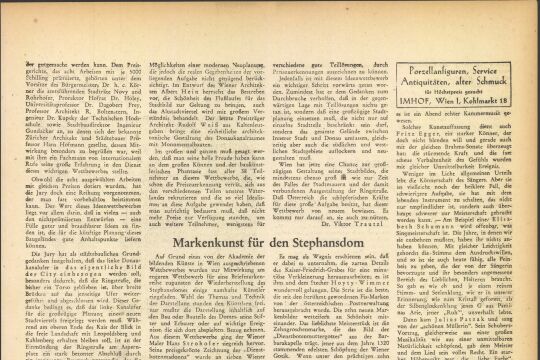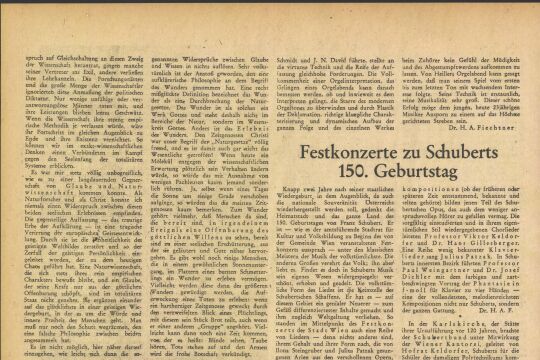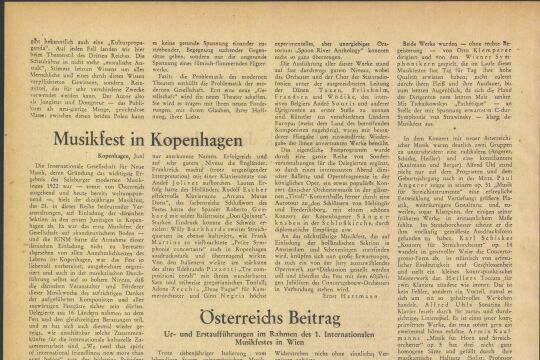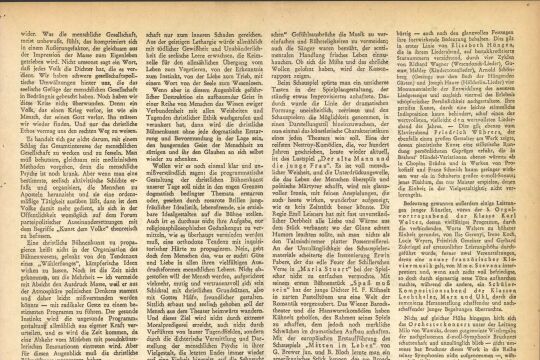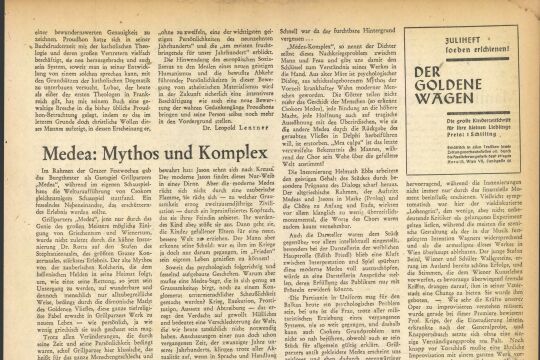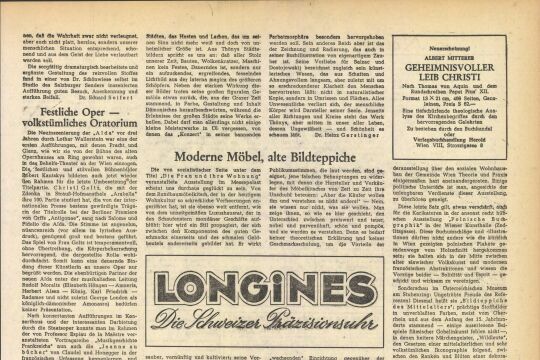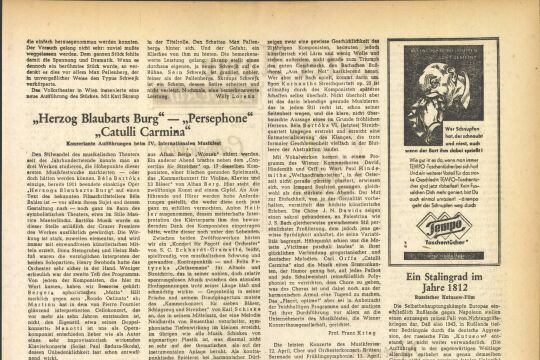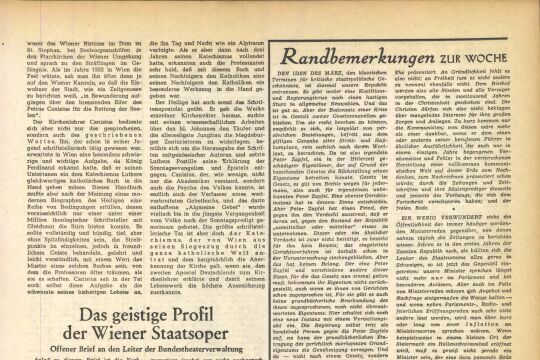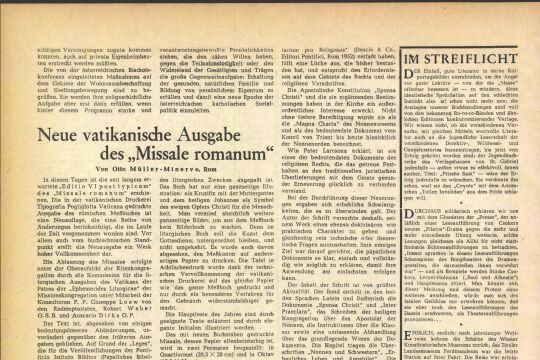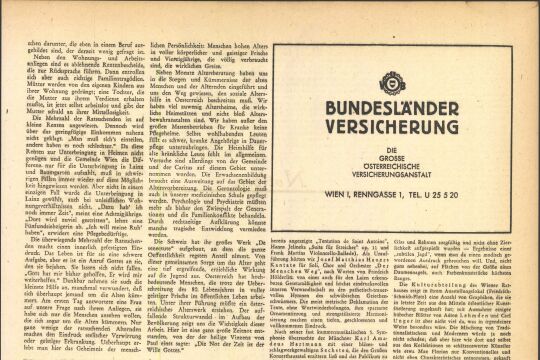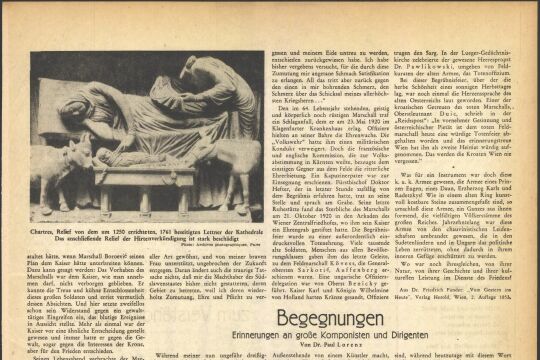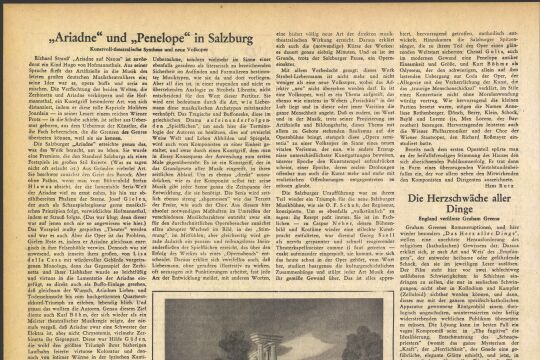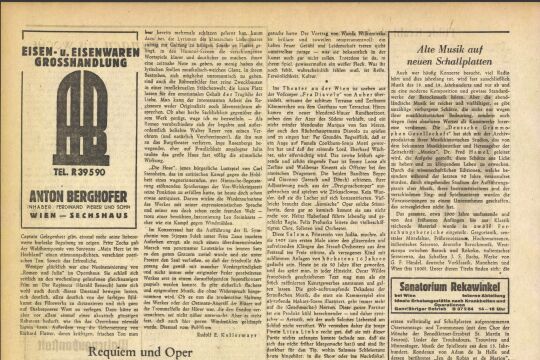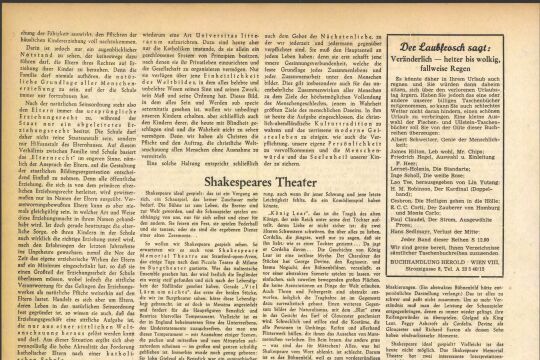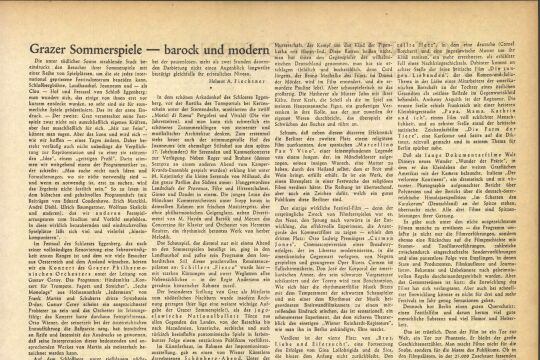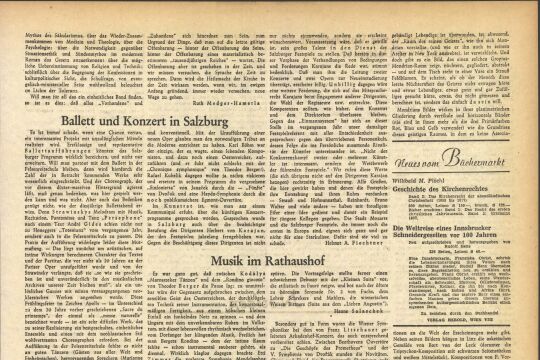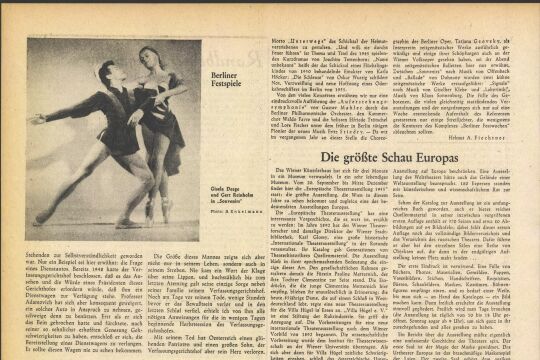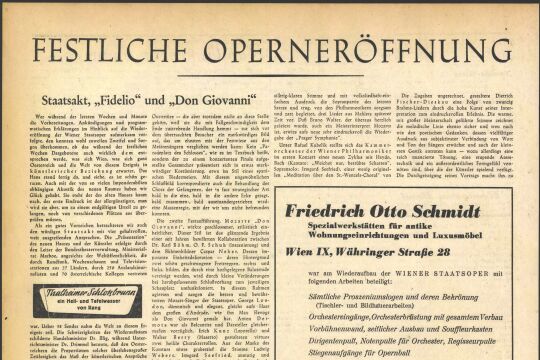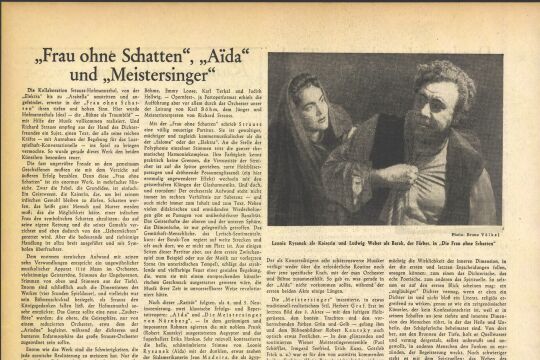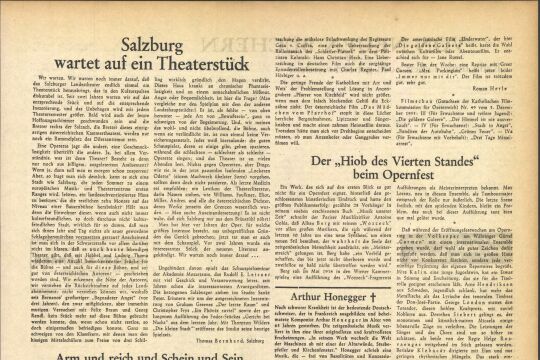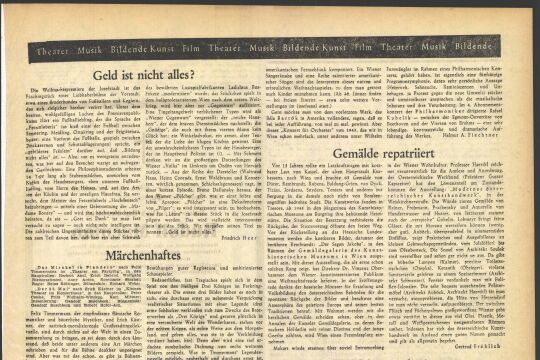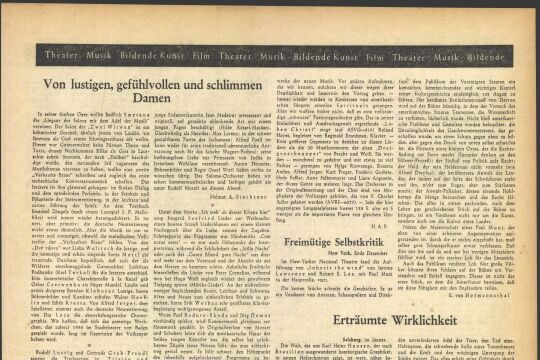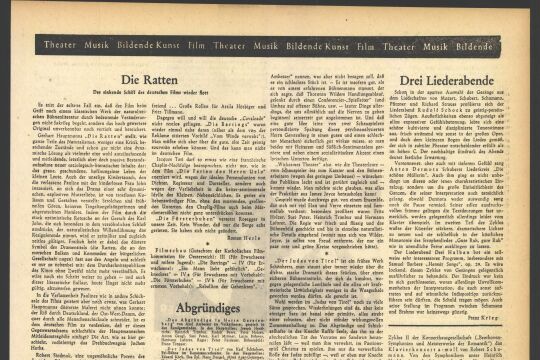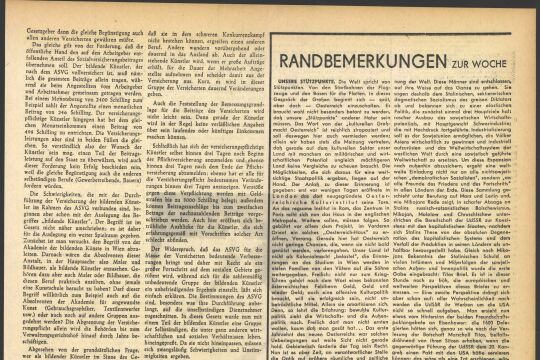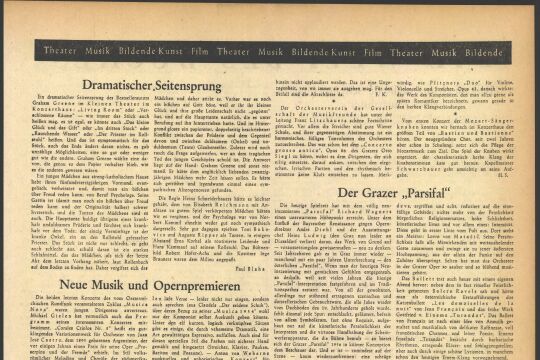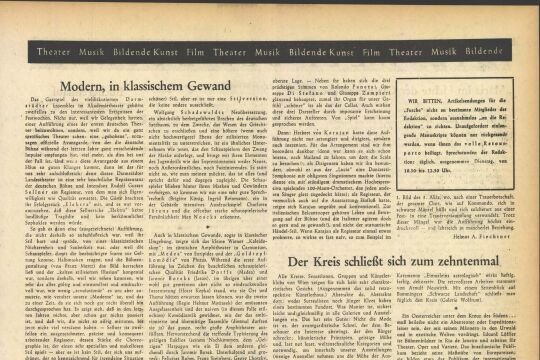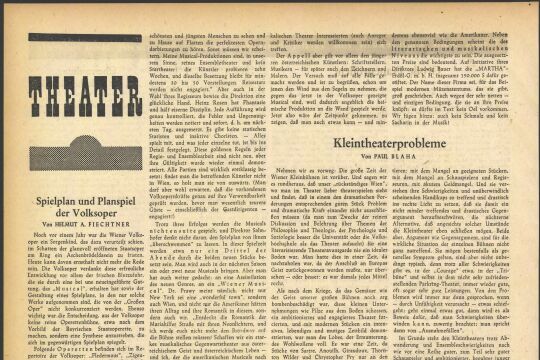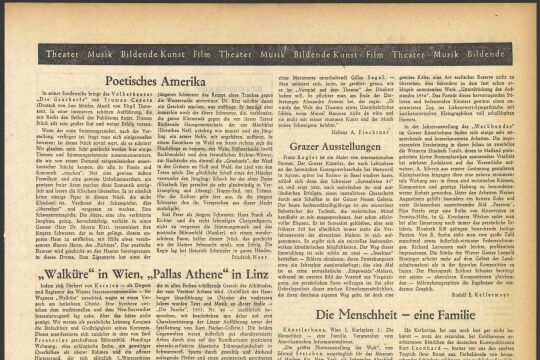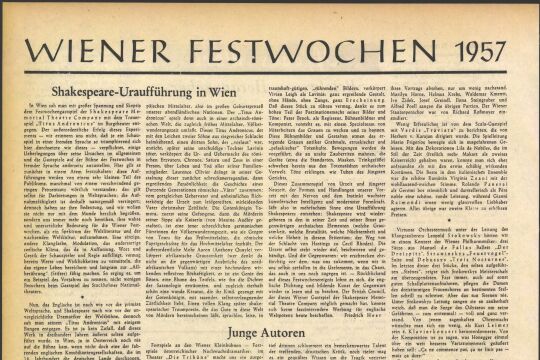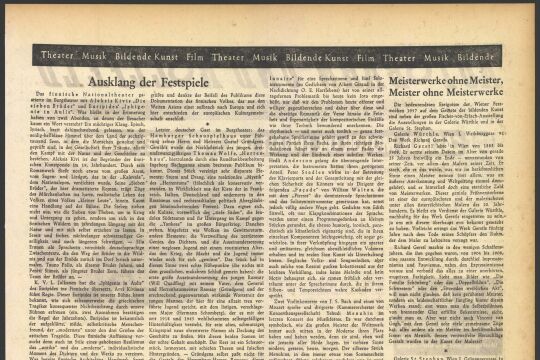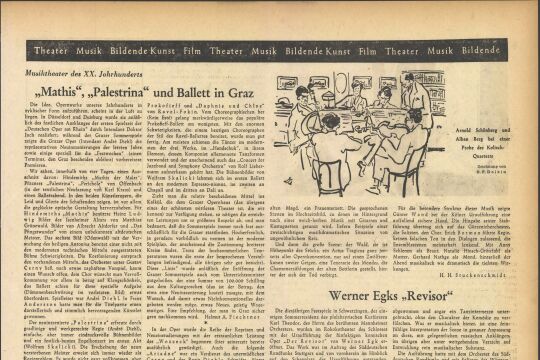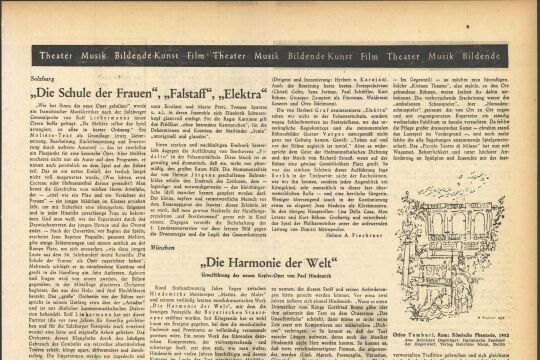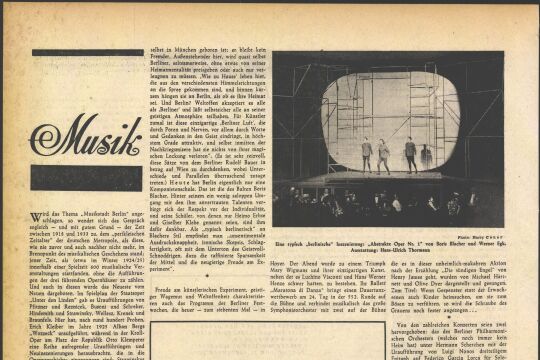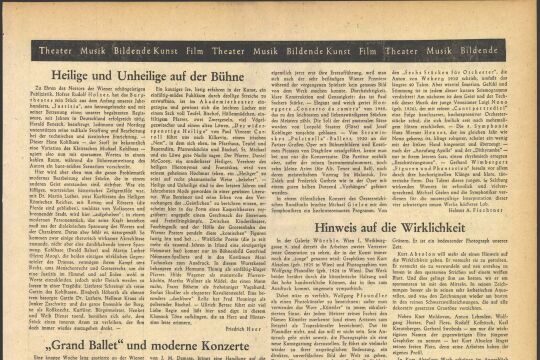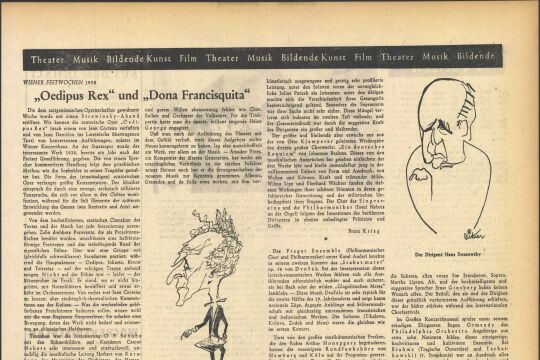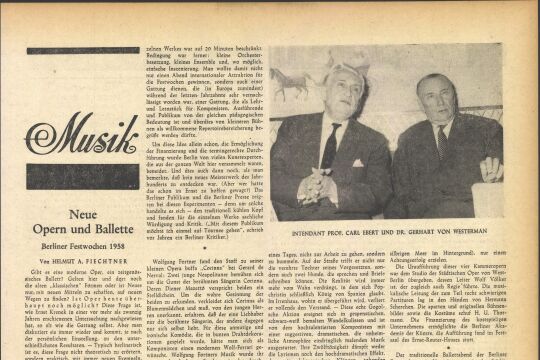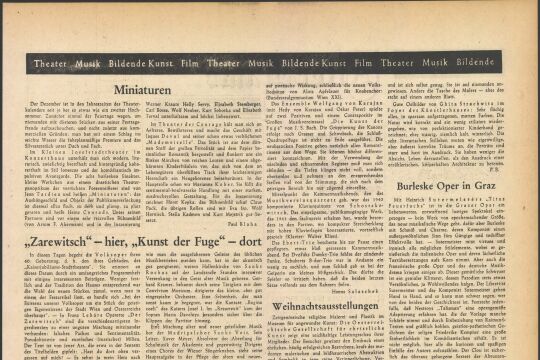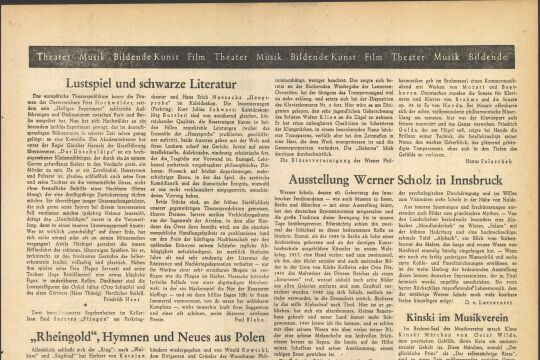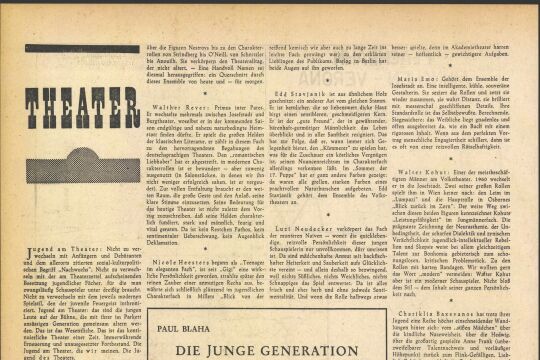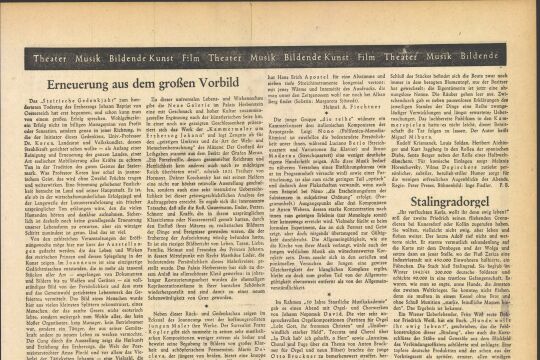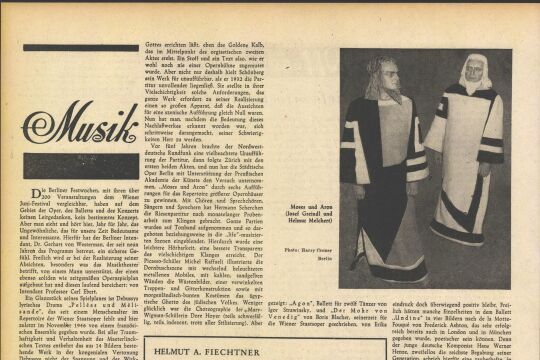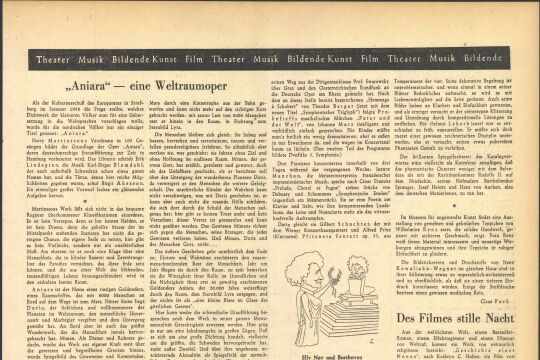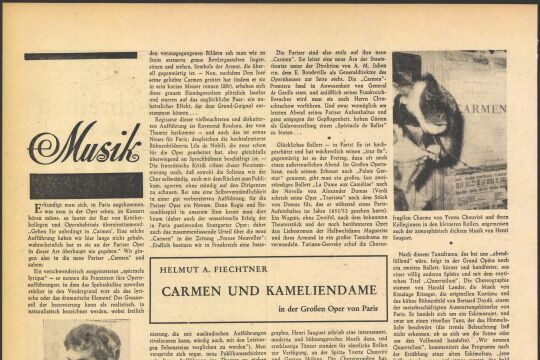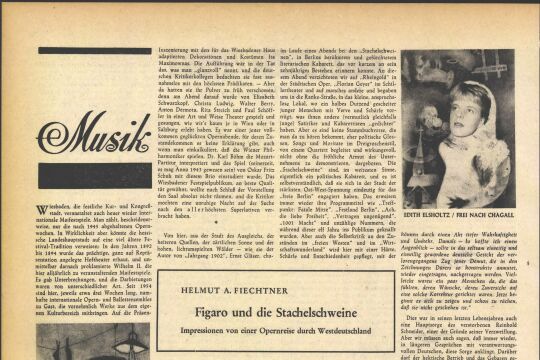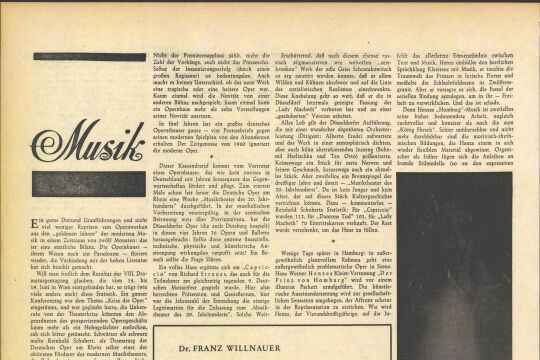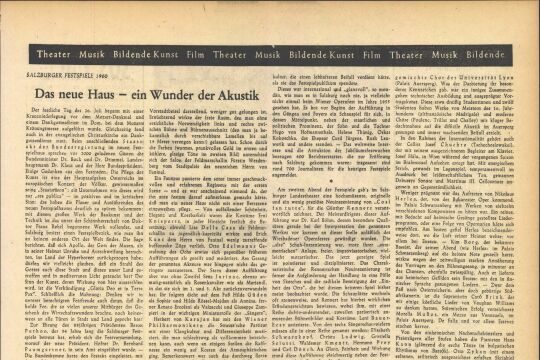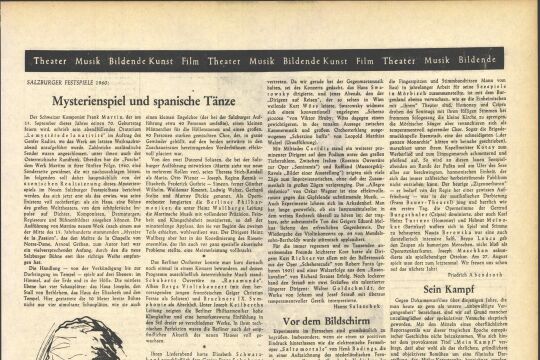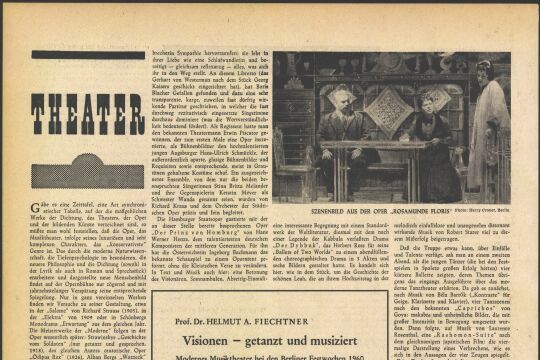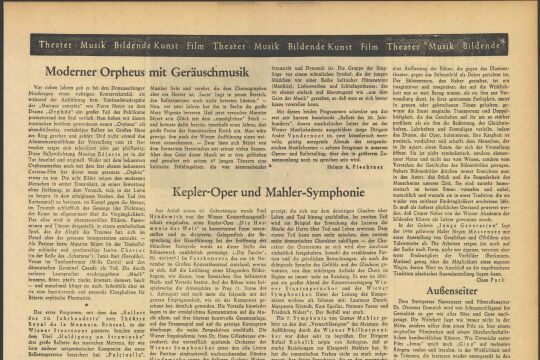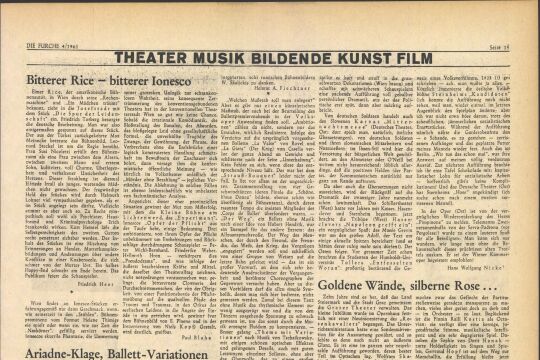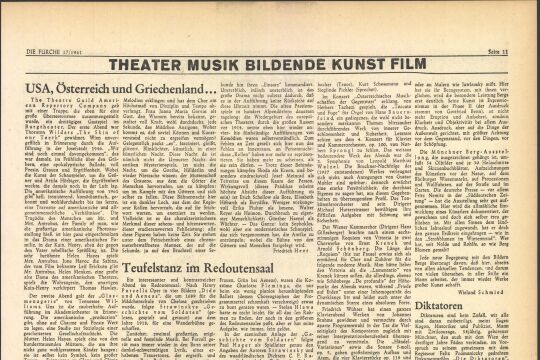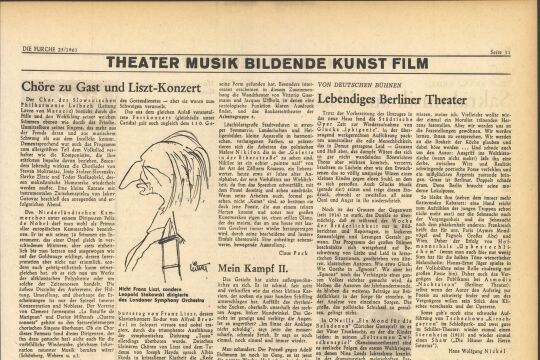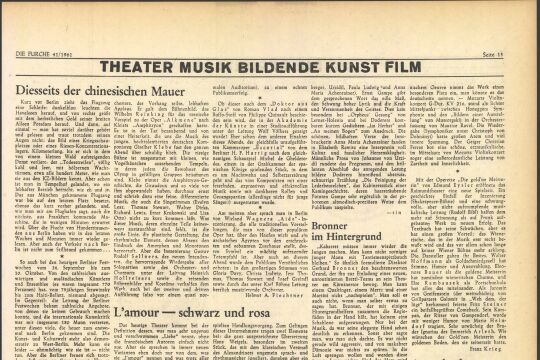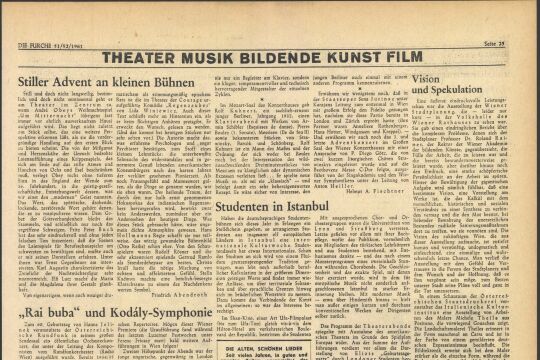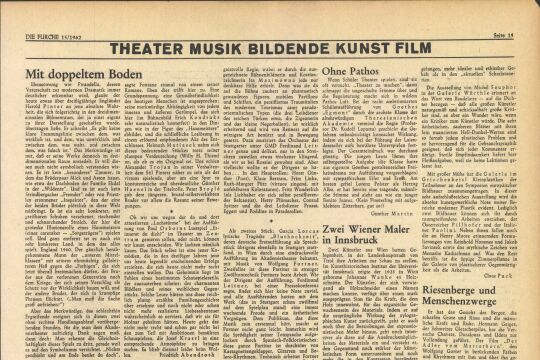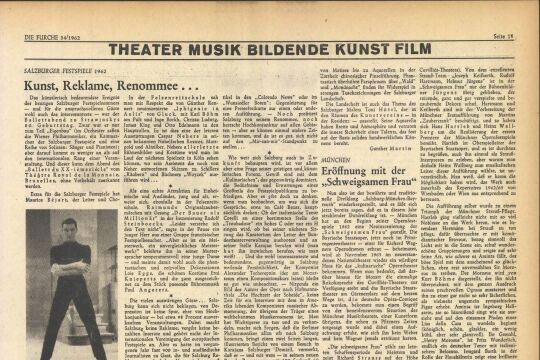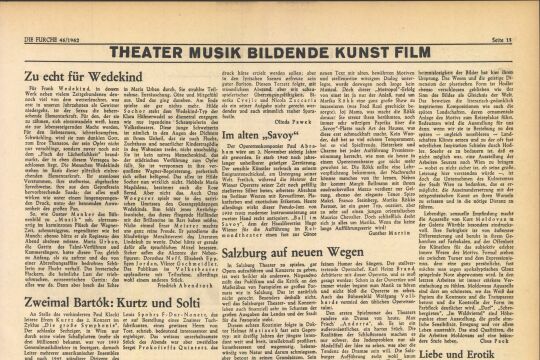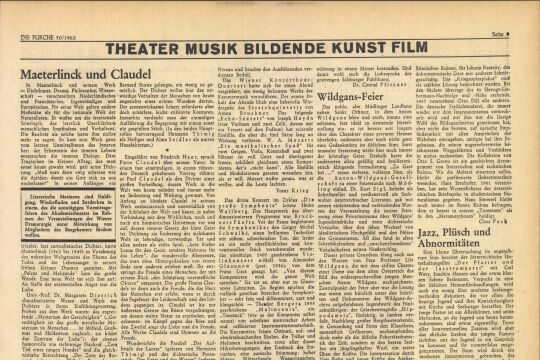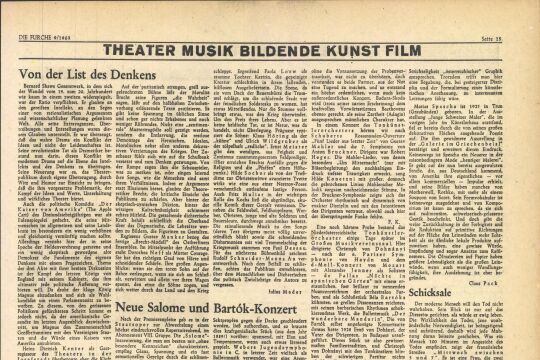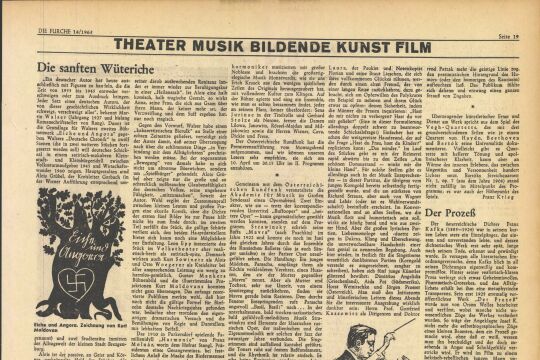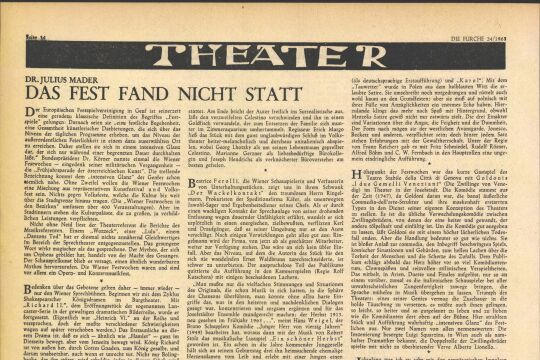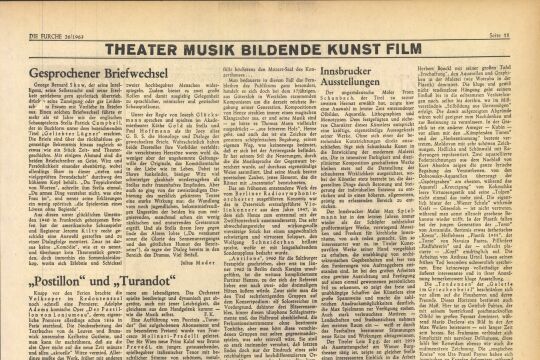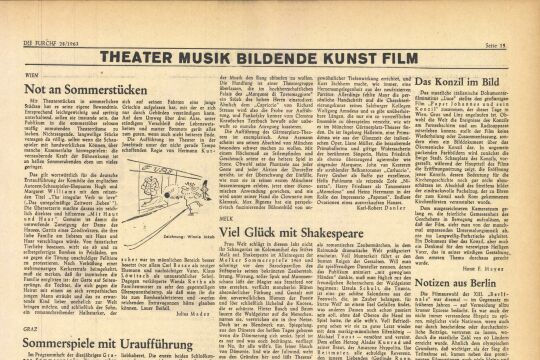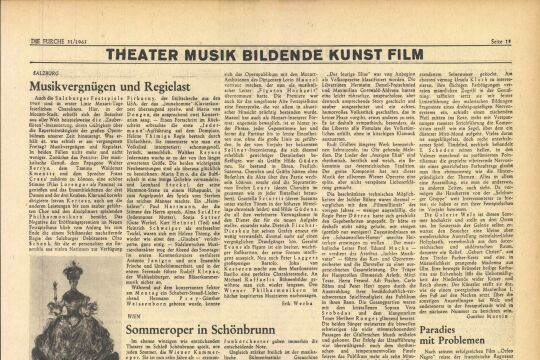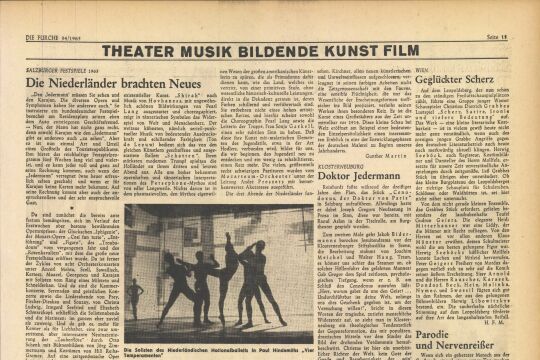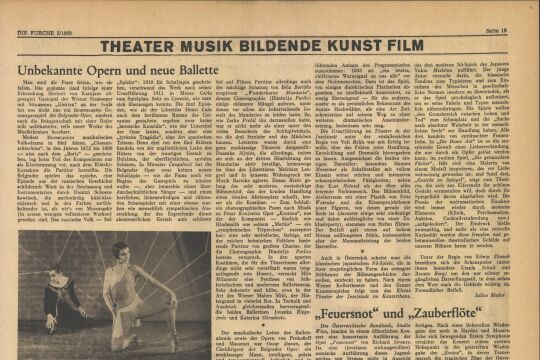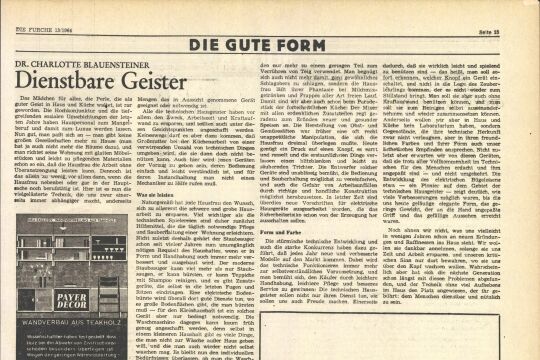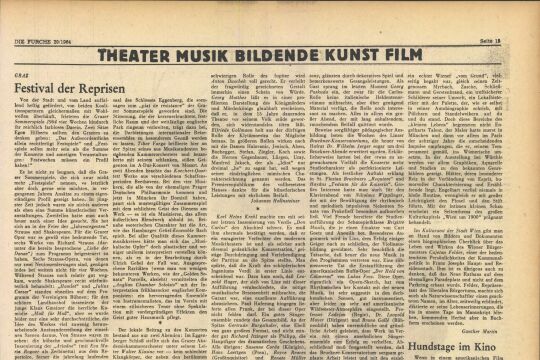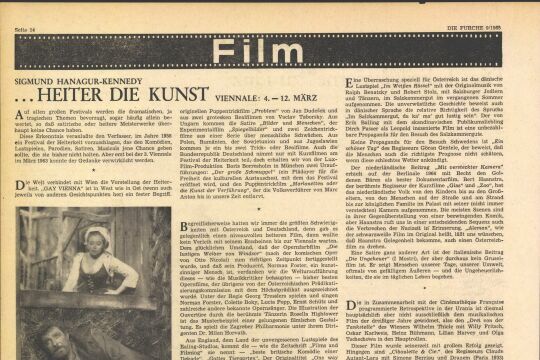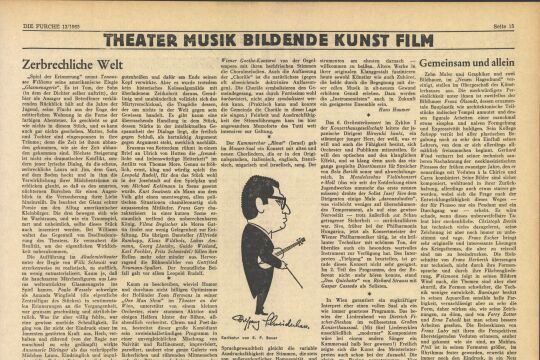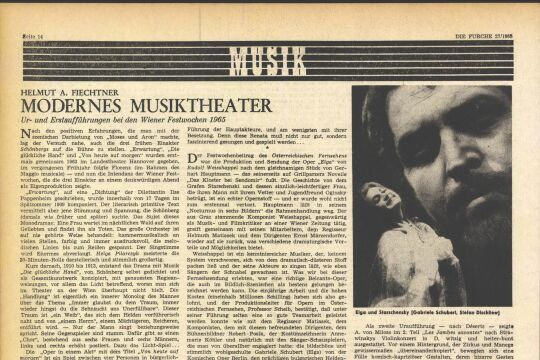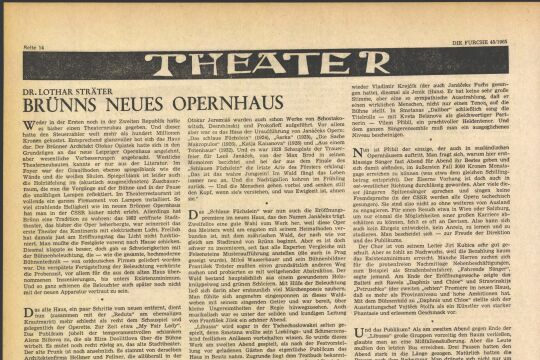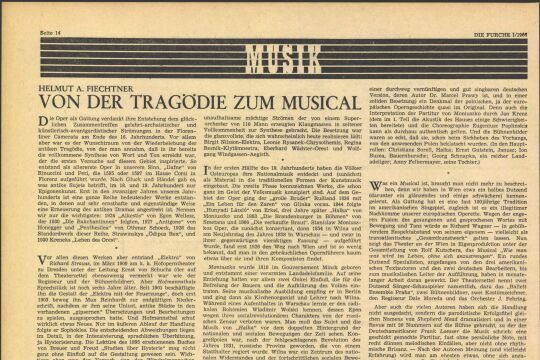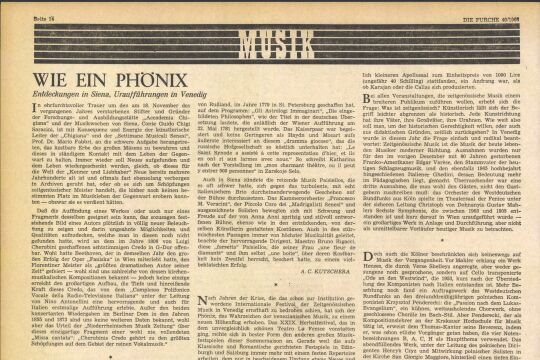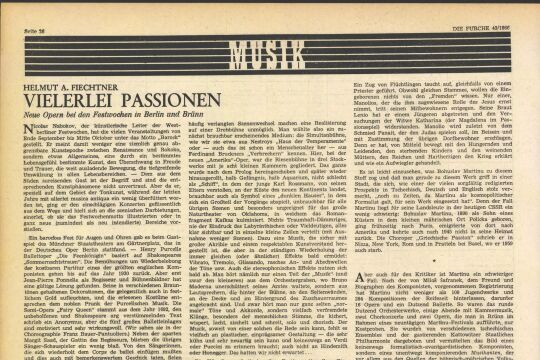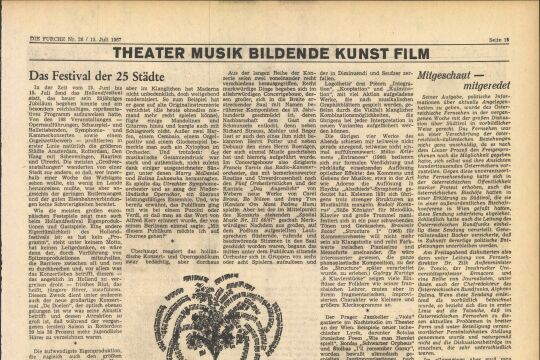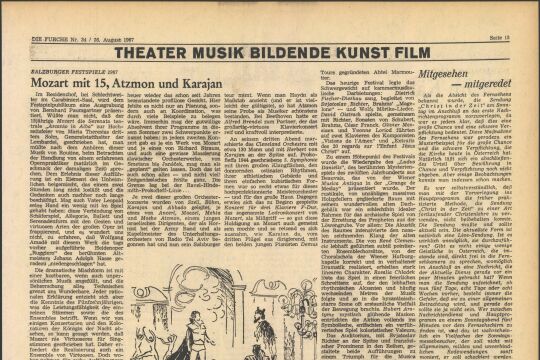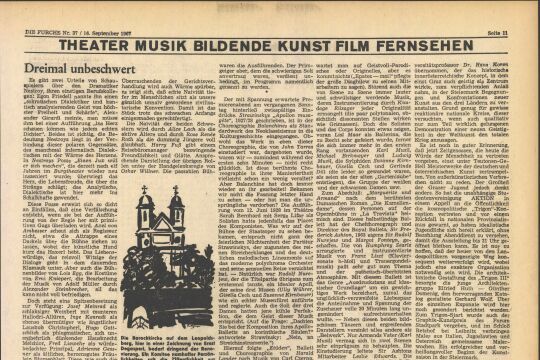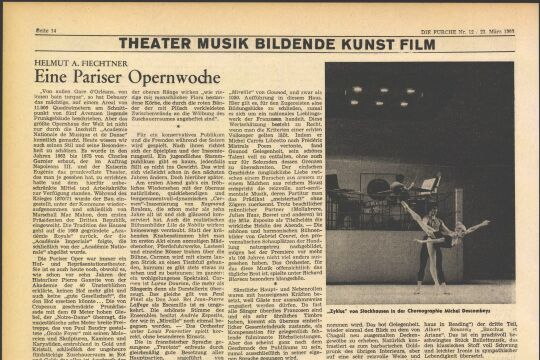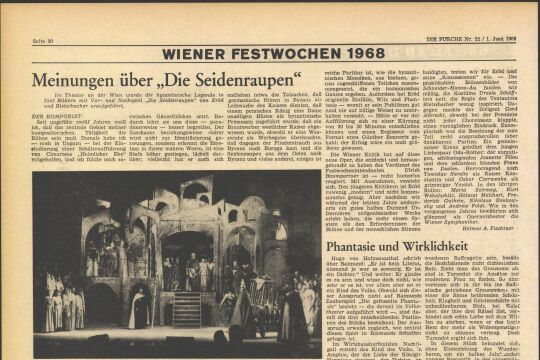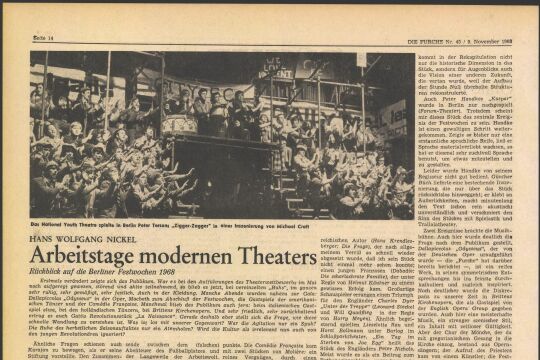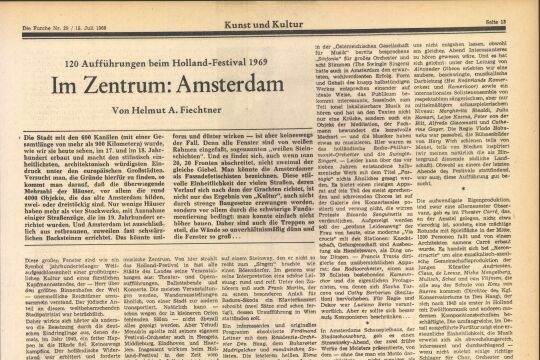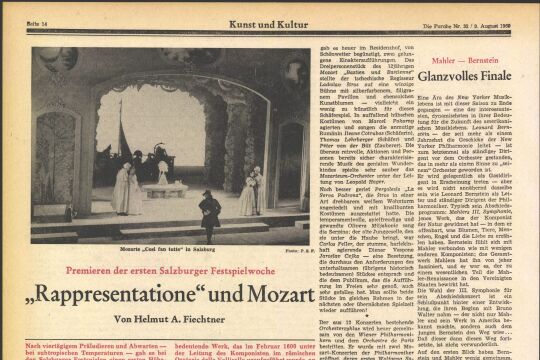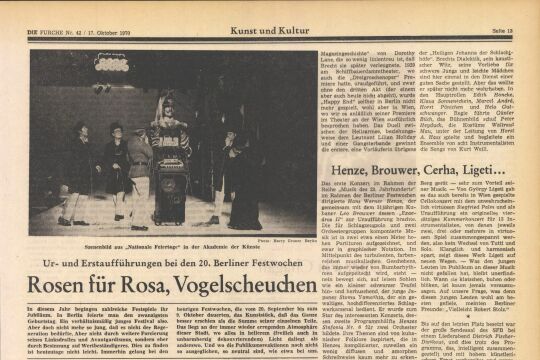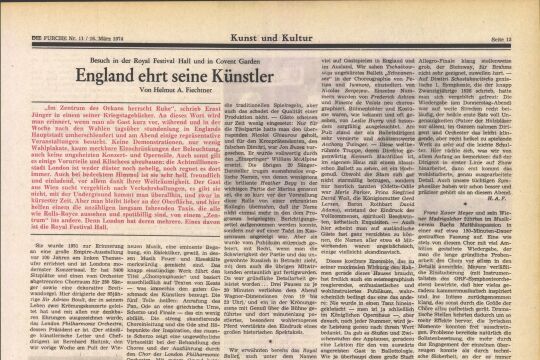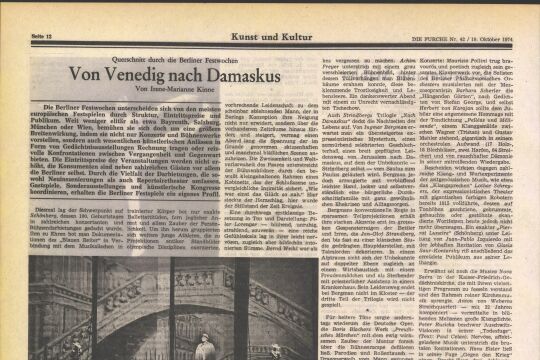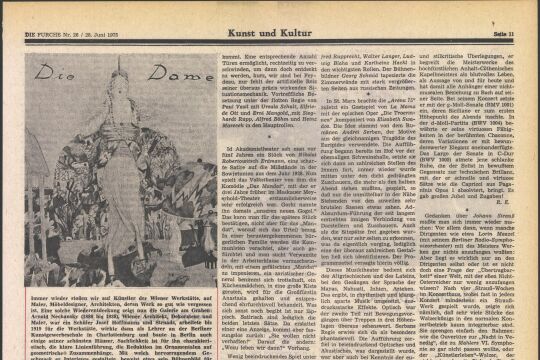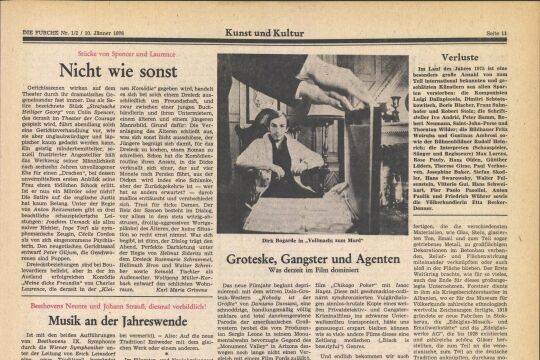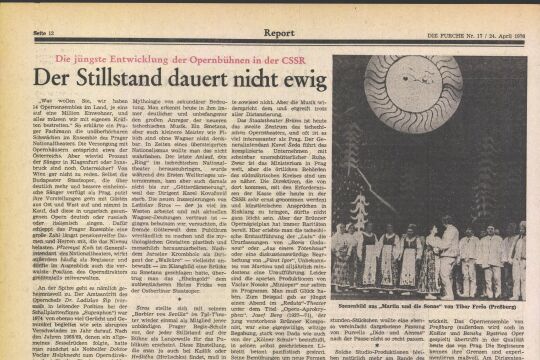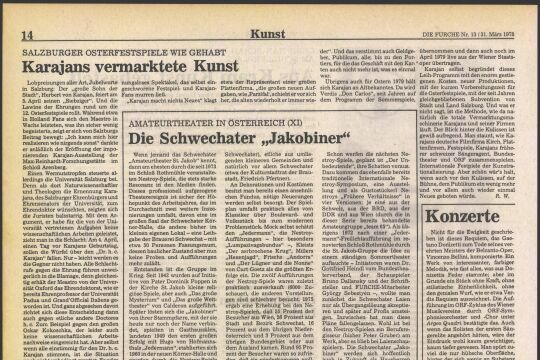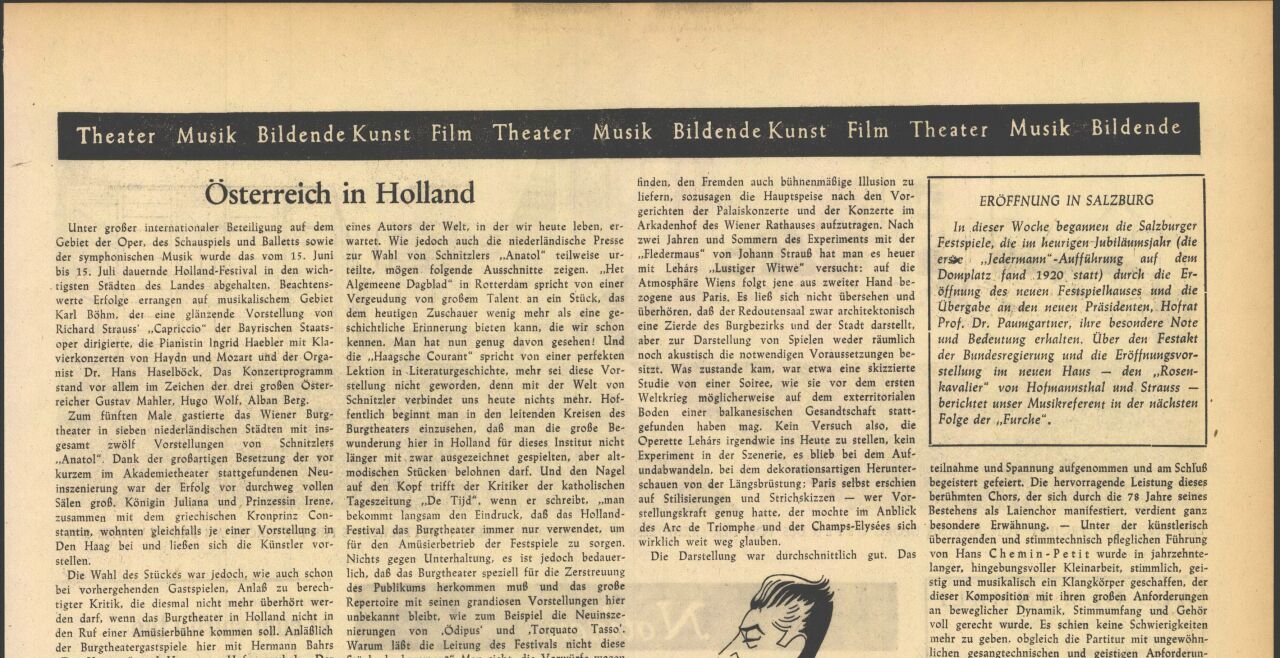
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
In Schonbrunn und am Josef splatz
„Kammeroper ist für uns nicht ein geschichtlicher Werktypus, sondern eine Art, Oper zu spielen und zu gestalten.“ Dieser, dem hübschen Programmheft entnommene Satz ist für sich ein Programm, das der Wiener Kammeroper in den sieben Jahren ihres Bestehens das Profil und den größten Teil ihrer Erfolge eingetragen hat. Wo sie ihm treu bleibt, wird sie in der Tat ein Notwendiges erfüllen, das im. Wiener Musikleben ebenso seinen Platz hat wie die große Oper. Auch ihre andere Aufgabe, die Herausstellung junger Talente, ist vom Glück begünstigt. Man hat sich daran gewöhnt, die sommerlichen Opernabende im Schönbrunner Schloßtheater als dazugehörig zu empfinden: zum Sommer, zum bestechend eleganten Raum, zum Wiener Theater. Mit zwei Kammeropern von D o n i z e 11 i holte sich das Ensemble einen ganz großen Erfolg. „Die Nachtglocke“ („II Campanello“) ist die Geschichte einer gestörten Hochzeitsnacht, darin besonders Norman Bailey als Apotheker Pistacchio und Franz Ramharter als Enrico ausgiebige Gelegenheit zu gesanglichen und schauspielerischen Leistungen haben und ihren diffizilen Aufgaben erfreulich gut entsprechen. Die „Hustenarie“ ist direkt als ein heileres, aber sehr anspruchsvolles Unikum zu bezeichnen. Regie (Peter Weihs), Bühnenbild (Harry Glück) und Kostüme (Beate Becker) sind mit Spiel und Musik so glücklich abgestimmt, das nirgends ein Leerlauf entsteht und der Zuhörer in fröhlichster An-geregtheit-mitgeht. Noch gesteigert wird Tempo und Unmittelbarkeit im zweiten Einakter des Abends, der „Rita“, die einem guten Einfall zufolge in Kostümen der Gegenwart gespielt wurde. Die sehr resche Wirtin Rita, die ihren zweiten Mann prügelt, weil sie vom ersten geprügelt wurde, der, tot geglaubt, plötzlich wieder auftaucht und sich nun mit seinem Nachfolger duellieren will, wer bei der „hantigen“ Frau zu verbleiben hat — diese Rita wird von Rut Jacobson mit überzeugender Verve gespielt und mit hübscher Stimme gesungen. Ihre beiden Partner Gale D o s s und Norman Bailey verdienen das gleiche Lob, kein geringeres der temperamentvolle Dirigent Hans Gabor, der wirklich „die Szene“ beherrscht, und das hörbar animiert spielende Wiener Rundfunkorchester. — Weniger glücklich war die Wahl der „Gärtnerin aus Liebe“ von dem damals 19jährigen Mozart. Die Oper ist kein starkes Werk, obschon nicht selten bereits der echte Mozart durchbricht. Länge und Spannungslosigkeit machen es den Darstellern — und auch den Zuschauern — schwer. Dessenungeachtet taten die Darsteller ihr Bestes — und auch die Zuschauer: sie nahmen den Willen für die Leistung. Aus der großen Zahl der Darsteller seien genannt: Herbert Prikopa als dicker Podesta, Ursula W e n d t als Armida, Ruth Hohn er als Ramiro, Hermine Biedermann als Sandrina, Hans B e r n e r als Belfiore.
Die Sommergastspiele im Redoutensaal am Josefsplatz haben die Aufgabe, in der Zeit, da die Opernhäuser gesperrt sind und auswärts Festspiele stattfinden, den Fremden auch bühnenmäßige Illusion zu liefern, sozusagen die Hauptspeise nach den Vorgerichten der Palaiskonzerte und der Konzerte im Arkadenhof des Wiener Rathauses aufzutragen. Nach zwei Jahren und Sommern des Experiments mit der „Fledermaus“ von Johann Strauß hat man es heuer mit Lehärs „Lustiger Witwe“ versucht: auf die Atmosphäre Wiens folgt jene aus zweiter Hand bezogene aus Paris. Es ließ sich nicht übersehen und überhören, daß der Redoutensaal zwar architektonisch eine Zierde des Burgbezirks und der Stadt darstellt, aber zur Darstellung von Spielen weder räumlich noch akustisch die notwendigen Voraussetzungen besitzt. Was zustande kam, war etwa eine skizzierte Studie von einer Soiree, wie sie vor dem ersten Weltkrieg möglicherweise auf dem exterritorialen Boden einer balkanesischen Gesandtschaft stattgefunden haben mag. Kein Versuch also, die Operette Lehärs irgendwie ins Heute zu stellen, kein Experiment in der Szenerie, es blieb bei dem Auf-undabwandeln, bei dem dekorationsartigen Herunterschauen von der Längsbrüstung; Paris selbst erschien auf Stilisierungen und Strichskizzen — wer Vorstellungskraft genug hatte, der mochte im Anblick des Are de Triomphe und der Champs-Elysees sich wirklich weit weg glauben.
Die Darstellung war durchschnittlich gut. Das Beste in musikalischer Hinsicht boten die Chöre (Wiener Voiksoper) und das unter schwierigen Ratint-verhältnissen vortreffliche Leistungen bietende Ballett der Wiener Volksoper (Choreographie Dia Lucca). Das Orchester der Niederösterreichischen Tonkünstler unter dem Dirigenten Franz Bauer-Theußl hatte neben dunklen Augenblicken doch wieder leuchtende. Von den Sängern und Darstellern heimste Johannes Heesters den Hauptapplaus ein — er ist mehr Schauspieler als Sänger —, nach ihm konnten Mimi Coertse (Hanna Glawari) und Christine Widmann (Valencienne) sowie die Herren Szemere, Rus und Muliar gefallen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!