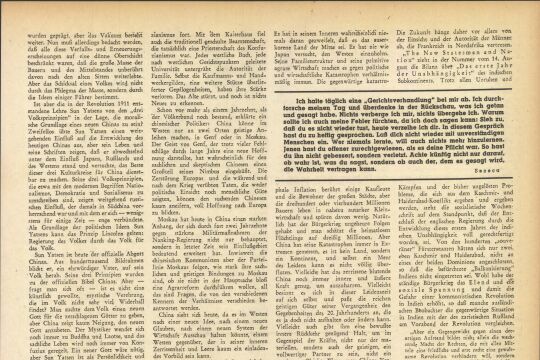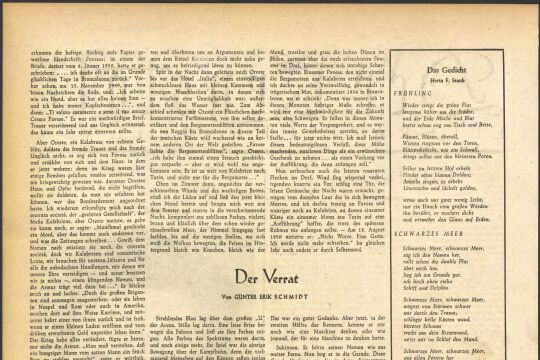Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Naipaul: Ein Inder, schockiert in Indien
Spät, aber doch erschien nun in deutscher Übersetzung V. S. Nai-pauls Auseinandersetzung mit dem Land seiner Großeltern, dem Land seiner Sehnsucht. Er war bis dahin nie Inder unter Indern gewesen, immer Inder in einem Rassengemisch, immer einer, der aus der Menge hervorstach - in London ebenso wie in Trinidad, wo er auf die Welt gekommen und aufgewachsen war. Indien war immer das „mystische Land meiner Kindheit” gewesen, aber als er dort zum ersten Mal ankam, erlebte er einen Kulturschock: „Ich hatte kein Gesicht mehr. Ich hätte spurlos in dieser indischen Masse untergehen können.” Er war plötzlich ein Mensch, der nicht von der Masse abstach, einfach ein Inder unter Indern: „Es war als hätte man mir einen Teil meiner Realität genommen.”
Obwohl er, der dies erlebte, V. S. Naipaul hieß, wurde sein vor 33 Jahren in England erschienenes Buch über die erste Begegnung mit Indien erst jetzt ins Deutsche übersetzt. Seltsam, daß es dazu überhaupt eines Anlasses bedurfte - „Land der Finsternis: fremde Heimat Indien” erreicht uns im Jahr, da Indien den 50. Jahrestag der Unabhängigkeit feiert.
In einer ungemein malerischen Sprache läßt er den Leser seine Begegnung mit dem Land der Vorfahren miterleben. Indien überfällt ihn bei der Ankunft in Bombay so, wie es auch andere Touristen überfällt - mit lähmender Hitze, „ bebender Armut”, unverständlicher Andersartigkeit. Für ihn kommt aber dieses Untergehen in der Masse dazu, das für ihn keineswegs ein positives Erlebnis ist: „Trinidad und England hatten mich hervorgebracht, und ich brauchte es, in meiner Andersartigkeit erkannt zu werden.” Er reist kreuz und quer durch den Subkontinent, erlebt ihn
überaus ambivalent, zuerst meistens abgestoßen. Seine Sicht verändert sich. Erst am Ende der einjährigen Beise besucht er das Dorf seines Großvaters. Er ist sich bewußt, daß er dieses Dorf bei der Ankunft in Indien als arm und schmutzig empfunden hätte, jetzt sieht er ein reiches, gut si-tuiertes, sauberes Dorf, eben ein Brahmanendorf: eines der vielen Beispiele, anhand deren er die Veränderung seiner Sicht in diesem Jahr beschreibt. Die Reise endet mit einer inneren Krise, mit Situationen, in denen sich Naipaul - wie er selber weiß, und worin ihm der Leser auch rechtgibt - wie ein überheblicher reicher Sahib benimmt, und mit der überstürzten Abreise. Das Kapitel heißt mit gutem Grund „Flucht”.
„Land der Finsternis” ist ein eindringliches, sehr persönliches Buch über Heimatlosigkeit und über die Probleme der Suche nach Wurzeln in einem Land der Väter, das nur in Erzählungen und Vorstellungen lebte, und über den Sturm der Gefühle, den der „Heimkehrer” erlebt, wenn die Wirklichkeit den Hoffnungen und Vorstellungen so gar nicht entspricht, wenn die Identifikation nicht gelingt. Aber auch in England ist er, „konfrontiert mit der Leere in mir, mit dem Gefühl, mich verirrt zu haben”, nicht mehr - oder noch nicht? - zu Hause: „Einige Tage später, in London, stellte ich mich zum erstenmal wieder einer Kultur, deren ganzes Trachten - nach den Schaufensterauslagen und Reklamebildern zu urteilen - dahin ging, Heime zu schaffen: lauter säuberlich getrennte, beheizte Zellen.”
Zum Faszinierendsten dieses Buches gehört das Neben- und Ineinander von Beobachtung und Selbstbeobachtung. Ur-europäisch ist die Beharrlichkeit, mit welcher er auf der Bückeroberung zweier bei der Einreise beschlagnahmter Flaschen Alkohol besteht. Auf den Hürdenlauf von Behörde zu Behörde, auf den dabei entstehenden Papierwust reagiert er typisch europäisch, nämlich verständnislos und wütend. Er versteht zunächst nicht, warum es eine kleine Ewigkeit dauert, ein Glas Wasser für eine in einem dieser Ämter ohnmächtig Gewordene zu beschaffen: Die Arbeitsteilung in indischen Ämtern ist unüberwindlich wie die Kastenschranken, ein Beamter holt kein Glas Wasser. Dafür ist der Bürodiener da. Anschaulich schildert Naipaul seinen monatelangen Aufenthalt in Kaschmir, das Hotel Liward am Dal-See, seine subtile Beziehung zu Aziz, dem Hausfaktotum, der es gemeinsam mit dem Hotelbesitzer schafft, überraschend indische Beaktionen des Autors, Gefühlsausbrüche, wie er sie sich vorher nie zugetraut hätte, zu provozieren.
Naipaul, der ja seine Ansichten immer wieder korrigiert hat, gelangt in diesem frühen Buch zum Schluß, daß Indien an einer Art Schizophrenie krankt. Einerseits übernahm es europäische Wertmaßstäbe, andererseits hält es am Überlieferten fest, das eine hemme das andere, Stillstand sei das Resultat: „Indien muß voranschreiten, muß die Korruption ausrotten, muß den Westen einholen. Aber ist das wirklich so wichtig? Ist ein bißchen Korruption denn so schlimm?”
Er gewährt Einblick in den Widerstreit seiner Gefühle, beschreibt sein Schwanken zwischen Wut und Scham, Abscheu und Mitleid: „Für die Menschen in Goa ist das Defäkie-ren, wie für die alten Römer, eine gesellige Tätigkeit ... Überall am Ufer liegen Kothaufen, und zwischen diesen Haufen wird Fisch verkauft, der von den Booten gebracht wird, und etwa alle hundert Meter steht auf einem blau-weißen, emaillierten Schild in portugiesischer Sprache, daß es bei Strafe verboten ist, das Ufer zu verschmutzen.” Naipaul schwankt zwischen Kritik und Anerkennung: „Aus dem Elend und dem menschlichen Verfall, aus den Ausbrüchen von Barbarei brachte Indien so viele schöne, edle Menschen von ausgesuchter Höflichkeit hervor. Es brachte zuviel Leben hervor und leugnete daher den Wert des Lebens, und doch erlaubte es so vielen die Möglichkeit zu einer einzigartigen Entfaltung menschlicher Fähigkeiten. Nirgendwo sonst waren Menschen so hoch entwickelt, so vollendet und individualistisch, nirgendwo sonst boten sie sich so vorbehaltlos und mit solcher Selbstgewißheit dar.”
Das Buch ist voll bildhafter, poetischer Stellen: „Es war jetzt Nachmittag, und der Schatten des Zuges raste neben uns her. Sonnenuntergang, Abend, Nacht; ein trübe beleuchteter Bahnhof nach dem anderen.” Manchmal verschießt er Bildungsfeuerwerke, manchmal verselbständigen sich die Bilder des Brahmanen Naipaul: „Die Südinder begannen sich zu entspannen; sie schöpften mit den Fingern ihr fast flüssiges Essen. Sie genossen die Berührung-des Essens. Sie kauten, seufzten genußvoll und manschten Reis und Sauce durcheinander. Sie manschten und manschten, und dann, ganz plötzlich, als wollten sie das Essen überraschen, formten sie etwas von der Mischung zu einem Ball, hoben die verschmierten Finger an die Lippen und schnippten sich -Schwupps! Beis und Sauce in den Mund. Dann begann das Manschen, Plappern und Seufzen von neuem.”
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!