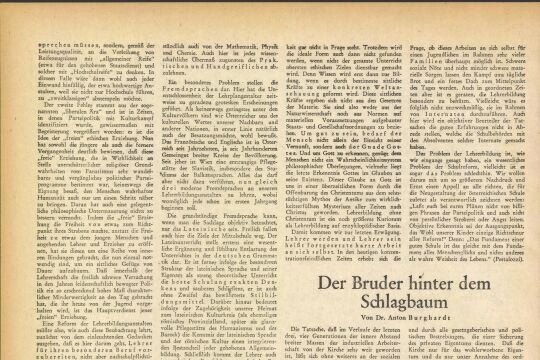„Christ sein“ ist der Titel des neuesten Buches, das Hans Küng geschrieben hat. Der Autor ist Schweizer nach Herkunft und gewissen Anschauungen, katholischer Priester und Professor an der theologischen Fakultät in Tübingen. All das kommt seinen viel gelesenen und umstrittenen Büchern zugute. Wäre nämlich Küng. nicht Vertreter einer quasirevolutionären Theologie, die seiner Herkunft aus dem Land Calvins und Zwingli einige Ehre macht; wäre er nicht nach wie vor katholischer Geistlicher; und wäre er nicht Doktor und Professor der Heiligen Theologie, dann würden die von ihm verfaßten Sachbücher theologischen Inhalts nicht mehr Interesse für sich haben, als theologische Werke anderer Autoren, die sich zwar auch/mit dem Christsein beschäftigen, die aber im Gegensatz zu Küng bei ihrem katholischen Glauben verblieben sind.
Als Vierunddreißigjähriger wurde Küng von Johannes XXIII. zum theologischen Konzilsberater des II. Vatikanums ernannt. Der Dialog der Liebe war damals in Gang gekommen und die Versuche zur Wiedervereinigung der getrennten Kirchen wurden ein Ereignis, das viele Millionen Menschen innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche faszinierte. Von einem Dialóg der Liebe kann in den jetzigen Auslassungen Küngs nur mehr sėlten die Rede sein. Er liebt es vielmehr, sogenannte „heiße Eisen“ anzufassen und Formulierungen zu treffen, die „unter die Haut gehen“. Kein Wunder, daß Küng dermaßen für die Tagespublizistik zahlreiche „Gags“ liefert, über die zum Beispiel „Der Spiegel“, Leibblatt antiklerikaler Spießer in Deutschland und Österreich, jeweils pünktlich und genüßlich berichtet.
„Christ sein“ wird Interessenten des Buches als Lektüre für Christen und Atheisten, Gnostiker und Agnostiker, Pietisten und Positivisten, laue und eifrige Katholiken, Protestanten und Orthodoxe empfohlen. Der „eifrige Christ“ wird beim Lesen bemerken, daß er noch nicht zu altern begonnen hat, weil er sich im Sinne Andrė Gidės bei der Lektüre noch immer entrüsten kann und wird. Andere werden den Autor loben, weil er versatil ist, was heißt: beweglich, gewandt, ruhelos, wankelmütig. Das Glaubensbekenntnis, das Katholiken bei einer Taufe oder an einem offenen Grab sprechen, kommt dem Theologieprofessor Küng in einzelnen Passagen dieses Buches nur mehr stockend über die Lippen. Aber das ficht den Priester Küng nicht an, denn die Worte „abgestiegen zu der Hölle“ sind ihm zum Beispiel nur Beweis dafür, wie „wenig ein Schwören auf vereinzelte Glaubenssätze eines Credos hilft“. (S. 356) Solange es noch Geistliche gibt, die das Credo, das sie am Tage ihrer Priesterweihe und anläßlich ihrer Promotion zum Doktor der Heiligen Theologie gebetet haben, auch heute noch mit großer Entschiedenheit aussprechen, wird der theologische Konzilsberater der Ära Johannes XXIII. nicht allzuviel Schaden unter denen anrichten, die den Sabbat heiligen. Aber das „Ja und Nein“, mit dem Küng zunächst die Frage nach der leiblichen Auferstehung (Auferweckung) Jesu quittiert (S. 340), demonstriert eine gefährliche Ambivalenz; stellt einen Priester und Lehrer bloß, der sich seiner selbst nicht mehr gewiß ist; festigt nicht die priesterliche Existenz, sondern erzeugt jenen Skeptizismus, in dem intellektuelle Kleriker ihrer priesterlichen Berufung so oft verlustig gehen.
Für ein modernes Christ-sein zeichnet Küng ein neues, ein anderes Christusbild. Ein Bild, das auf der Höhe der Zeit sein soll, damit es intellektuellen Ansprüchen esoterischer Kreise innerhalb der Kirche entspricht und intellektuelle Katholiken von dem Verdacht der „Femerste- henden“ befreit, wonach angeblich die „Frommen“ nur Dummköpfe oder Heuchler sein sollen. Der Umriß des neuen Christbildes wird mit einem Strich gezogen: „Der Christus der Geschichte (ist) nicht identisch… mit dem Christusbild der traditionellen Dogmatik“ (S. 150). Küng degradiert damit den Aufblick zu Christus, der während 65 Generationen die Christen mit Christus verbunden hat und weiter verbindet, zu einem fatalen Geschichtsirrtum; er setzt sich mit größter Unbefangenheit über die intellektuellen Qualitäten jener hinweg, die vor ihm Theologie betrieben haben und denen gegenüber seine Hybris höchst unangebracht ist. An solchen Punkten der Erörterung des Themas hört sich der Dialog der Liebe auf, spürt der Leser vielmehr die ätzende Säure des Zynismus, wenn Küng zum Beispiel die Frage nach dem Verbleib der Moleküle des Auferstandenen und in den Himmel Aufgefahrenen andeutet, ohne mit der Courage zu fragen und zu zweifeln, die einem erklärten Freidenker sein Charakter eingibt. (Siehe S. 340)
Küng warnt vor jetzigen charismatischen Jesus-Bewegungen. (S. 129) Er zögert aber nicht, ein „neues“ Christus-Blld zu liefern, das Züge des Idols eines Happenings hat. Sein Christus ist ein „Geschichtenerzähler“ (S. 171), so einer, den die Amerikaner abschätzend „Stories-teller“ nennen; einer, dessen „Lebensführung … hippieartige Züge“ an sich hat (S. 184). Dabei wird jene Grenze, an der Hippies, also Blumenmenschen, zuweilen Terroristen, Mörder, sowie Rauschgift- und Sexsüchtige werden, nicht einmal erwähnt. Der Christus, der bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr in der Werkstatt dessen gearbeitet hat, den die Kirche „Josef den Arbeiter“ nannte, wird als einer hingestellt, der für seinen „Lebensunterhalt“ nichts tut. (S. 184) Selbstverständlich konnte dieser existenzlose Christ auch „keine Sympathien für die konservativen Rechtsauffassungen der führenden Kreise“, des Judentums seiner Zeit, aufbringen (S. 172); so wird Christus zum Vorbild jener Christen, die heute ihrerseits Sympathie für die Rechtsauffassung der Kirche vermissen lassen. Dem „Frommen“, der an dem hängt, „was eine spätere Christenheit (in diesem Fall besonders die katholischer Prägung) als ,christlich“ ausgegeben hat“ (S. 195), gibt Küng anheim, sich zu entscheiden, „wann er den Sabbat hält und wann nicht“. (S. 199) Mit solchen Absagen an das Establishment wird heute vielfach versucht, Menschen bei der Stange zu halten, die, so wie Christus zu seiner Zeit, nicht „Anhänger und Sympathisanten der liberal-konservativen Regierungspartei“ ihrer Zeit sind. (S. 171) So werden Fenster und Türen der Kirche weit aufgerissen, auf daß die „Fernerstehenden“ näher kommen; während in Wirklichkeit durch eben diese offenen Türen immer mehr die Kirche verlassen, um ihren langen Marsch in ein von geistigen Hochnebeln durchflutetes Land anzutreten. Und hatte Christus keine Sympathie für die „konservative Theologie des sadduzäischen Priesteradels“ (S. 172), woher soll dann heute Sympathie für jene Leitfossilien an konservativen Ordinarienuniversitäten kommen? Da doch die Konservativen in der Kirche nach der Ansicht Karl Rahners ohnedies „bockig“ sind. Also steif und widerspenstig, verstockt und unproduktiv, abweisend.
Für Küng geht es im Falle des Christentums jetzt um eine „Aktivierung der Erinnerung“. (S. 113) Wegen der eingealterten Irrtümer und Fehler der Kirche kann dieses Erinnern nach der Ansicht Küngs — ganz im Sinne Blochs und Marcuses — nur „gefährlich“ sein; gefährlich aber auch „befreiend“. Es war Bloch, der 1937 in seiner Erinnerung die Russische Oktoberrevolution von 1917 „groß“ und „befreiend“ gesehen hat; 1971 stellt Bloch diesbezüglich wieder eine Erinnerung an; aber diesmal strich der große Bloch anläßlich der Neuausgabe seiner Schriften das Eigenschaftswort „befreiend“. Wer aber die Wahrheit manipuliert wie Bloch, für den kann die aufgrund einer solchen Art der Wahrheitsfindung ermittelte „Freiheit“ in der Tat so gefährlich werden, wie Küng jetzt mit einem Erinnern in der Kirche beschwören möchte. Aber gerade in diesem Punkt wird Küng von Bloch verlassen. Zum Greis geworden, nennt Bloch das fragliche „befreiende“ Ereignis seiner Jugendtage nur mehr ein „aufrührerisches“. Und „Aufruhr“, nicht mehr, erzeugt auch Küng dort, wo er „Freiheit“ versprach.
4n diesem Jahr 1874, in dem Militärs nicht mehr für verderbte Konservative putschen, schießen und töten, sondern für eine „fortschrittliche“ Linke und erklärte Terroristen vor der Versammlung der Staaten der UNO das Wort bekommen, sieht Küng das „Besondere des Christentums“ in einem „Eintreten für humanitäre Ideale, Menschenrechte und Demokratie“. (S. 117) Und er stellt sehr in Frage, ob denn derzeit ein solcher Einsatz in Form christlicher Verkündigung in Chicago, Rio, Auckland oder Madrid stattfindet. Von dem Los, das der christlichen Verkündigung in Moskau und Peking, in Tirana und Hanoi widerfährt, ist bei Küng weniger die Rede. Den Atheisten im Archipel Gulag kommt er lieber nicht mit den Scherereien, die diesen von bockigen „Frommen“ bereitet werden. Und ein Buch für Christen und Atheisten, Gnostiker und Agnostiker, Pietisten und Positivisten, laue und eifrige Christen schreibt man am besten so, daß man die, die ohnehin nichts glauben, nicht mit dem eigenen Glauben verletzt. (Charles Péguy, L’Argent, Edition Gallimard, S. 48.)
Indem Küng und viele andere Theologen auf Bloch, Marcuse und diverse Theoretiker der Revolution der Neuen Linken Bezug nehmen und junge Theologiestudenten und Intellektuelle zu den diesbezüglichen Fundstellen in den Werken des Neomarxismus führen, wecken sie ein Verlangen, den „modernen“ Wissensdurst der Jugend nicht aus dem Krug zu stillen, den Küng und dessen Kollegen hinhalten, sondern lieber gleich zu der Quelle zu gehen, wo die neuen Wahrheiten Blochs, Marcuses und Adornos fließen. So kommt es, daß neuerdings in den Bibliotheken katholischer Hochschulverbindungen und Gemeinschaften eine Neuaufstellung stattfindet, nach der die Standardwerke des Neomarxismus nicht nur griffbereit liegen, sondern als Voraussetzung für ein sogenanntes „Umdenken und Neudenken“ ausdrücklich empfohlen werden. (Siehe „Checkpoint“, Mitteilungen einer katholischen Studentenverbindung in Wien.) In Wien wurden sich einige dermaßen in ihrem Wissensdurst bereits gestillte katholische Hochschüler unlängst einig, anläßlich einer Wahlwerbung zu verlangen, daß jetzt auch endlich in den Pfarrbüchereien Werke der Pornoliteratur eingestellt werden. Denn: indem „fortschrittliche und aufgeschlossene“ Theologieprofessoren junge katholische Intellektuelle und Priesterstudenten auf den religiös-chiliastischen Gehalt in den Werken von Bloch und Konsorten aufmerksam machen, bringen sie den Neomarxismus als Ganzes ins Bild, jene sexuelle, moralische, intellektuelle und politische Revolution, wie sie Marcuse Mitte der sechziger Jahre in Deutschland ausgerufen hat und deren Wellen auch in Österreich zu Zeiten immer wieder an die Dämme schlagen. 1974 marschierten Männer der katholischen Arbeiterbewegung zusammen mit Kommunisten und Parteigängern der linken Linken um jener „humanitären Ideale“ willen, die der einäugige Humanismus Küngs gefährdet sieht. In Chicago, Rio usw., wie bereits erwähnt. Die Einladung der Kommunisten, für unterdrückte Katholiken in Litauen zu demonstrieren, steht noch aus.
Bei dem kniffligen Stil Küngs, dessen Duktus immer wieder den Formeln: sowohl — als auch, oder: weder — noch folgt, überliest man zuweilen, oder unterschätzt man das, was in Nach- und Nebensätzen im Gegensatz zur Aussage des Hauptsatzes gesagt und gemeint ist. Küng streut auch keine alarmierenden Häresien aus, wie das naive Häretiker dümmlicherweise tun. Er läßt unzählige Fragen „im Raume stehen“, Fragen, auf die er als Priester und katholischer Theologieprofessor eigentlich Antworten und Entscheidungen schuldig wäre. So überantwortet er seine Schüler und Leser jener gefährlichen Ambivalenz, die man heute „allseitige Offenheit“ nennt, die aber schon mehr Glaubenslosig- keit und öfter Abfall vom Glauben zur Folge hatte, als das ausdrückliche „Nego“ derer, die auf Häresie und Abfall aus sind.
In derlei Zusammenhängen tauchen Sätze auf, wie: Christus ist, „jedenfalls nach den Konzilien, nicht einfach: Gott“. (S. 122) Nur unter dem Einfluß eines „unpädagogisch éinsetzenden, oberflächlichen Religionsunterrichts, einer überhöhenden Liturgie und Kunst“ geht nach der Meinung des Autors die Gleichung: „Jesus = Gott“ noch auf. (S. 122) Und „das unbedingt Verläßliche, an das sich der Mensch für Zeit und Ewigkeit halten kann, sind nicht die Bibeltexte und nicht die Kirchenväter und auch nicht das kirchliche Lehramt“. (S. 155) Eine solche Atomisierung der Kirche und des Glaubens scheint zuletzt auch die Frage zu gestatten: „Und Jesus? Kam seine Botschaft nicht der revolutionären Ideologie sehr nahe?“ (S. 177) Damit wird die Grenze zwischen Religion und Ersatzreligion fließend und in letzter Konsequenz die Religion zu den Ideologien, also zu den Ersatzreligionen gerechnet wird, wie das auf Grund von Äußerungen von Theologen westliche Agnostiker und Atheisten vielfach tun.
Man mag einwenden, daß hier Sätze oft willkürlich aus einem Zusammenhang gerissen werden. Aber Küng schlug keine knapp gefaßten Thesen an, er breitet über 672 Seiten einen Galimathias aus, einen Wust von Sentenzen, aus denen die verklausulierten Tendenzen herauspräpariert werden müssen. Was nun die Tendenz des Buches anlangt, so hätte der Autor in einer mehr gerafften Darstellung kurz und bündig zum Kern seiner Sache kommen können. Etwa: Die Kirche ist nicht von Jesus gegründet. (S. 468) Die Bischöfe sind nicht im direkten und exklusiven Sinn die Nachfolger der Apostel. (S. 481) Was nützt der Kirche die ganze apostolische Sukzession? (S. 487) Muß der Primat Petri andauern? (S. 486) Usw. usw.
Im Marianismus sieht Küng die Stütze des „Papalismus“. Papalismus und Marianismus gehen demnach seit dem 19. Jahrhundert Hand in Hand. Aber der „übertriebene Marianismus“ hat in Theologie und kirchlichem Leben seine „Stoßkraft“ (sic) in der Zeit nach dem Konzil völlig eingebüßt. (S. 452) Obwohl auf streng theologische oder offizielle dogmatische Äußerungen der Kirche bedacht, möchte Küng gewisse „poetische Aussagen in der katholischen Tradition (Lieder, Hymnen, Gebete) sowie persönliche oder national be- dingte Frömmigkeitsformen“ toleriert wissen. (S. 452) Quasi als farbige Folklore, Volksmusik und Volksbrauch in der dürren Konstruktion eines klerikalen Intellektualismus.
In einem Aufsatz, den DIE FURCHE in ihrer Ausgabe vom 12. Oktober 1974 auf Seite 23 abgedruckt hat, nannte der Verfasser dieser Besprechung Hans Küng einen von seinem katholischen Glauben abgefallenen, aber weiter im staatlichen Lehramt befindlichen Theologieprofessor. Auf diese Feststellung hin folgten von verschiedenen Seiten Vorwürfe, wonach hier eine „Verketzerung, eine Verteufelung und eine Verleumdung“ erfolgt sein soll, die die christliche Liebe verletzt Ein Laie, der punkto Mündigkeit noch nicht auf der Höhe der Zeit steht, kann als Begründung für seinen Vorwurf der Apostasie nur ins Treffen führen, daß er beim Anblick der Verstümmelung, die in den letzten Jahren so viele Theologen ihrer Mutter, der Kirche, zugefügt haben, nicht nur an Liebe gedacht hat, sondern auch an den Glauben. Wobei Abfall vom Glauben ein bewußtes, hartnäckiges Festhalten eines Getauften an einer mit der Glaubenslehre der Kirche in Widerspruch stehenden Lehre ist. Nebensächlich ist es, ob sich der Apostat einer anderen Konfession anschließt oder nicht.
Die Geschichte lehrt, daß in den meisten Fällen der Abfall vom Glauben nicht vom Fleck weg und mit einem Ruck geschieht. Bei dem Eifer, den „alten Glauben“ in einer „neuen Sprache“ zu verkünden, wird die neue Sprache oft Selbstzweck. Mit der Neuen Sprache verbindet sich bald ein Neues Denken, bei dem vielfach die Möglichkeit, falsch oder richtig zu denken mit der irrigen Annahme verwechselt wird, man könne willkürlich „anders“ denken. So wandelt sich oft die Interpretation der Wahrheit in eine „andere“ Erkenntnis der Wahrheit, obwohl ge- offenbarte Wahrheit absolut ungeschichtlich ist. Der Satz, wonach sich auch die Offenbarungswahrheit im Laufe der Geschichte ändere, ändern müsse, führt in konsequenter Fortführung solchen „Um- und Neudenkens“ zum Abfall.
Den Abfall von der Wahrheit und vom Glauben festzustellen, ist nicht lieblos oder Denunziation. Das im Abfall zutage tretende Nego zwingt aber das Credo zu einer tieferen Erfassung seines Inhalts; nicht zu einer Wandlung, sondern zu einer gründlicheren Selbstgewißheit.
Wie arm ist die kirchengeschichtliche Erkenntnis Küngs, der in zwei Jahrtausenden geschichtlicher Ge- wordenheit des „christlichen Programms“ einleitend nur Staub und Geröll feststellt. Wie banausisch sein Bild der Kirche, in der Christ zu sein wohl tatsächlich nur mehr jene „kleine Herde“ Lust haben würde, deren Entstehungsgefahr Alptraum derer ist, die nie gelernt haben, als Christen wider eine rational begründete Hoffnung zu hoffen.
CHRIST SEIN. Von Hans Küng. R. Piper & Co. Verlag, München 1974, 676 Seiten. Preis S 278.