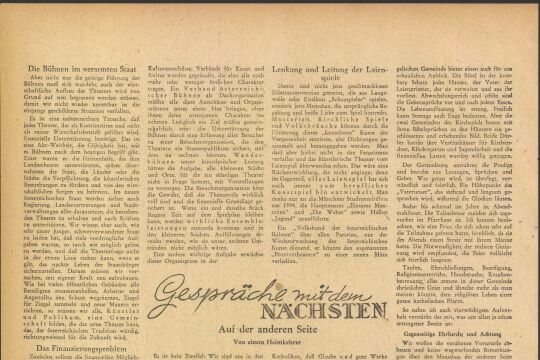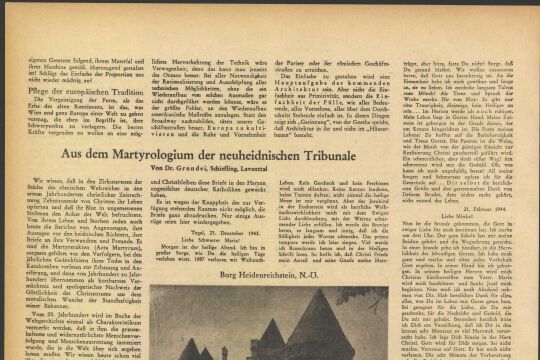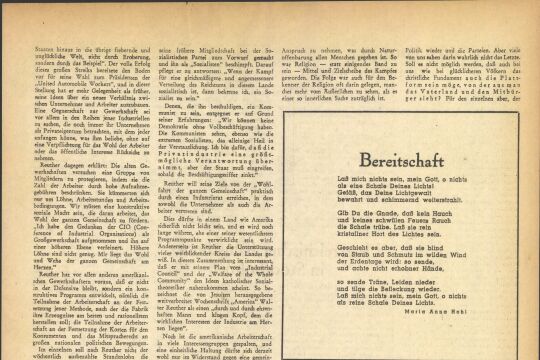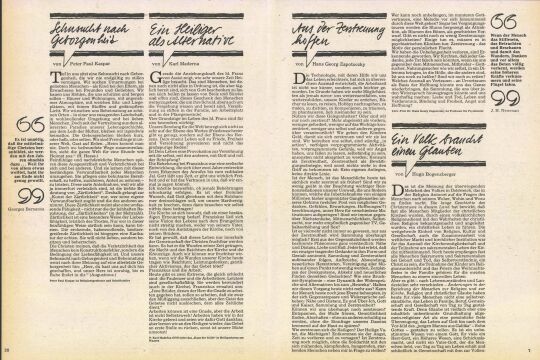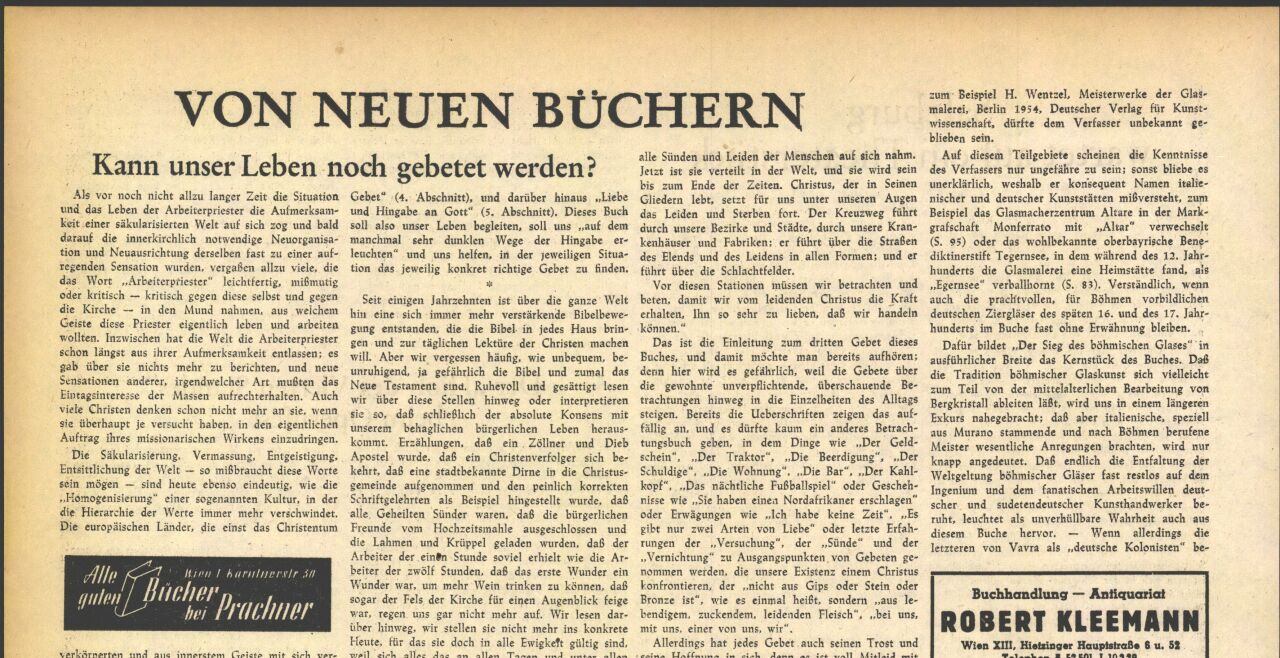
Als vor noch nicht allzu langer Zeit die Situation und das Leben der Arbeiterpriester die Aufmerksamkeit einer säkularisierten Welt auf sich zog und bald darauf die innerkirchlich notwendige Neuorganisation und Neuausrichtung derselben fast zu einer aufregenden Sensation wurden, vergaßen allzu viele, die das Wort „Arbeiterpficster“ leichtfertig, mißmutig oder kritisch — kritisch gegen diese selbst und gegen die Kirche — in den Mund nahmen, aus welchem Geiste diese Priester eigentlich leben und arbeiten wollten. Inzwischen hat die Welt die Arbeiterpriester schon längst aus ihrer Aufmerksamkeit entlassen; es gab über sie nichts mehr zu berichten, und neue Sensationen anderer, irgendwelcher Art mußten das Eimagsinteresse der Massen aufrechterhalten. Auch viele Christen denken schon nicht mehr an sie, wenn sie überhaupt je versucht haben, in den eigentlichen Auftrag ihres missionarischen Wirkens einzudringen.
Die Säkularisierung. Vermassung, Entgeistigung, Entsittlichung der Welt — so mißbraucht diese Worte sein mögen — sind heute ebenso eindeutig, wie die „Homogenisierung“ einer sogenannten Kultur, in der die Hierarchie der Werte immer mehr verschwindet. Die europäischen Länder, die einst das Christentum
verkörperten und aus innerstem Geiste mit sich verbanden, sind über das ganze Abendland hinweg „Missionsländer“ geworden. In diesen Missionslän-dern aber gibt es Gebiete. Städte, Bezirke, in denen das Christentum nur noch Museumswert hat; gibt es Menschen, Gruppen, soziologische Gebilde, in denen es, aus welchem Grunde immer, nur noch als Kuriosität vermerkt wird, höchstens noch als unterbewußte Reminiszenz einer abklingenden oder überholten Vergangenheit berücksichtigt oder bei gewissen, das Gefühl ansprechenden und ihm entsprechenden Gelegenheiten für einen Augenblick übergestülpt wird: vielleicht eine Angelegenheit der Gewohnheit, der Sitte, des Volkstums und des Brauchtums. Und auch die, die sich mit Stolz oder wenigstens mit einer bürgerlichen Ueberzeugung Christen nennen, wissen häufig mit dem Christentum in der Parodie ihres Alltags wenig anzufangen Sie schließen die Augen, sobald das Leben und seine Forderungen in Koliision mit der christlichen Entscheidung kommen. Sie beten in Bitten und Formeln, die weitgehend den konkreten Bezug zu dem, was sie sind und haben, vermissen lassen; sie verwaschen das Leben des Geistes zu einem Leierton der Unwirklichkeit. Sie erschrecken weder, wenn sie das Geheimnis des immerwährenden Kreuzopfers feiern, noch wenn sie die Gewalt der Psalmen oder die Eindeutigkeit der biblischen Parabeln lesen. Sie beichten sonder Furcht. Sic leiden weder am Christentum noch am Leben; denn sie wissen viele Verheißungen, und ihr Leben hat viele abergläubische Rezepte des Glaubens.
In diese Situation bricht ein französischer Arbei-terpriester mit einem kleinen Büchlein ein, das sich schlicht und einfach „Prieres“ = „Gebete“ nennt und ohne jede gedankliche oder rationale Verklausulierung Ernst macht mit der von Christus vorgelebten Zuordnung von Leben und Gebet. Leben und Gebet sind für ihn Konkretheiten, sind nicht Formeln, sondern Wahrheit und Wirklichkeit. „Gott wendet sich an uns durch alle Geschehnisse, selbst die unbedeutendsten“, sagt er im Vorwort. Seine Gebete möchten daher „auf die verschiedensten Situationen antworten, in denen sich das Leben der tätigen Christen bewegt, und sie sollen ihnen helfen, beim Beten von ihren konkreten Situationen auszugehen“.
Das ist leicht gesagt: aber die Konsequenz, die dann tatsächlich darin liegt, ist nicht ganz so einfach. Sie ist vielmehr — und das-muß jeder spüren, der diese Gebete nun in die Hand zu nehmen und sie vielleicht gar zu beten wagt — eine recht unangenehme Angelegenheit Michel Quoist, so heißt der verfassende Beter — denn was in diesem Buche steht, wurde „gebetet, bevor es niedergeschrieben wurde“ —, gebraucht daher zwei Mittel, um uns diesen Schreck zu nehmen. Das erste Mittel ist, daß er uns lehrt, im Evangelium Nahrung für das tägliche Leben zu finden. Evangelium und Leben gehören für ihn zusammen. Sie sind die beiden unzertrennlichen Ebenen, auf denen Gott zu uns spricht. Gleichzeitig ist das Evangelium auf das Leben und dieses auf das Evangelium bezogen: allerdings in einer Form, die nicht nur begeistert, sondern auch erschreckt und skandalisiert. Denn „so oft ein Mensch vom Evangelium berührt wird, ist sein ganzes Leben, wenn, es ehrlich ist, in Frage gestellt, weil die Forderung Christi keine Halbheiten leidet“.
Michel Quoist greift daher zunächst zu einem zweiten Mittel, um diese Zuordnung in uns wirklich werden zu lassen. Sein Buch ist in Abschnitte eingeteilt, die uns allmählich den Weg zu einer immer größeren Hingabe an die anderen und einer immer innigeren Freundschaft mit Christus aufzeigen sollen. Diese Abschnitte sind ebenfalls praktisch gebetete Lehrstücke; denn „wenn wir verstünden, auf Gott i.u horchen“ (1. Abschnitt), „wenn wir verstünden, das Leben zu betrachten“ (2. Abschnitt), „würde das ganze Leben zum Sinnbild“ (?. Abschnitt), „würde das ganze Leben zum
Gebet“ (4. Abschnitt), und darüber hinaus „Liebe und Hingabe an Gott“ (5. Abschnitt). Dieses Buch soll also unser Leben begleiten, soll uns „auf dem manchmal sehr dunklen Wege der Hingabe erleuchten“ und uns helfen, in der jeweiligen Situation das jeweilig konkret richtige Gebet zu finden.
Seit einigen Jahrzehnten ist über die ganze Welt hin eine sich immer mehr verstärkende Bibelbewegung entstanden, die die Bibel in jedes Haus bringen und zur täglichen Lektüre der Christen machen will. Aber wir vergessen häufig, wie unbequem, beunruhigend, ja gefährlich die Bibel und zumal das Neue Testament sind. Ruhevoll und gesättigt lesen wir über diese Stellen hinweg oder interpretieren sie so, daß schließlich der absolute Konsens mit unserem behaglichen bürgerlichen Leben herauskommt. Erzählungen, daß ein Zöllner und Dieb Apostel wurde, daß ein Christenverfolger sich bekehrt, daß eine stadtbekannte Dirne in die Christusgemeinde aufgenommen und den peinlich korrekten Schriftgelehrten als Beispiel hingestellt wurde, daß alle Geheilten Sünder waren, daß die bürgerlichen Freunde vom Hochzeitsinahle ausgeschlossen und die Lahmen und Krüppel geladen wurden, daß der Arbeiter der eintn Stunde soviel erhielt wie die Arbeiter der zwölf Stunden, daß das erste Wunder ein Wunder war, um mehr Wein trinken zu können, daß sogar der Fels der Kirche für einen Augenblick feige war, regen uns gar nicht mehr auf. Wir lesen darüber hinweg, wir stellen sie nicht mehr ins konkrete Heute, für das sie doch in alle Ewigkeft gültig sind, weil sich alles das an allen Tagen und unter allen Himmeln wiederholt. Quoist allerdings tut es, wagt es in diesen Gebeten; und so sind sie zugleich eine gewaltige, wenn auch in sich bereits überwundene Anklage, eine Revolution des christlichen Konsens, diu das heutige Leben unmittelbar in die Situation des Evangeliums stellt. Wir denken an die Sätze, die wir im Anfang schrieben, und dieses und nichts anderes ist die eigentliche Sensation des Arbeiterpriesters, der das Christentum mit einer Welt zu konfrontieren sucht, die nichts mehr von ihm weiß, auch wenn es offiziell gepredigt wird, und die plötzlich als christliche Bezugsebene aufstrahlt, selbst wo das Christentum offiziell nicht mehr existiert.
Gebetbücher sind im allgemeinen, vor allem wenn sie der religiösen Gefühlswelt dienen, angenehme Bücher. Sie ersparen einem viel Geistesarbeit. Sie bleiben im allgemeinen, und sie wissen gut hinwegzuführen über die ganze oder halbe Stunde, die man in der Kirche zubringt. Sie haben innerlich häufig dasselbe Format wie außen: Taschenformat. Diese Gebete sind hier unangenehm. Sie sind peinlich präzis auf das Leben zugeschnitten, so daß man sich nicht mehr tarnen oder verstecken kann. Man möchte vor ihnen warnen; denn sie rütteln aus dem Schlafe auf.
„Man muß Christus betrachten, wie Er auf den Kalvarienberg hinaufsteigt. Man muß mit Ihm die Stationen Seines Kreuzweges wiedererleben, um ganz durchdrungen zu werden von Seiner Liebe zu uns. Aber die Passion ist nicht .vollendet'. Einmal wurde Sie von Christus erlebt, der vor zweitausend Jahren
alle Sünden und Leiden der Menschen auf sich nahm. Jetzt ist sie verteilt in der Welt, und sie wird sein bis zum Ende der Zeiten. Christus, der in Seinen Gliedern lebt, setzt für uns unter unseren Augen das Leiden und Sterben fort. Der Kreuzweg führt durch unsere Bezirke und Städte, durch unsere Krankenhäuser und Fabriken; er führt über die Straßen des Elends und des Leidens in allen Formen; und er führt über die Schlachtfelder.
Vor diesen Stationen müssen wir betrachten und beten, damit wir vom leidenden Christus die Kraft erhalten, Ihn so sehr zu lieben, daß wir handeln können.“
Das ist die Einleitung zum dritten Gebet dieses Buches, und damit mochte man bereits aufhören; denn hier wird es gefährlich, weil die Gebete über die gewohnte unverpflichtende, überschauende Betrachtungen hinweg in die Einzelheiten des Alltags steigen. Bereits die Ueberschriften zeigen das auffällig an, und es dürfte kaum ein anderes Betrachtungsbuch geben, in dem Dinge wie „Der Geldschein“, „Der Traktor“, „Die Beerdigung“, „Der Schuldige“, „Die Wohnung“, „Die Bar“, „Der Kahlkopf“, „Das nächtliche Fußballspiel“ oder Geschehnisse wie „Sie haben einen Nordafrikaner erschlagen“ oder Erwägungen wie „Ich habe keine Zeit“, „Es gibt nur zwei Arten von Liebe“ oder letzte Erfahrungen der „Versuchung“, der „Sünde“ und der „Vernichtung“ zu Ausgangspunkten von Gebeten genommen werden, die unsere Existenz einem Christus konfrontieren, der „nicht aus Gips oder Stein oder Bronze ist“, wie es einmal heißt, sondern „aus lebendigem, zuckendem, leidenden Fleisch“, „bei uns, mit uns. einer von uns, wir“.
Allerdings hat jedes Gebet auch seinen Trost und seine Hoffnung in sich, denn es ist voll Mitleid mit unserer Schwäche, voll Wissen um unser Versagen und durchtränkt vom Vertrauen auf Gottes Güte. Doch gerade diese Seiten machen die Gebete anderseits auch wieder unerbittlich, weil sie daneben nicht geeignet sind, etwas zu vergessen oder zu übersehen. Sie sind ein Gericht, das sich täglich vollzieht, in jedem Haus, an der Arbeitsstätte, auf der Straße, in der Straßenbahn, in der Bar, im politischen Bereich, im Polizeibericht, überall. Aber es sind, Gott sei Dank, Gebete, und sie richten sich an einen Gott, ohne dessen Willen kein Haar von unserem Haupte und kein Spatz vom Dach fällt. So sind es letztlich Gebete, in denen der Christ wieder Mensch sein muß und der Mensch wieder Christ, lind darum sollten viele sie beten und betrachten. *
Der Verfasser wurde mit 14 Jahren Textilarbeiter und gleichzeitig Aktivist- der J. O. C. (= K. A. J.), deren Bundesführer er später war. Mit 18 Jahren — nach einer schweren Krankheit — trat er in ein Priesterseminar für Spätberufene ein und wurde 1947 zum Priester geweiht. Nach Jahren des Apostolats in der Arbeitermission widmete er sich im Auftrag der französischen Regierung soziologischen Studien über die Arbeiterviertel von Rouen. Seit 1953 ist er Jugendseelsorger von Stadt und Bezirk Le Havre.
Das hier besprochene Buch vom Michel Quoist erscheint soeben unter dem Titel „Herr, da bin ich“ im Verlag Styria, Graz-Wien-Köln.