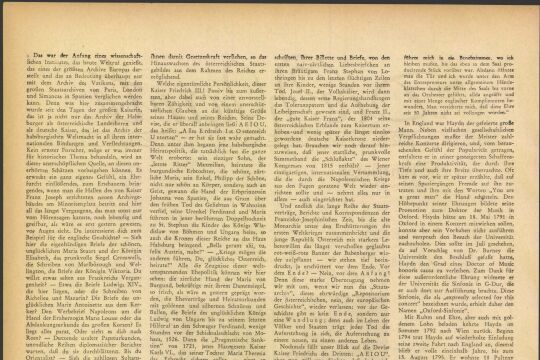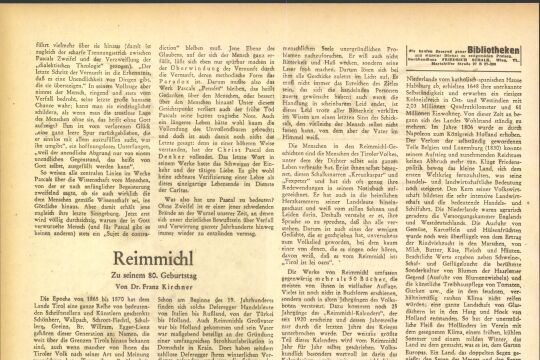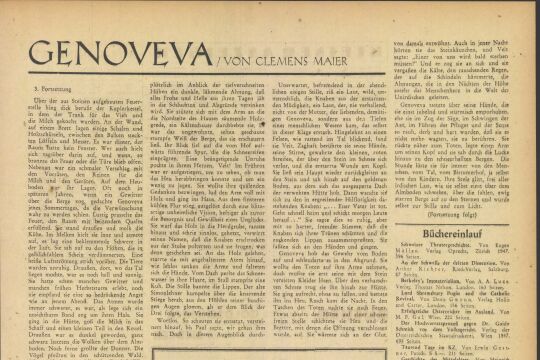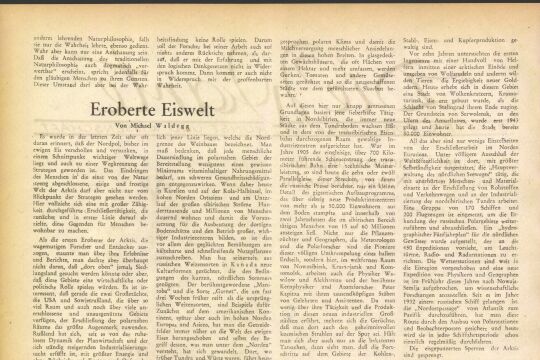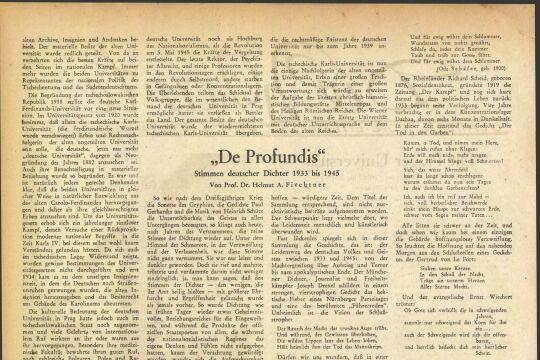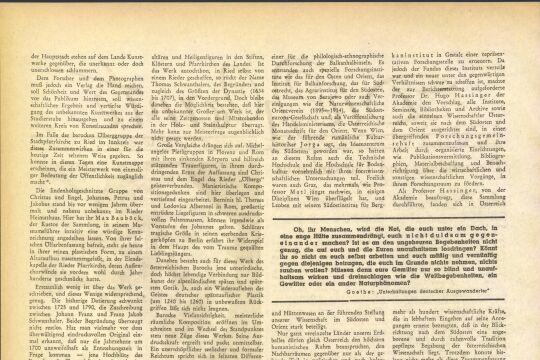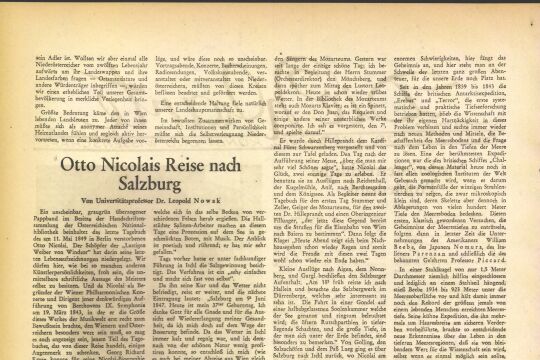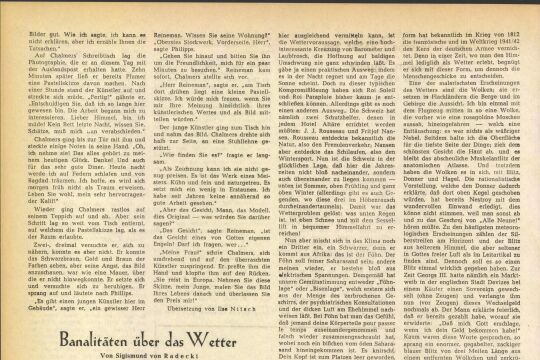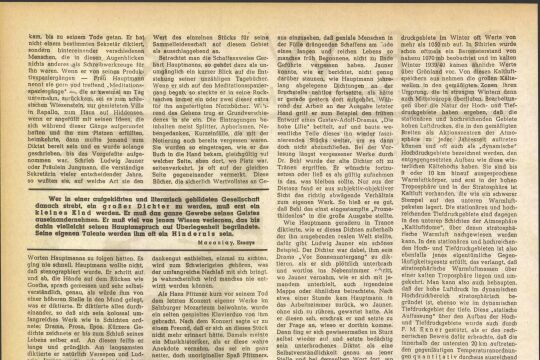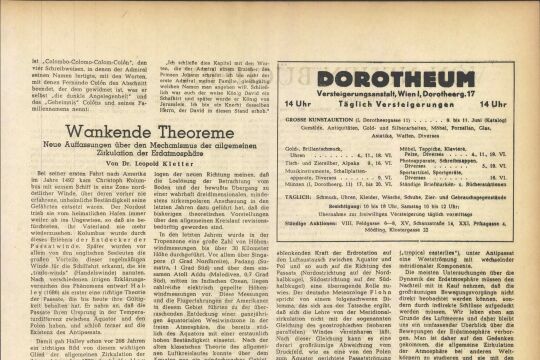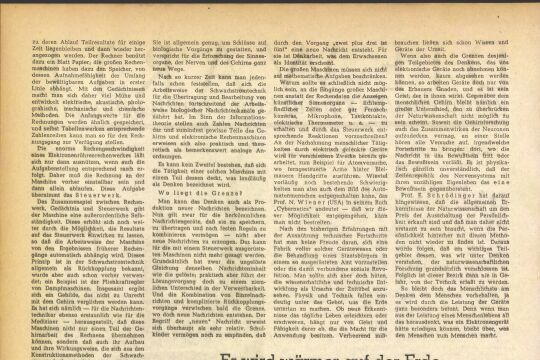Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Sommer, der ein Winter war
Naturkatastrophen und Klimaschwankungen gibt es viel länger als die heutige Umweltverschmutzung. Sie liegen jederzeit im Bereich des Möglichen und haben beträchtliche Auswirkungen.
Naturkatastrophen und Klimaschwankungen gibt es viel länger als die heutige Umweltverschmutzung. Sie liegen jederzeit im Bereich des Möglichen und haben beträchtliche Auswirkungen.
Zwei große Vulkanausbrüche haben in der jüngsten Vergangenheit die Öffentlichkeit in Atem gehalten: im Mai 1980 der Mount St. Helens im Staate Washington im Nordwesten der USA, und im April 1982 der Chichon in Zentralmexiko. Zu beiden Ausbrüchen gehörten gewaltige Explosionen, bei denen die Gipfel der Vulkane im wahrsten Sinne des Wortes pulverisiert wurden. Auch aus den Kratern selbst wurde reichlich Staub ausgestoßen. Beim Mount St. Helens waren viele Partikel relativ groß, wie Sandkörner, und fanden schnell den Weg zurück zur Erde. Staub und Asche des Chichon dagegen schossen über zwanzig Kilometer hoch in die Stratosphäre und sind gerade dabei, sich gleichmäßig um die Erde zu verteilen.
Der berühmte Benjamin Franklin hatte schon den kalten Winter 1783/84 auf die Wirkung von Staub in der Atmosphäre zurückgeführt. Doch die Wissenschaft nahm seine Entdeckung nicht zur Kenntnis. Heute weiß man aus dem Vergleich langjähriger Wetterbeobachtungen mit den Vulkanausbrüchen der letzten zweihundert Jahre und aus Modellrechnungen, daß die Staubdichte in der Atmosphäre einen stärkeren Einfluß auf das Wetter hat als Sonnenflecken oder Kohlendioxydgehalt.
Über ein besonders katastrophales Jahr berichten Henry Stommel vom renommierten Forschungsinstitut Woods Hole in Massachusetts und die Anglistin Elizabeth Stommel in der Januarausgabe von „Spektrum der Wissenschaft“. Der Sommer des Jahres 1816 war fast ein Winter. Zwischen dem 6. und dem 11. Juni brachten eisige Ostwinde Nordamerika fünf bis fünfzehn Zentimeter Neuschnee. Die nächste Kältewelle dauerte vom 5. bis zum 11. Juli. In Maine, dem Urlaubsland im Nordosten der Vereinigten Staaten, gefror das Wasser, die Maispflanzen gingen an den Nachtfrösten zugrunde.
Doch das war noch immer nicht alles. Zwischen dem 20. und dem 30. August drang die Kälte bis Boston (es liegt auf dem Breitengrad von Rom) vor, ließ den Mais absterben, Kartoffeln und Wein erfrieren. In den Bergen von Vermont schneite es. Noch schlimmer war es in Kanada. Ein großer Teil der Weizenernte fiel aus, viele kleine Seen waren noch Mitte Juli zugefroren.
Was war passiert? Ein Jahr zuvor war in Indonesien nördlich der Insel Sumbabwa ein Vulkan ausgebrochen. Ein Augenzeuge berichtet: „Die gewaltigen Eruptionen machten sich weithin bemerkbar. Noch auf Java, fast 500 Kilometer entfernt, verdunkelten Aschewolken den Himmel, die Sonne verschwand hinter einem dichten Schleier. Durch die Finsternis drang das Donnern der Explosionen, das sich wie Artilleriefeuer anhörte. Einige Offiziere fürchteten einen Piratenangriff und schickten ihre Boote los.“
So beschrieb der Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte in Indonesien, Sir Thomas Stanford Raffles, den Ausbruch des Tambora. Das Drama forderte 12.000 Menschenleben. Rund 150 Kubikkilometer Asche wurden ausgestoßen, der Berg verlor 1300 Meter Höhe. Die Eruption war viel gewaltiger als der berüchtigte Ausbruch des Krakatau siebzig Jahre später.
Asche in der Stratosphäre reflektiert die einfallenden Sonnenstrahlen und verhindert spürbar die Erwärmung der tieferen Atmosphäre durch das Sonnenlicht. Das macht sich im Sommer stärker bemerkbar als im Winter. Doch 1816 konnte sich das trotz Franklins früher Beobachtung niemand vorstellen. So machte der deutsche Akustiker Ernst Chladin das Vordringen der Eisberge im Nordatlantik für die sommerliche Kälte verantwortlich.
Der katastrophale Sommer hatte soziale Folgen, die die Geschichte veränderten. Das Weizenexportland Kanada mußte Weizen importieren, die Getreidepreise auf der ganzen Welt erreichten schwindelerregende Höhen. Viele Bewohner der amerikanischen Ostküste brachen auf, um sich im Westen neues Land zu suchen und dem Hunger zu entkommen. In den europäischen Städten aß man Moos und Katzenfleisch. Viele Winzer suchten ihrerseits das Glück in Amerika. Dennoch ist die Erinnerung an 1816 in Europa nicht so ausgeprägt wie in Amerika. Die Napoleoni- schen Kriege und eine allgemeine Kälteperiode, die noch bis 1830 anhalten sollte, hatten dem Kontinent schon schwer zugesetzt. Quelle: Spektrum der Wissenschaft.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!