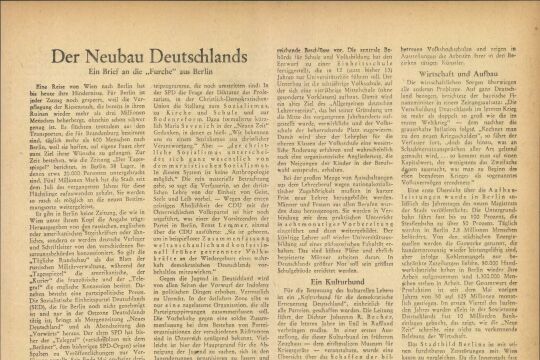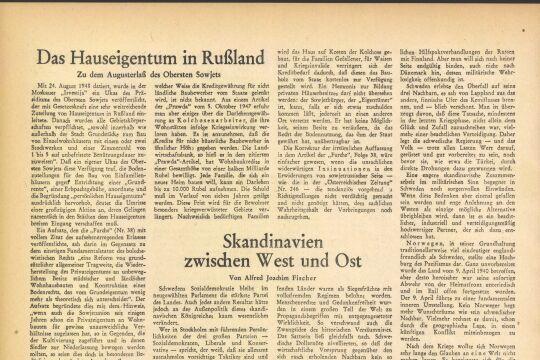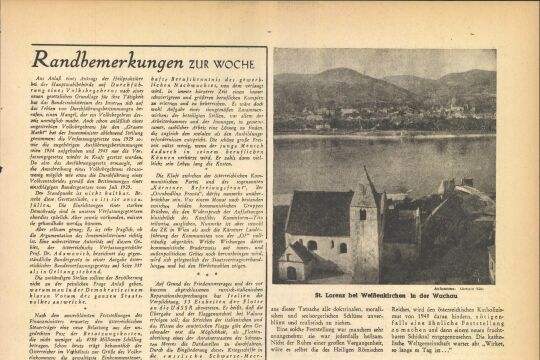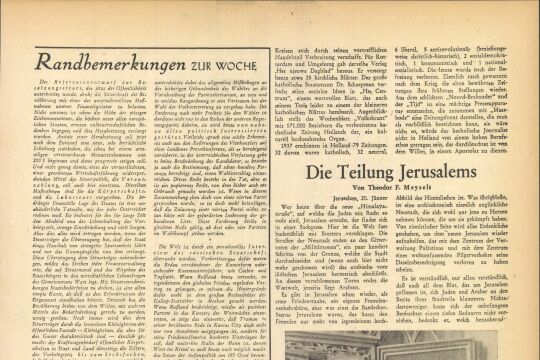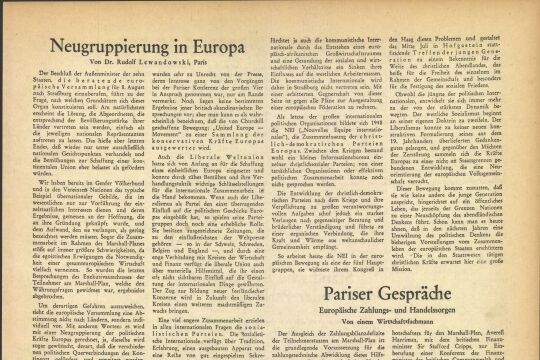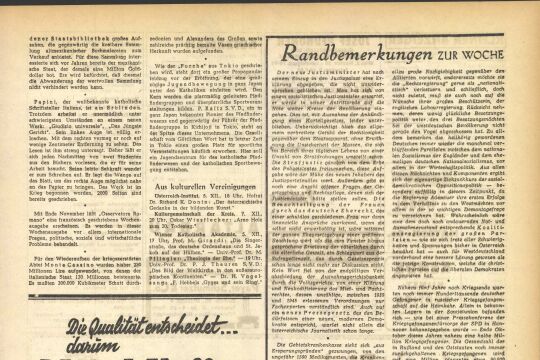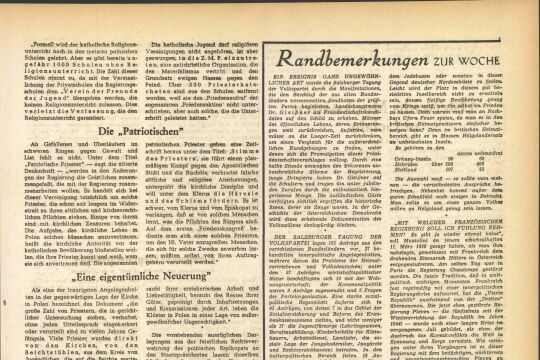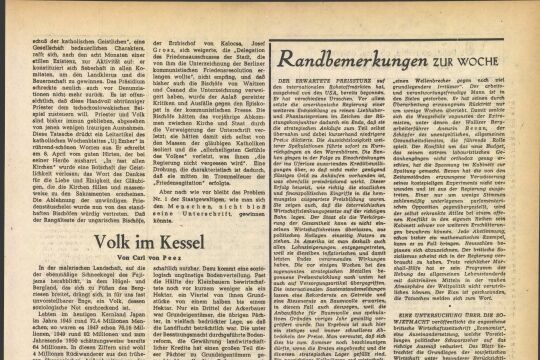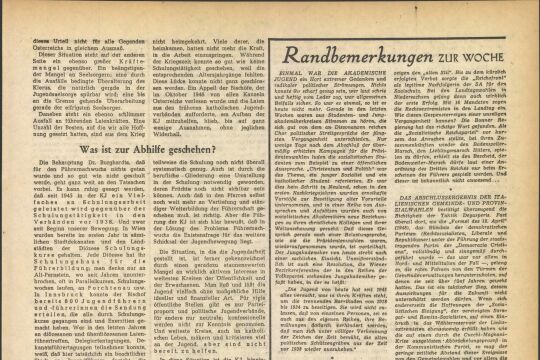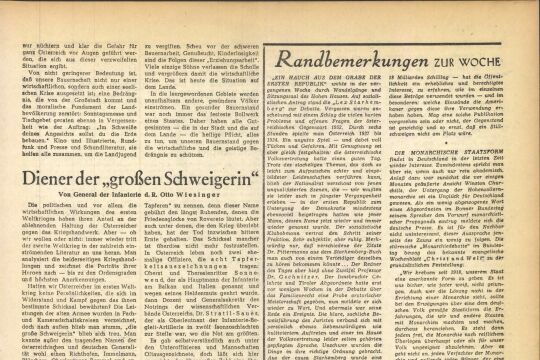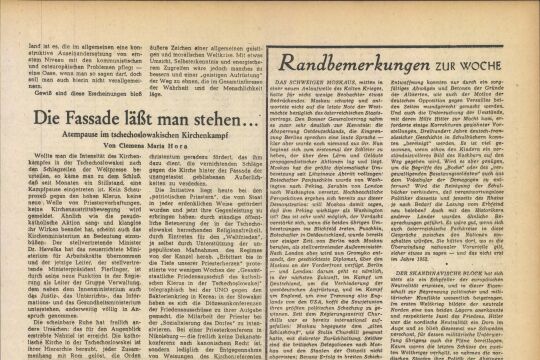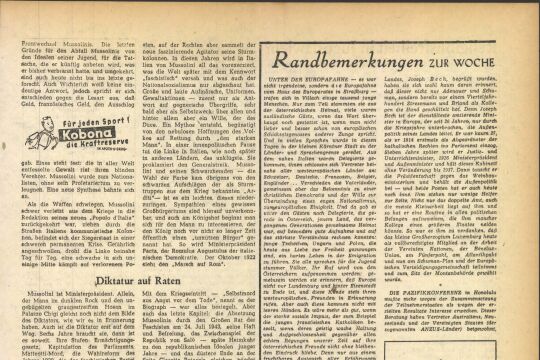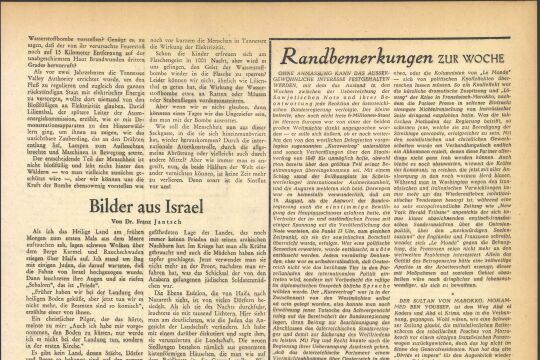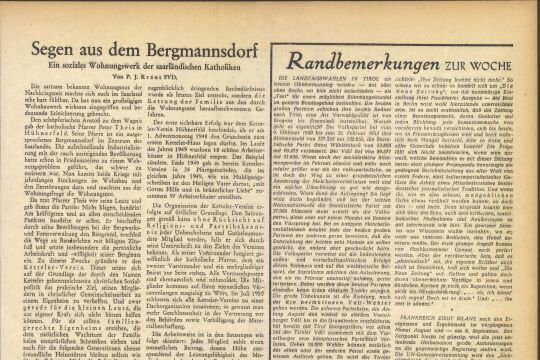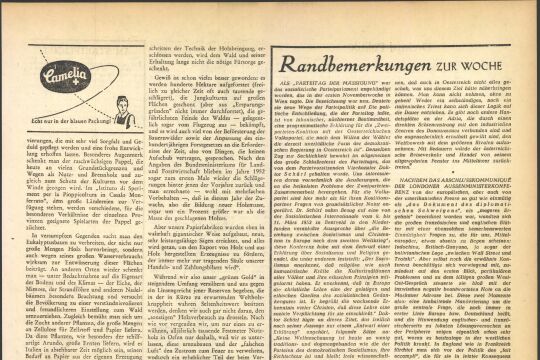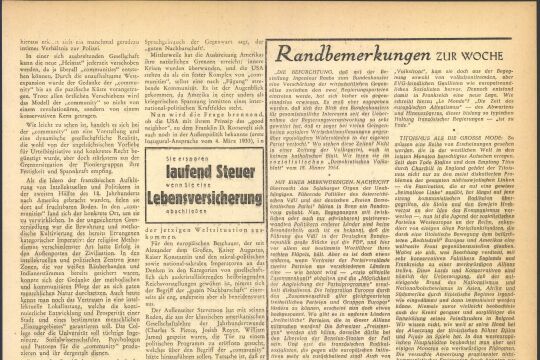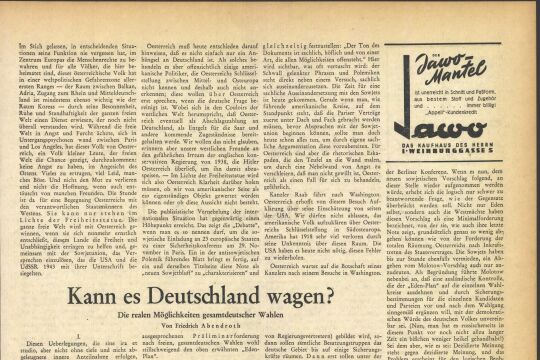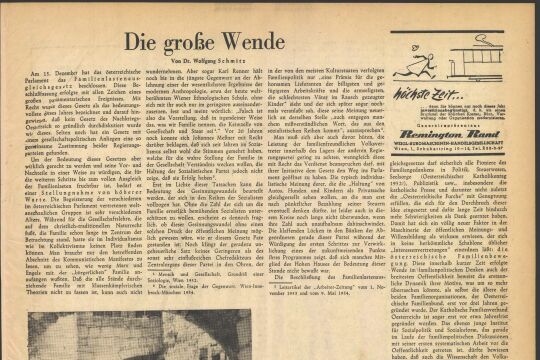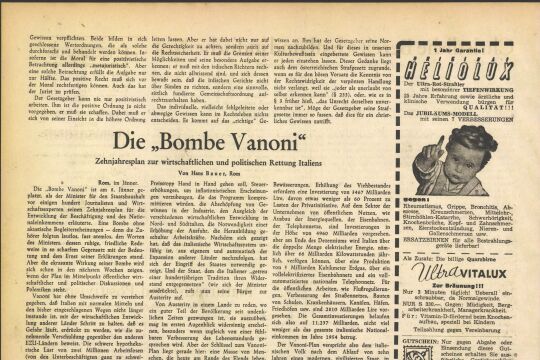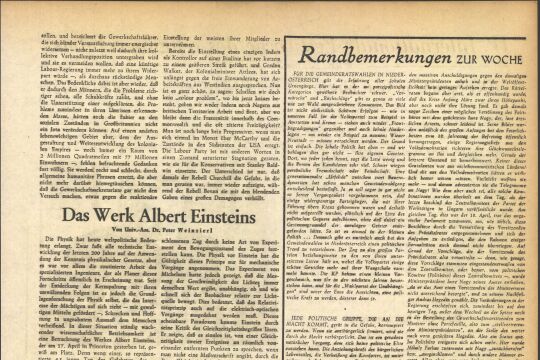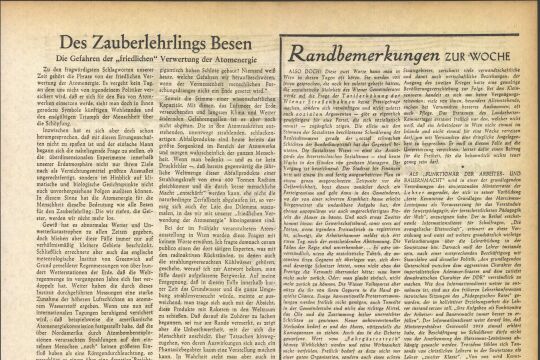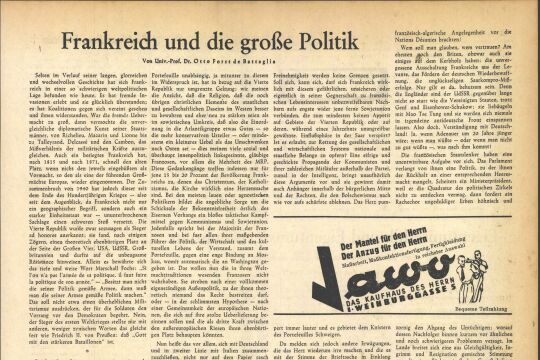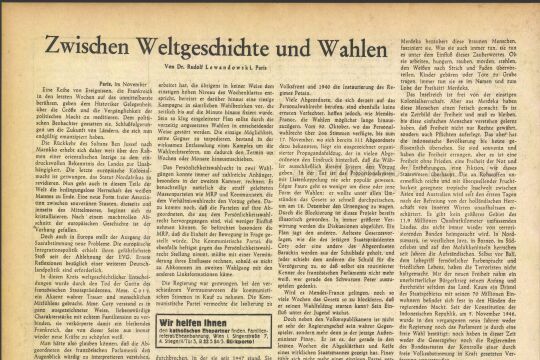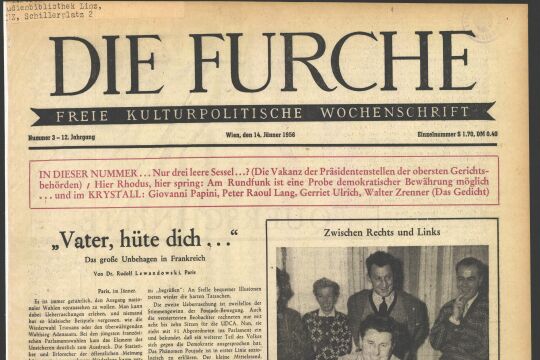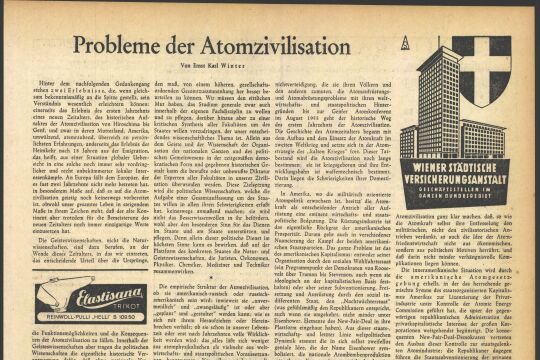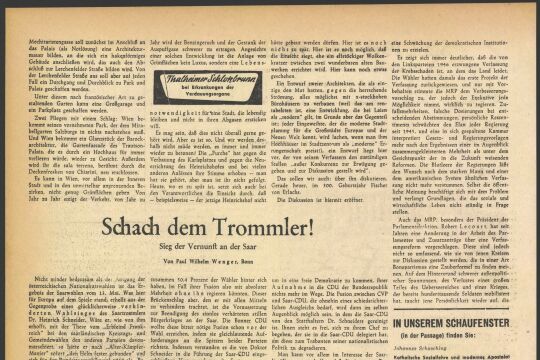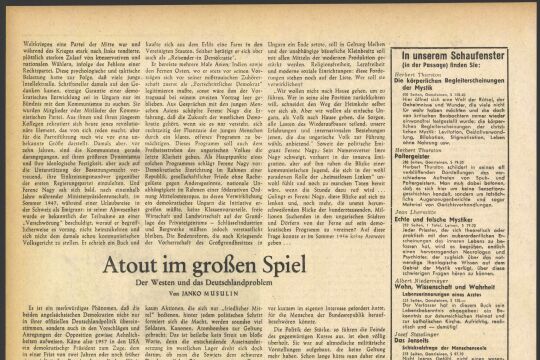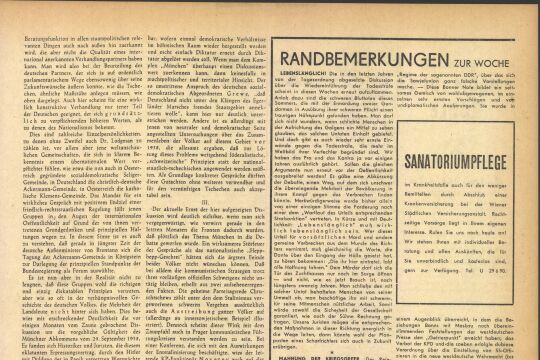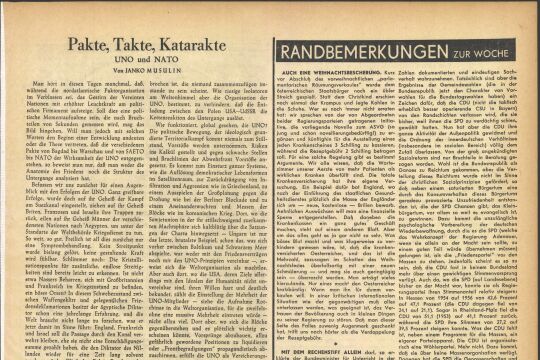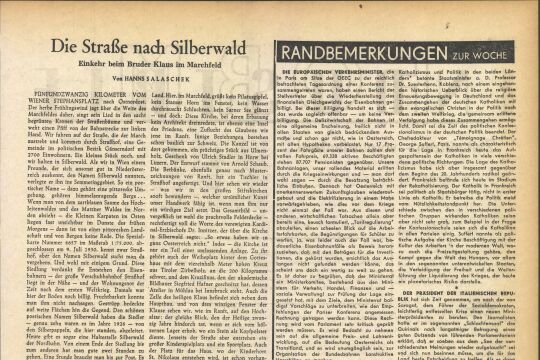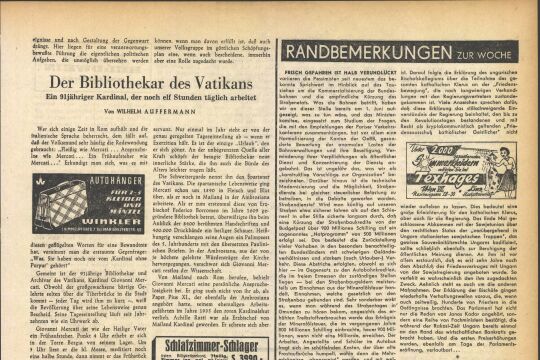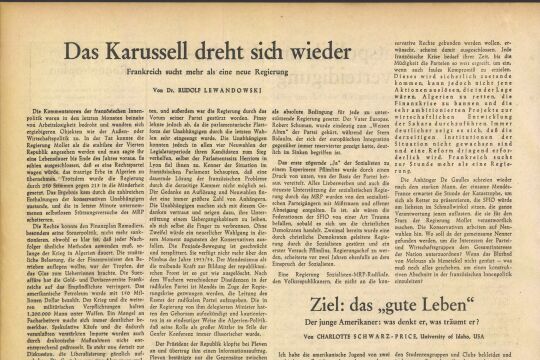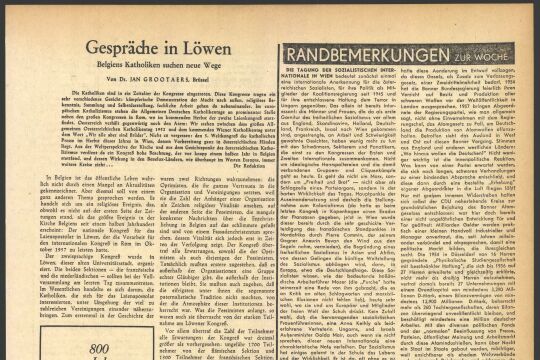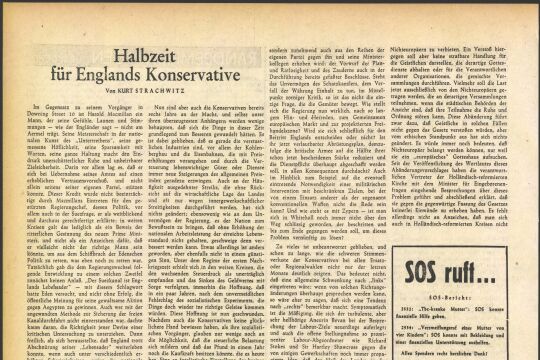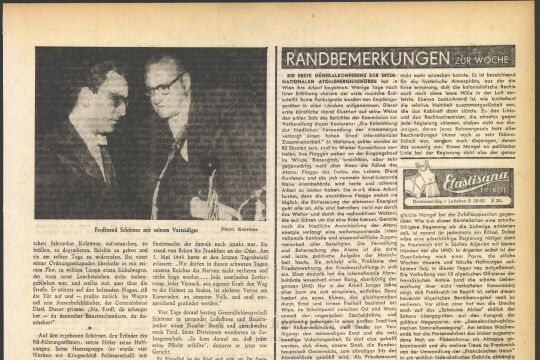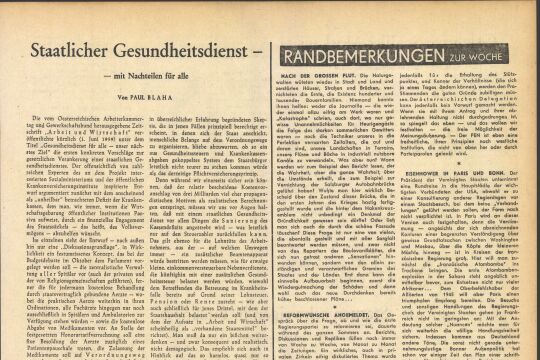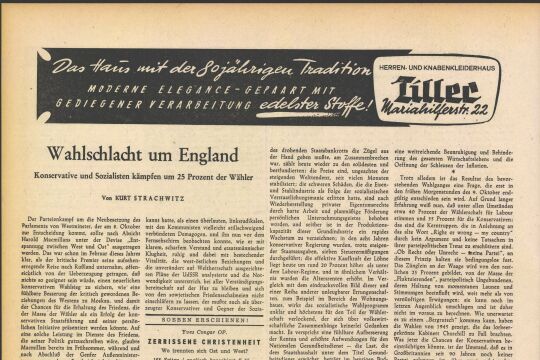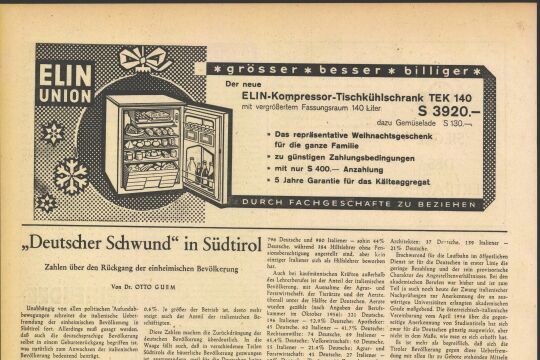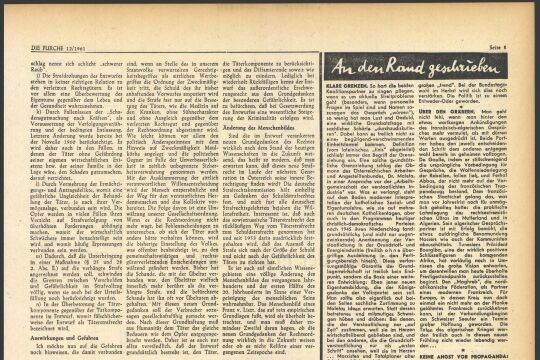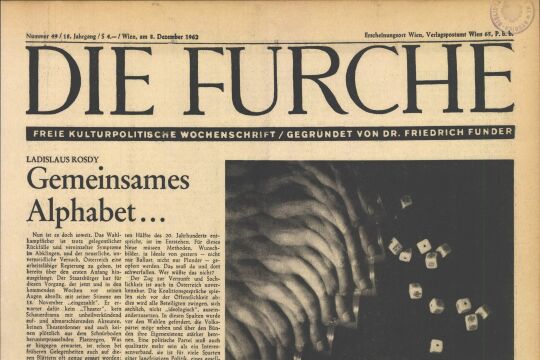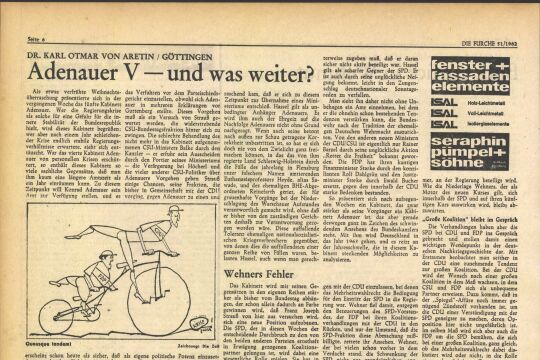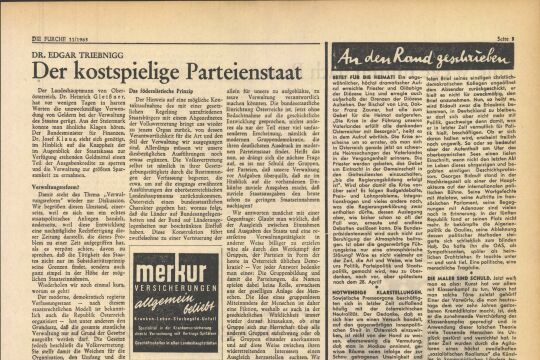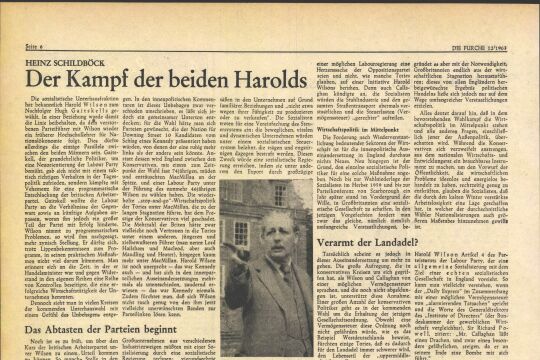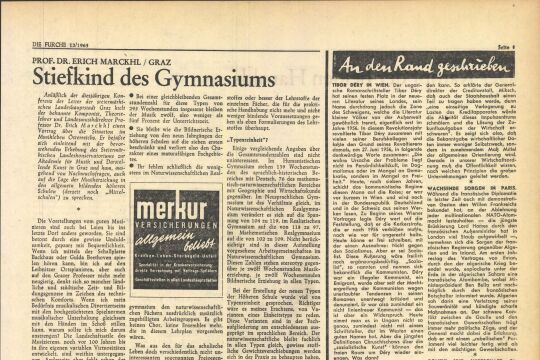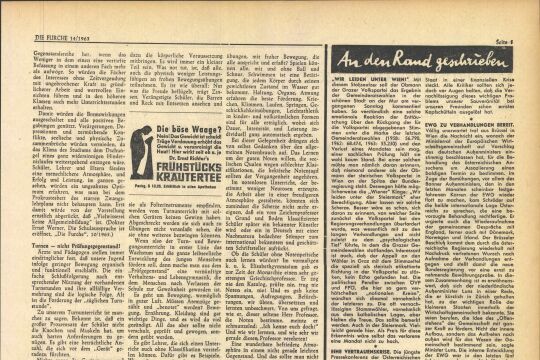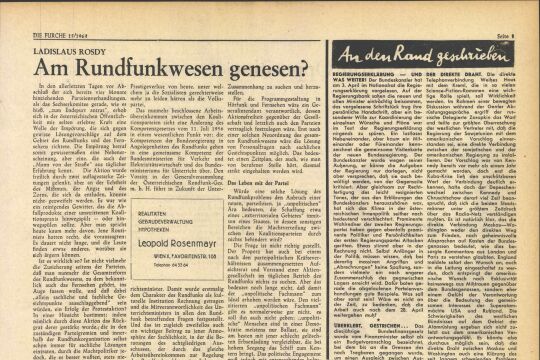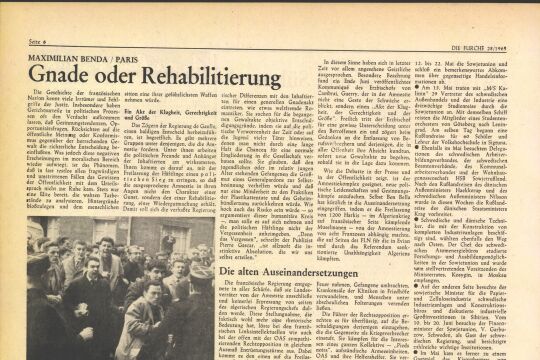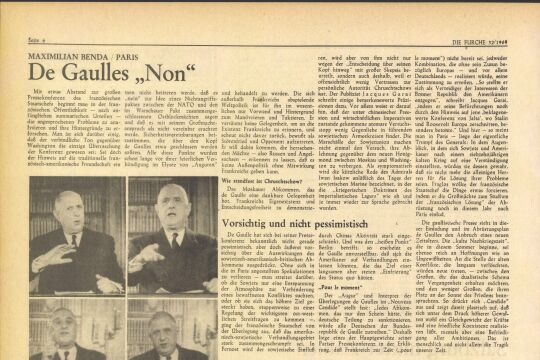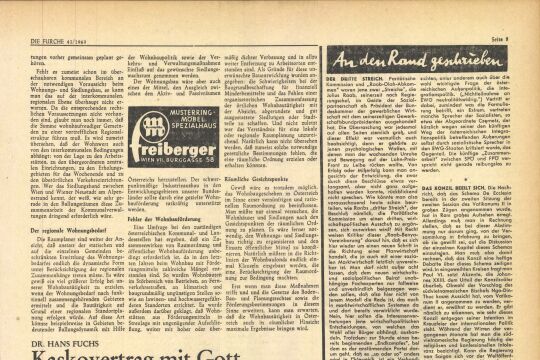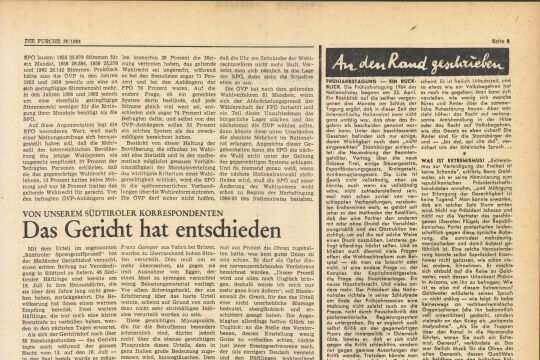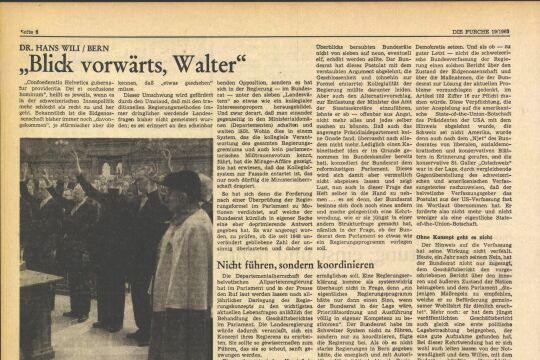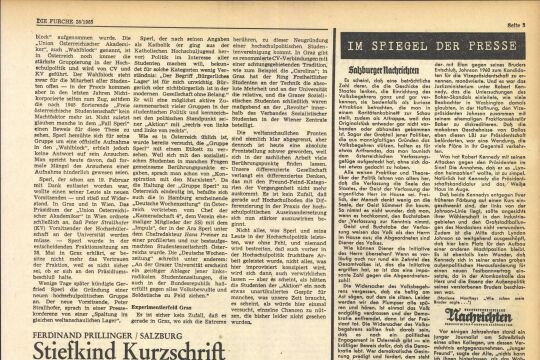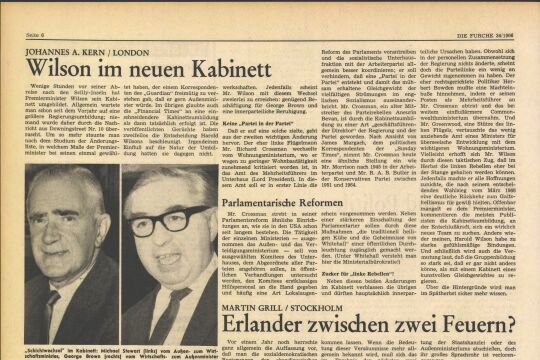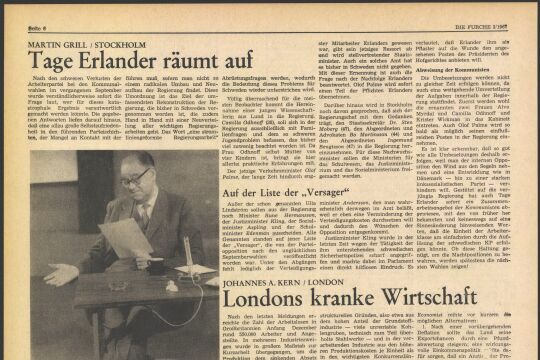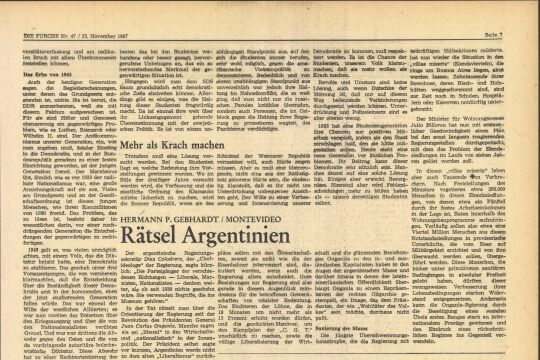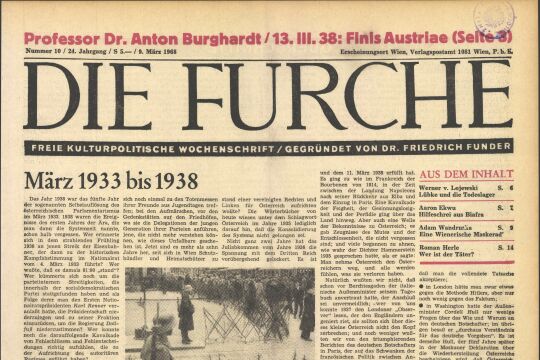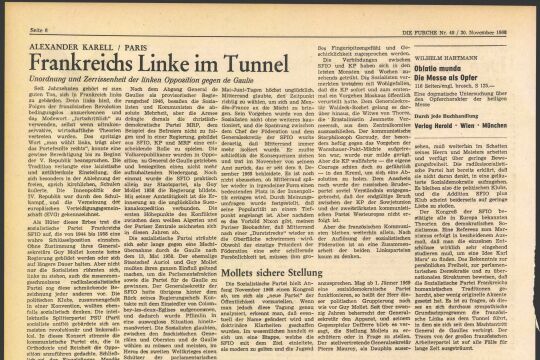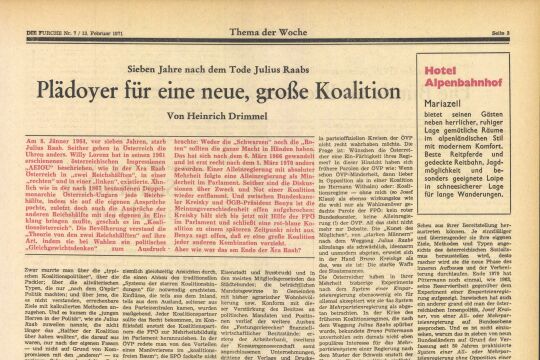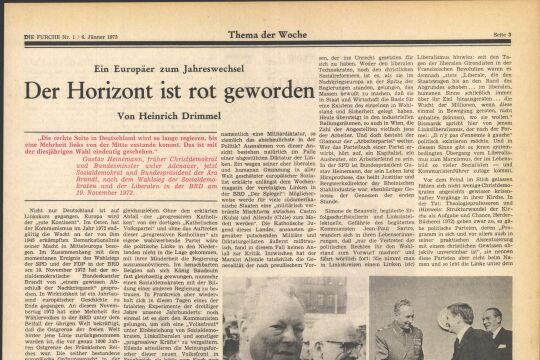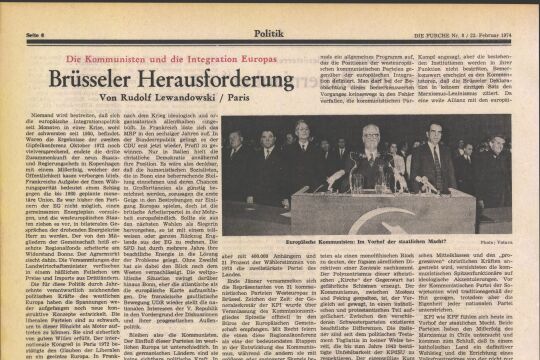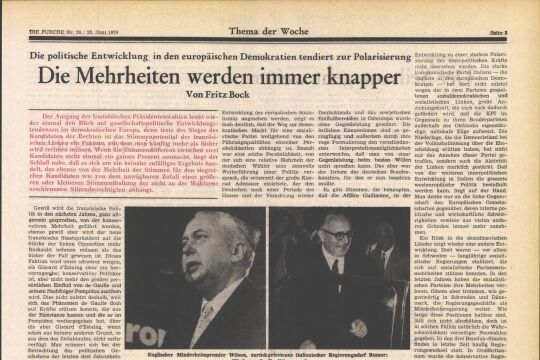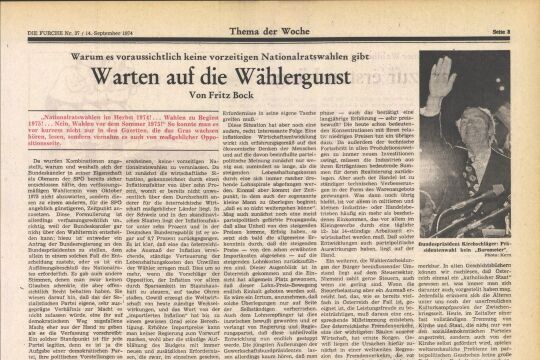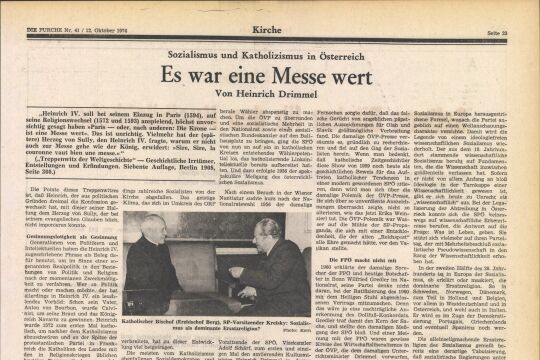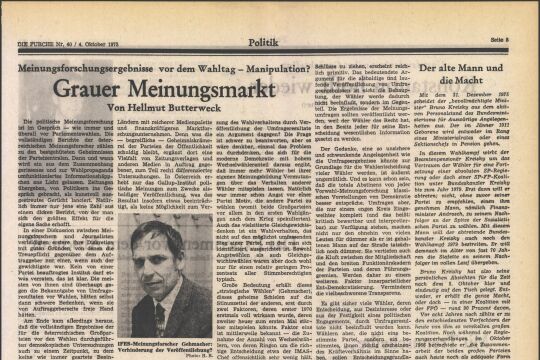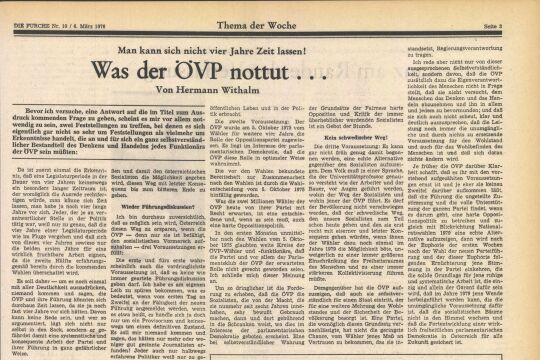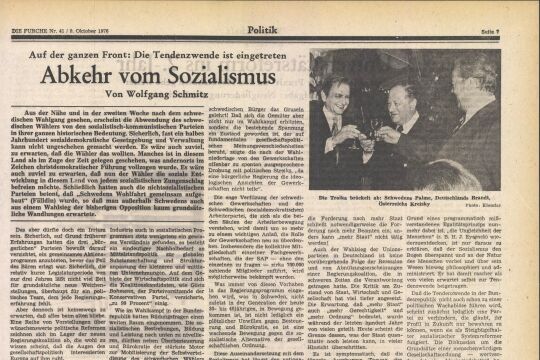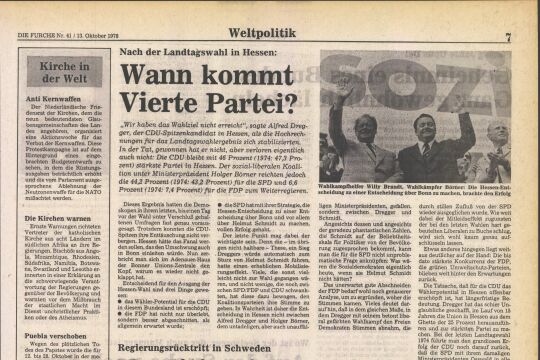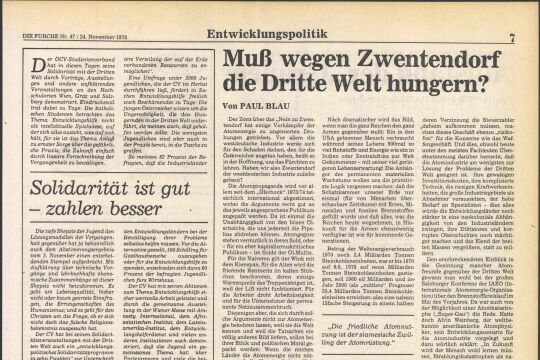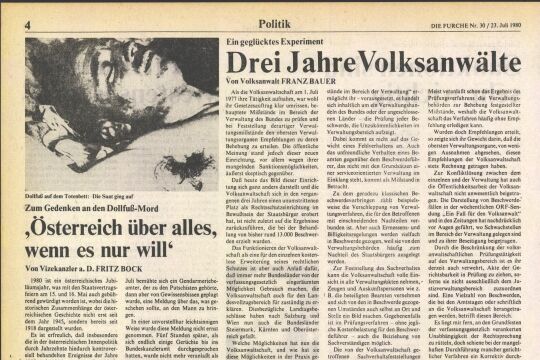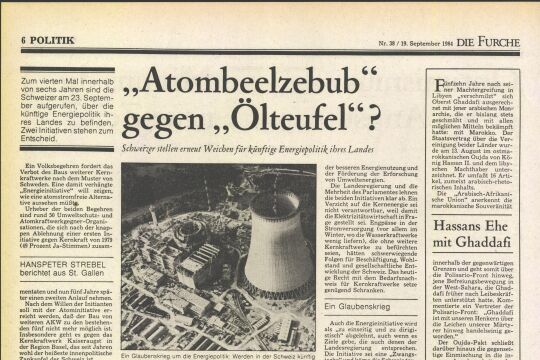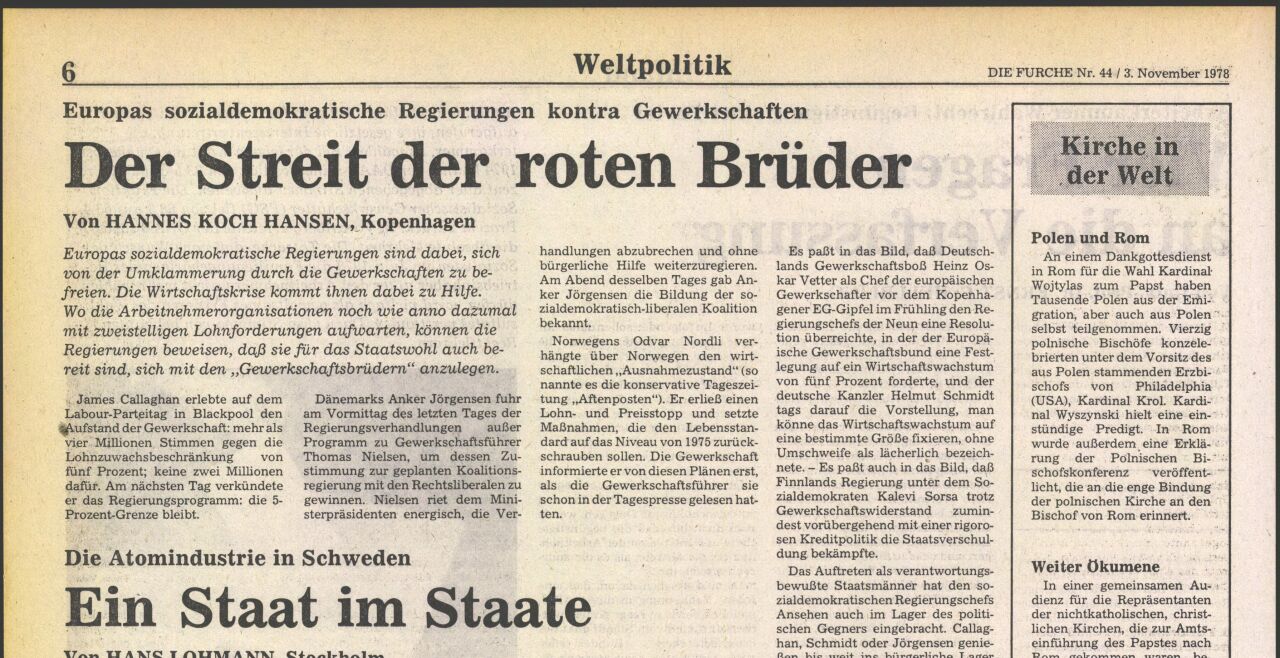
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Staat im Staate
Die österreichische Volksabstimmung in Fragen Atomenergie weckt hier in Schweden gespanntes Interesse. Wie wird die Auseinandersetzung dort ausgehen? Daß es sich um eine harte Auseinandersetzung handelt, darüber kann es nach den schwedischen Erfahrungen keinen Zweifel mehr geben.
Das schwedische Kernenergieprogramm ist das intensivste der Welt: die Pro-Kopf-Produktionskapazität an elektrischer Energie ist im Vergleich zu den USA doppelt, im Vergleich zur BRD sechsmal so groß, und das, obgleich Schweden über beachtliche Wasserkraftkapazität verfügt. Unkritisch wurden Milliarden Steuergelder in Atomenergieanlagen investiert: die Betreiber rechneten in ihrem Prognosen mit einem ständigen Anwachsen des „Energiebedarfs“, also „brauche“ Schweden 1990 24 Reaktoren.
Hinters Licht geführt
1973 besann sich der Reichstag: keine weiteren als die elf schon bewilligten Anlagen sollten genehmigt werden, bevor nicht neues, besser fundiertes Forschungsmaterial vor allem in Sicherheitsfragen vorläge.
Die Ölkrise führte dann zu einer immer lebhafteren öffentlichen Debatte. 1974 sah sich die sozialdemokratische Regierung unter Olof Palme gezwungen, eine Informationskampagne mit Studienzirkeln zu starten. Das sah recht gut, recht demokratisch aus. Heute ist leider klar, daß das Studienmaterial der im Grunde atomfreundlichen Linie der Parteispitze entsprach.
Heute wissen wir aus dem Munde eines ehemaligen Ministers, daß die Parteispitze in den fünfziger Jahren von der Atomindustrie - was Sicher-heits- und andere Probleme betrifft-hinters Licht geführt wurde. Sie hat sich bislang, trotz wachsenden Widerstands innerhalb der eigenen Reihen, von ihrer atomenergiefreundlichen Haltung nicht lösen können.
Beachtlich was im Frühjahr 1975 geschah: die Resultate der Studienzirkel hatten ergeben, daß nur etwa 16 Prozent für einen weiteren Aus-baUj nur 31 Prozent für die schon genehmigten elf Reaktoren stimmten. Der Rest war skeptisch beziehungsweise negativ. Daraus machte die Partei nun eine „breite Mehrheit für die eigene Linie“ und trumpfte dann im - selben Jahr im Reichstag (mit Hilfe der Rechts- und Volkspartei) den weiteren Ausbau durch. Kein Zweifel besteht, daß dieses Verhalten zum Fall der sozialdemokratischen Regierung im folgenden Jahr entscheidend beitrug.
Zwei Tage vor der entscheidenden Reichstagssitzung hatte eine repräsentative Bevölkerungsbefragung ergeben, daß nur 9 Prozent der Be-
fragten den Beschluß unterstützten. Der Widerstand gegen die Atomkraftwerke hat Parteigrenzen in Schweden nie gekannt. In einer Befragung nach der anderen war seit 1973 stets eine Mehrzahl gegen die Atomenergie.
So mancher atmete auf, als die bürgerliche Regierung im Herbst 1976 das „Villkors“-Gesetz erließ. Nun hatte die Atomindustrie unter Beweis zu stellen, daß radioaktiver Abfall mit absoluter Sicherheit gelagert werden könne, mit oder ohne vorhergehender Aufarbeitung: ohne diesem Beweis keine Inbetriebnahme weite-
rer Reaktoren! Wie zu erwarten, hat die schwedische Atomindustrie in diesem Jahr dann eine Planstudie vorgelegt, die ihrer Auffassung nach die Sicherheit garantiert. Sicherheit auf ewige Zeiten!
Wer nun gemeint hätte, jetzt endlich habe die Vernunft gesiegt, jetzt sei ja von technischen Experten -und nicht von „gefühlsgeladenen“, „romantischen“ Umweltfanatikern - das entscheidende Wort gesagt, der hat sich geirrt. Es sollte noch schlimmer kommen.
Thorbjörn Fälldin, Zentrumspolitiker und Ministerpräsident, regierte mit den Konservativen und Liberalen. Auch in diesen Parteien war der Widerstand groß. So optieren etwa mehr als die Hälfte der liberalen Wähler gegen Atomkraft. Aber nein: die Parteispitzen dieser beiden Parteien kümmerte das wenig. Sie waren der Ansicht, weitere Reaktoren könnten genehmigt werden.
Die Regierung Fälldin kam wegen der Unüberbrückbarkeit der Standpunkte zu Fall. Bei der Bildung der liberalen Minderheitsregierung gaben die Sozialdemokraten entscheidende Hilfestellung: der Jungtechnokrat Ullsten, kühl, effektiv und „liberal“ allen ethischen Fragen gegenüber, wird nun die Energiepolitik durchsetzen, die der Atomwirtschaft paßt. Das ist parlamentarisch zwar unanfechtbar, demokratisch hingegen sehr fragwürdig.
(Der Autor ist Facharzt für Innere Medizin und Sozialmedizin in Stockholm und hat unter anderem bei dtv/Thieme in diesem Jahr das Buch „Krankheit oder Entfremdung“ herausgebracht.)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!