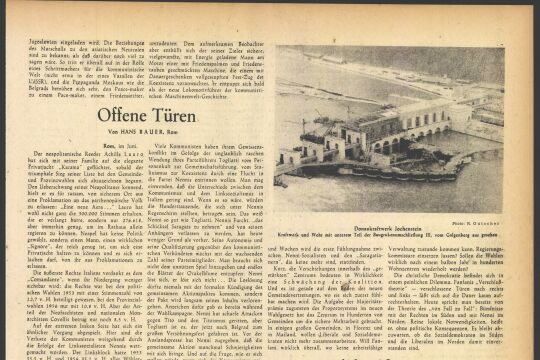Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Mit uns die Rettung -ohne uns das Chaos“
Von Turin bis Palermo brüllen es die Lautsprecher über die „piazza“ jeder Stadt, jedes Dorfes, tönt es von fahnengeschmückten Podien wie der Refrain jener vielstrophigen Schlager, die sich alle zu gleichen scheinen: „Mit uns die Rettung - ohne uns die Katastrophe des Vaterlandes!“
Meist nur müde und mechanisch heben sich die Hände zum Beifall. Und dies nicht nur dort, wo sich wenige Menschen um den Parteiredner versammeln, der sich wie ein Rufer in der Wüste fühlen muß; auch dort, wo die „Massen“ sichtbar werden, die ohnehin längst überzeugten Anhänger dieser italienischen Parteien, die nun zum drittenmal in sieben Jahren ihre Wähler mobilisieren müssen.
Diese Gleichgültigkeit, dieses schulterzuckende „Was geht mich das an“, das sich im italienischen Wählervolk ausbreitet, lähmt sogar den Widerwillen so sehr, daß nur wenige am 3. und 4. Juni den Gang zur Wahlurne (der in Italien Pflicht ist) verweigern werden.
Warum diese Teilnahmslosigkeit, die in den letzten Wochen in fast allen Parteizentralen Sorge und Spannung, eine neue Art von Wahlfieber, erzeugt hat? Müßten nicht immerhin die Terroristen der „Roten Brigaden“, die Tag für Tag landauf landab mit Feuer, Sprengstoff und Schüssen ihren „Wahlkampf' führen, das Land aufrütteln? Oder schlägt auch da die Furcht allmählich in Resignation oder Gewöhnung um?
Gewiß, wenn wieder einmal einer der armen, hilflosen Polizisten, die aus der Misere des italienischen Südens in die schöne Uniform geflüchtet sind, in seinem Blut liegt, dann gibt es eine Protestdemonstration mit Fahnen und Spruchbändern. Und die Nation erlebt, wie sich - mitten im Wahlkampf - Kommunistenchef Berlinguer und Christenchef Zaccagnini auf dem gemeinsamen Podium die Hand reichen.
Wozu dann der Streit, der Bruch der Regierungskoalition, der Wahlkampf - hätten sie nicht gleich zusammenbleiben können?, fragt sich der Mann auf der Straße, nicht mehr so sehr verwirrt als verbittert. Und wenn die „nationale Solidarität“, die seit bald drei Jahren und selbst jetzt noch beschworen wird, sich nicht in praktische, dauerhafte Regierungsarbeit umsetzen ließ - wozu dann diese Szene?
So bleibt das politische Gift nicht ganz wirkungslos, das die Terroristen auf den Schauplätzen ihrer Attentate hinterlassen, wenn sie in roten Lettern und falscher Rechtschreibung gegen den „Wahlschwindel“ zu kämpfen vorgeben. Es nistet sich ein in den Rissen, die zwischen der „classe politica“, der Führungsschicht Italiens, und der breiten Bevölkerung, der „Gesellschaft“, immer tiefer klaffen, während sich die Politiker ihrem Selbstgespräch, der Selbstbefriedigung ihres Spiels mit Positionen und Formeln hingeben.
Dies ist nur die eine Seite der Wirklichkeit. Italien gab in den letzten Jahren auch Beweise seiner Vitalität, seiner Fähigkeit, zur Steuerung von Krisen. Seine Wirtschaft, die vom Zusammenbruch bedroht war, hat sich über Wasser gehalten: Es wurde mehr produziert, weniger gestreikt, der Schuldenberg nahm ab, die Lira gewann an Stabilität (gebunden an das europäische Währungssystem) -all das freilich um den Preis von zwei Millionen Arbeitslosen, einer Inflationsrate von immer noch 14 Prozent und eines Verzichts auf manche jener Reformen, auf die das Land schon lange, sein armer Süden seit Generationen wartet. \
Doch damals, im Wahljahr 1976, als alle Welt noch gebannt nach Italien bückte, war auch die Linke, die kommunistische und sozialistische, bereit, diesen Preis mitzubezahlen. Weil es zugleich der Preis für die große „Wende“ zu sein schien, die „alles anders“ machen sollte. Diese Stimmung, die damals den Wahlkampf zum spannenden Schauspiel machte, wirkte ansteckend auf Freunde und Gegner dieser „Wende“.
Und heute? Es ist leicht einander die Schuld dafür zuzuschieben, daß
die Krise geblieben und die „Wende“ ausgebheben ist, unendlich schwer jedoch, dem Wählervolk klarzumachen, daß man die Katastrophe verhindert und ein paar Weichen für die Zukunft gestellt hat - vor allem dank eines sachverständigen, vorurteilslosen Regierungschefs wie des Christdemokraten Andreotti und eines ruhigen, klugen Pragmatikers wie des Kommunisten Berlinguer. Zuerst durch die künstliche Formel des „Nicht-Mißtrauens“, dann durch Aufnahme der Kommunisten in die Regierungsmehrheit ohne Ministerposten, wurde jene „kommunistische Frage“, die in dreißig Jahren zur un-abtragbaren Hypothek der italienischen Politik geworden ist, nicht etwa gelöst - sondern vertagt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Aldo Moro war der Architekt dieses Waffenstillstandes, das nicht etwa zum Bündnis, sondern zum künftigen demokratischen Machtwechsel (natürlich mit einer tief „gewandelten“ KP) führen sollte. Am Tag der Entführung dieses Christdemokraten wurde die Regierung Andreotti mit der größten Mehrheit in Italiens Nachkriegsgeschichte in den Sattel gehoben, war der Höhepunkt des Experimentes erreicht.
Der Staat, die Parteien, die Demokratie Italiens bestanden im Frühjahr 1978 trotz, ja vielleicht wegen ihrer Schwäche die Kraftprobe der terroristischen Herausforderung. Auf der Strecke blieb Aldo Moro. Auch, wie heute viele meinen, sein langfristiges Konzept? Sollten die Terroristen am Ende doch ihr Ziel - ,je schlimmer, desto besser“ - erreicht haben?
Den großen Hauptdarstellern auf der Bühne dieses italienischen Wahlkampfes sitzt diese Frage im Nacken; nur so sind viele ihrer verkrampften, widerspruchsvollen Deklamationen zu erklären. Die Kommunisten, die ihrem zweieinhalbjährigen Schwebezustand zwischen Opposition und Regierungsverantwortung entkommen sind, könnten jetzt gelassen darauf vertrauen, daß sie, auch wenn sie ein paar Prozent verlieren sollten (was denkbar ist), die zweitstärkste Partei bleiben können; und in der Opposition nur wieder stärker werden - in einem Lande, in dem ja nicht ohne Ursache Millionen kommunistisch wählen.
Doch Berlinguer, der die Wahlparole ausgegeben hat, die Democrazia Cristiana zu „schlagen“, ihr Stimmen abzujagen, sie weichzuklopfen, er will zugleich unbeirrt zurück zum Kompromiß mit eben diesem Gegner. Dabei muß er alle Beweise seiner demokratischen Glaubwürdigkeit, aller Lockerungen und Demontagen am leninistischen Korsett der KPI
(die zum Teil sehr weit gehen und Wähler von rechts anlocken) eher herunterspielen, um extrem linke Anhänger nicht zu verschrecken.
Er steht Tito näher als - Bruno Kreisky, so formuliert er jetzt delikat. Mit keiner Zwischenlösung will er sich mehr begnügen, nur die volle Regierungsbeteiligung ist sein Ziel. Aber „Alles oder nichts“ steht auf ebenso tönernen Füßen wie das feierliche „niemals“, auf das sich die Christdemokraten bei ihrer letzten Nationalratssitzung in verschnörkelten Formulierungen festgelegt hatten. Um das ominöse Wörtchen dann nach Tagen „redaktioneller“ Arbeit wieder unter den Tisch fallen zu lassen. Vielleicht auch nur, weil man in der Politik niemals „niemals“ sagen soll...
Die „Politik der nationalen Solidarität“, an der sie (wie die Kommunisten) festhalten, läßt wenigstens theoretisch mehrere Lösungen zu und scheidet daher auch die Geister im christdemokratischen Parteivorstand schon ehe das Wahlergebnis vorliegt: Andreotti, Zaccagnini und die Mehrheit wollen die Brücken zu den Kommunisten nicht abbrechen; eine starke Minderheit meint mit gutem Grund, daß man mit solcher Unklarheit nur Wähler vergrault. Ein „alter Kämpfer“ wie Fanfani malt die Gefahr an die Wand, daß die Kommunisten stärkste Partei werden könnten und - setzt der eigenen Partei das (ebenso unwahrscheinliche) Ziel der absoluten Mehrheit.
Auftrieb erhoffen sich die Christdemokraten vom frischen Wind, mit dem der „polnische“ Papst Italiens Katholiken, vor allem die Jugend, in Bewegung gebracht hat. Doch der könnte auch in andere Segel blasen, seit Wojtyla klarmachte, daß er Katholiken, für die Kommunisten kandidieren, noch immer als katholisch, wenn auch nicht als „konsequent“ betrachtet. Und wer kann ausrechnen, für wen ein Papst zu Buche schlägt, der zufällig am Tage der Wahl in einem kommunistischen Land von Millionen Gläubigen umjubelt wird?
Nur auf ein einziges „Wunder“ hoffen die Christdemokraten: daß die Sozialisten Bettino Craxis stark genug und dadurch koalitionsbereit werden könnten. Fanfani winkt dem linken Bruder sogar schon mit dem Sessel des Ministerpräsidenten, indes Craxi selbst Mühe hat, zwischen den Stühlen der beiden Großen zu schaukeln: Kann er seine knapp zehn Prozent Wähler vermehren und sich zur „dritten Kraft“ stilisieren, indem er mit Kommunisten wie mit Christdemokraten sowohl liebäugelt als auch zürnt?
Derlei kann ein anderer viel besser: Marco Pannella, Chef der „Radikalen Partei“, extrem links und rechts und liberal und sozialistisch - der einzige Wahlredner, der niemanden langweilt, allen Nörglern aus der Seele spricht und offen zugibt, daß er kein
Programm besitzt. Zum erstenmal fürchten ihn alle ein wenig, weil er mit drei bis fünf Prozent zum „Gewinner“ werden könnte.
Denn fast niemand glaubt an echte Kräfteverschiebungen. Es müßte zwar alles anders werden, heißt es im Wahlkampf, aber nur - um mit Lampedusa „Leopard“ zu sprechen - damit alles so bleibt wie es ist. Ein schwacher Trost für Italien und Europa, die einander brauchen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!