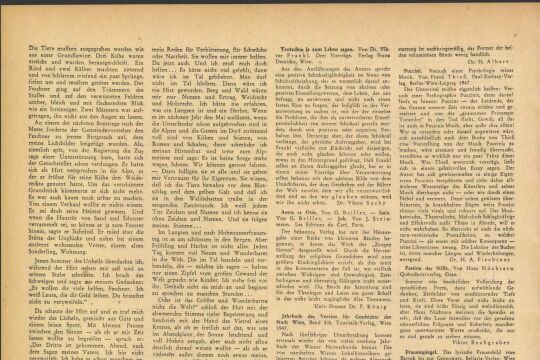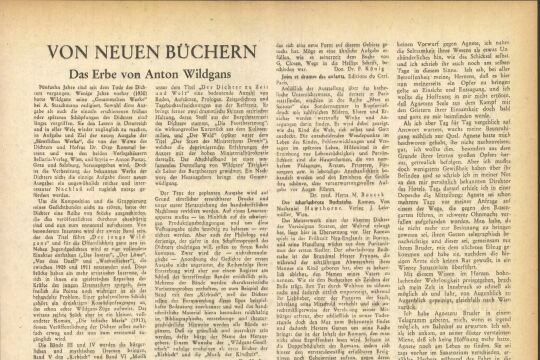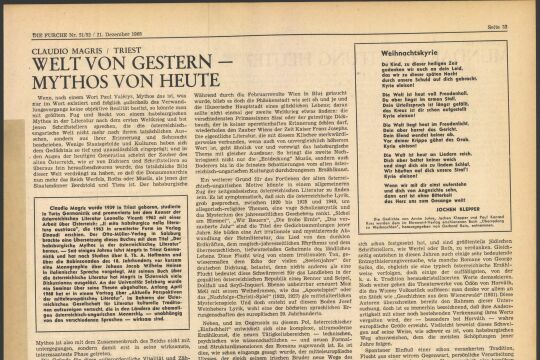Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Unverkennbar österreichisch
„Und Theodor ging mit Benjamin aus dem Hause.“
Niemand würde diesem Satz — er steht auf der vorletzten Seite des Romans „Das Spinnennetz“ — ohne Kenntnis des Zusammenhangs anmerken, daß Benjamin wenige Zeilen zuvor von Theodor beim Photo-graphieren geheimer Akten überrascht wurde, daß Theodor ihn einen Spitzel genannt und Benjamin den Freund mit einem Revolver bedroht hatte. Niemand würde diesem Satz die Schicksalsträchtigkeit anmerken, die sich in ihm zusammenballt und die in der lapidaren, in der nahezu biblischen Einfachheit der Wortwahl nur desto rasanter hervortritt.
Tatsächlich: von manchen der gemeißelten Sätze Joseph Roths fühlt man sich auf ähnlich wuchtige Weise ergriffen wie von manchen Sätzen der Bibel — im vorliegenden Fall wird der Anklang an das XXIII. Kapitel der Genesis, handelnd vom Opfergang Abrahams mit seinem Sohne Isaak, beinahe überdeutlich: „Und gingen sie beide miteinander.“ So simpel sind diese Sätze, so schmucklos und scheinbar eindeutig bieten sie sich dar, daß sie eben dadurch ihre Eindeutigkeit desavouieren. Das kann doch nicht alles sein, was sie bedeuten wollen, da muß doch noch etwas verborgen sein. Und weiß Gott, das ist es.
Hier, wenn nicht alles täuscht, liegt das große stilistische Geheimnis der Rothschen Prosa, liegt die Wurzel der Wirkung, die von ihrer Doppelbödigkeit ausgeht. Es ist eine unentrinnbar eindringliche Wirkung. Den kunstvoll verschlungenen Perioden eines Thomas Mann oder eines Hermann Broch kann, wer's drauf angelegt hat, an ihren Nahtstellen entschlüpfen. Von den nicht nur grammatikalisch „reinen, einfachen Aussagesätzen“ Joseph Roths wird man sich ausweglos umgarnt finden. Sie haben — außer in der Bibel — ihr einziges Gegenstück in der Prosa Franz Kafkas.
Ein Beispiel aus „Hiob“, Roths bibelnächstem und (für mein Gefühl) schönstem Roman. Dort geschieht es, daß Mirjam, die Tochter des heimgesuchten Mendel Singer, nachdem sie ihr Gesicht mit den Händen bedeckt hat und in Tränen ausgebrochen ist, vor das Haus gewiesen wird:
„Sie tastete sich hinaus, vorsichtig, die Hände immer noch vor den Augen. Draußen blieb sie stehen. Alle Sterne des Himmels standen da, nah und lebendig, als hätten sie Mirjam vor dem Haus erwartet.“
Es sind wahrhaftig alle Sterne, welche dastehen. Und es gibt, so will mir scheinen, keinen zweiten Autor, der sie mit solchem Umfassungsver-mögen einzufangen wüßte.
Der Roman „Hiob“ beschließt den ersten der beiden Bände, mit denen der Verlag Kiepenheuer & Witsch die vierbändige, um einen vollen Band erweiterte Neuausgabe der Werke Joseph Roths eingeleitet hat. Der erste Band enthält als gewichtige Bereicherung zwei verspätet aufgefundene Prosawerke, neben dem schon erwähnten „Spinnennetz“ noch den Trotzki-Roman „Der stumme Prophet“; den Inhalt des zweiten Bandes bilden die schon veröffentlichten, zum Teil im Exil entstandenen Romane vom „Radetzkymarsch“ bis zur „Kapuzinergruft“ und der „Geschichte von der 1002. Nacht“. Die Anordnung ist chronologisch, die Herausgabe besorgte — wie stets bisher — Hermann Kesten, dessen Vorwort zur Neuausgabe, zumal wo es die Zustandebringung des Nachlasses schildert, ein aufschlußreiches Kapitel Zeitgeschichte liefert.
Daß der Nachlaß auch mit diesen zwei Bänden und den beiden kommenden („Erzählungen“ und „Kleine Prosa“) noch immer nicht vollständig vorliegen wird und daß mit einer kritisch-historischen Gesamtausgabe in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist, tut dem Romanwerk Joseph Roths keinen Abbruch. Das haben wir jetzt, auf mehr als 2000 Dünndruckseiten, vollständig vor uns: als gewaltigen, leuchtend gewebten Gobelin des alten Österreich, vor allem des Ostens der einstigen Monarchie, jener „Versuchsstation für Weltun-
tergänge“, wie Karl Kraus sie genannt hat. Und sie sind alle da, die vertrauten Gestalten, die Grafen und die Juden und die Trottas, die Offiziere und die Bürger und die Entwurzelten, die Randfiguren mit ihren immer gleichen Namen, die Kapturaks und Skowronneks, bis ins kleinste bleibt die Kontinuität gewahrt und wenn ein Militärkapellmeister auftritt, heißt er sowohl im „Radetzkymarsch“ wie in der „Geschichte von der 1002. Nacht“ Nech-wal, als könnte ein Militärkapellmeister gar nicht anders heißen. Das Gewebe ist unzerreißbar.
Mit diesem anspruchsvollen editorischen Unternehmen hat der Verlag Kiepenheuer & Witsch zweifellos dazu beigetragen, einem der großen Prosaisten des deutschen Sprachraums den gebührenden Platz zu sichern. Hoffentlich wird ihm auch der gebührende Erfolg zuteil. Oder wie es im „Hiob“ heißt: „Alle gaben ihm die Hand und wünschten ihm gute Fahrt.“
*
Wenn innerhalb des deutschen Sprachraums eine eigenständige österreichische Literatur existiert — und nicht nur angesichts Joseph Roths, auch im Hinblick auf die zwei Generationen von Schnitzler bis Doderer ist das kaum zu bestreiten —, dann liegt es nahe, nach der jungen Generation von heute zu fragen, der eigentlich vierten.
Peter Henisch, einer ihrer begabtesten Repräsentanten, soll nun nicht etwa mit Joseph Roth „verglichen“ Werden. Ein solcher Vergleich wäre unfair und würde im übrigen auch den meisten seiner Altersgenossen (nebst vielen Vorangegangenen) nicht gut bekommen. Immerhin ist auch Henisch ein unverkennbarer Österreicher, wenngleich auf andere Art als beispielsweise Peter Handke, dessen literarische Zugehörigkeit sich von Karl Kraus und Horväth herleitet, oder gar als Thomas Bernhard, der am ehesten in der Nach-
folge Stifters steht (indessen die Eisenreich und Tramin sich bereits an Doderer orientieren). Henisch auf einen bestimmten Ahnherrn festzulegen, hielte schon deshalb schwer, weil er noch in sichtbarer Entwicklung begriffen ist und sich von seinen avantgardistischen Anfängen — einer verspäteten Zweigniederlassung der nouvelle vague — immer weiter entfernt.
Was ihn als Österreicher legitimiert, tritt in seinem jüngsten, soeben bei S- Fischer erschienenen semi-biographischen Werk — „Die kleine Figur meines Vaters“ — noch deutlicher zutage als in den vorangegangenen „Geschichten vom Baronkarl“ und läßt überdies zwei merkwürdige Ähnlichkeiten mit Joseph Roth erkennen: die selbstverständliche Bindung an ein persönliches Lokalkolorit (das bei Henisch durchaus mit der Wiener Vorstadt identisch ist) und die Fähigkeit, an einem Einzelschicksal zeitgeschichtliche Abläufe transparent zu machen.
Das Einzelschicksal ist das seines Vaters, der den Zweiten Weltkrieg als Bilderberichterstatter der Wehrmacht miterlebt und überlebt hat. Viele Jahre später läßt Henisch, auf der Suche nach der eigenen Identität, seinen zum Tode erkrankten Vater über die Kriegs- und Nachkriegszeit erzählen und hält diese Erzählungen — mit des Vaters willigem, ja freudigem Einverständnis — auf Tonbändern fest. Die Wiedergabe der Texte verzahnt sich mit den Kommentaren von Mutter und Großmutter, mit Rückgriffen auf überholte familiäre Zustände, besonders aber mit den frühen Kindheitserinnerungen und den jetzigen kritischen Gedankengängen des Autors zu einem kompakten, trotz allen Zwischenschnitten klar überschaubaren Zeitgemälde, das jedoch die Charakterisierung der handelnden Personen keineswegs zu kurz kommen läßt. Nicht bloß der vorsätzlich zur „Figur“ stilisierte Vater (die „Kleinheit“
bezieht sich auf seine Körpermaße), auch die Nebenfiguren und Episodi-sten haben unverwechselbare Farbe und Funktion, legen beredtes Zeugnis dafür ab, wie präzise und komprimiert Peter Henisch seine künstlerischen Mittel einzusetzen gelernt hat.
Diese Präzision kommt auch sprachlich in einer abermals an Roth gemahnenden Einfachheit zur Geltung: ein Knabe, der sich von der Stimme seines Stiefvaters „schon am frühen Morgen geohrfeigt fühlt“; die Türe eines Rettungsautos „wurde geöffnet und die Bahre hineingeschoben wie das Brot in den Ofen“; und der kleine Peter bastelte sich aus einer Spielzeugschachtel einen Photoapparat und „hielt, ein perfektes Abbild meines Vaters, eine Kamera zwischen mich und die Welt“.
Denn genau das hat sein Vater getan. Er hat die Welt in der Tat — und im fatalsten Sinn dieser Wendung — nur durch die Kamera gesehen. Dem Photoreporter des Grauens ist das Grauen nur als Reportagematerial bewußt geworden, die Saalschlachten der Vor-Nazizeit nur als „fotogene Tumulte“, die Sterbenden auf den Schlachtfeldern zum „menschlichen Antlitz des Krieges“, er sagt es selbst, und das kommentarlose Klischee entlarvt nicht die Wirklichkeit, sondern die Einstellung zu ihr: „Als Mensch tut es mir furchtbar leid, als Photograph ist es für mich ein Motiv.“ Es fällt ihm nicht einmal auf, daß er seine Bilder „schießt“, während ringsumher wirklich geschossen wird. Und getroffen.
Der Sohn aber, weit entfernt von jeglicher Selbstgerechtigkeit, entdeckt so betreten wie nüchtern, daß er auch noch in anderer Hinsicht ein Abbild seines Vaters ist: was diesem zum bildhaften Motiv wird, verwandelt, sich ihm selbst zum literarischen Text. Das Leben ist in beiden Fällen Material.
Nur daß der Schriftsteller Peter Henisch mit seinem Material dem Leben zugewandt ist, daß er nicht aus dem Tod Kapital schlagen will, sondern sich mit dem Leben herumzuschlagen gedenkt. Vielleicht glaubt er seine erzählerische Begabung noch allzu sehr an Selbsterlebtes gebunden. Aber das macht sie um nichts geringer. Das macht sie ausbaufähig.
WERKE IN VIER BÄNDEN. Von Joseph Roth, herausgegeben von Hermann Kesten. Band 1 und 2, 980 und 1148 Seiten. Kiepenheuer & Witsch, zusammen 1078 Schilling.
DIE KLEINE FIGUR MEINES VATERS. Erzählung von Peter Henisch. S. Fischer, Frankfurt, 192 Seiten, 153 Schilling.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!