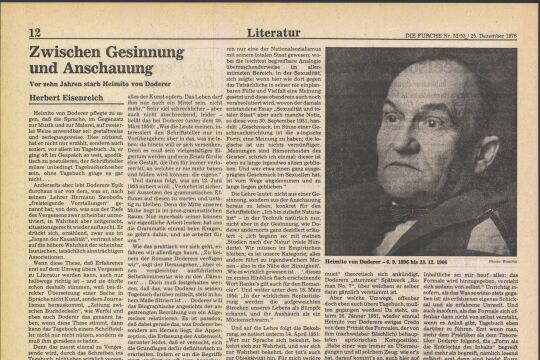Seitdem ich in seinem letzten Roman von dem „Krono-tron“ gelesen hatte, fürchtete ich, daß Peter von Tramin Naturwissenschaftler oder Hobbymathematiker ist, der an dem technischen Ungeheuer bastelt, das die Zeit manipuliert und Menschen mit Raketengeschwindigkeit in die Vergangenheit befördert. Dabei wirkt das Haus in der Wiedner Hauptstraße, vor dem ich stehe, eigentlich ganz harmlos. Beim Druck auf die Hausglocke geht mir wieder durch den Kopf, daß Tramin auch „Die Herren Söhne“ geschrieben hat, jenen Roman, der 1963 — wie Mary McCarthys „Clique“ in den USA — hier der Wiener Gesellschaft Gesprächsstoff lieferte und das Spekulationsspielchen „Wer ist wer?“ auslöste. Da ist von Baronen, feudalen Stadtwohnungen und Dienstmädchen die Rede... Aber Herr von Tramin öffnet selber: kein „Kronotron“-Techniker im weißen Labormantel, eher ein Peter Graf Chensky der „Herren Söhne“, und vor allem
ein ganz normaler Bankbeamter und moderner Schriftsteller — was er beides ist. Ein Mensch, mit dem man angeregt über Wetter und Urlaub konversiert, über Demokratie und Adel, über die gute Kinderstube und die Bauarbeiten an der Wiedner Hauptstraße und natürlich über Literatur.
Im Arbeitszimmer, beherrscht von der Bücherwand und einer Gouache des Grafen Hugo Schönborn mit dem Porträt des Bewohners, führt mich Peter von Tramin in seine literarischen Arbeiten ein:
Ein Divertimento hat vier Sätze. Die meines ersten zum Beispiel heißen: Explosion, Implosion, Station und Koalition; ich arbeite jetzt an einem neuen Stück mit dem Thema „Komplettismus“; der erste Satz ist bereits fertig.
Ich bin etwas verwirrt. Wie zur Erläuterung fügt er hinzu:
Den Österreichischen Staatspreis 1963 für Erzählungen bekam ich für meine „Pentade“. Das sind sechs Erzählungen: 1. Singularis („Taschen voller Geld“), 2. Intermezzo („Ildiko“), 3. Dualis („Vor Litfaßsäulen wird gewarnt“ und „Die Mar-tialisierung“), 4. Intermezzo („Ein Mädchen muß niesen“), 5. Pluralis („Erstes Divertimento“). Sie sind allerdings nie gesammelt, sondern verstreut in Anthologien und Zeitungen erschienen.
„Divertimento“ verrät keineswegs — wie ich anfangs vermutete — eine außergewöhnliche Musikalität des Schriftstellers, sondern seine literarische Verwandtschaft mit Heimito von Doderer. In unserem Gespräch fallen nun noch viele Termini technici, die der Meister der Romankomposition geprägt hat: Vorhalt, Auflösung, Stützpfeiler, Probetexte, Kompositionszeichnung, Leitwerk, Reifepunkt, Zuflüssigkeit. Tramin geht zur Bücherwand:
Bei Heimito von Doderer habe ich wirklich viel gelernt. Mein Verhältnis zu ihm ist durch diese zwei Zeugnisse gekennzeichnet: Mein Exemplar der „Dämonen“ ist mir noch als irgendeinem Baron Soundso „zur Erinnerung an seinen lieben Besuch“ und „allerherzlichst“ gewidmet. Das war mein erster Besuch bei Doderer am 10. September 1958. Seine „Tangenten“, die ich da stehen habe — 1964 erschienen —, sind bereits „Peter von Tramin“ zugeeignet.
Von der ersten Begegnung mit Doderer erzählt Peter von Tramin gerne und ausführlich: Wie er vor nun fast zehn Jahren beim Durchblättern des Telephonbuches zufällig auf den Namen Doderer stieß, wie er ohne viel Überlegung die Nummer wählte und unter aufgeregtem Stottern dem bekannten Dichter, der sich tatsächlich persönlich gemeldet hatte, seine Bewunderung für die „Dämonen“ ausdrückte, die er gerade las. Doderer zeigte sich nicht erstaunt, sondern lud den jungen Verehrer kurzerhand für den nächsten Tag zum Kaffee. Sie sprachen nur über Doderers Werk; erst bei der Verabschiedung fragte der alte Meister den jungen, noch unbekannten Schriftsteller, ob er auch schreibe, und lud ihn ein, Proben zu schicken. Tramin folgte dieser Aufforderung mit zwei Geschichten, auf die Doderer nicht reagierte, die nie gedruckt wurden und die Tramin heute schlicht als „schlecht“ bezeichnet.
Erst als Tramin das erste und zweite Kapitel eines Romans, den er gerade in Arbeit hatte, Doderer zeigte, kam das literarische Fachgespräch, fast möchte man sagen: Lehrgespräch, in Gang.
Doderer zeigte mir, wie ein Roman entsteht, wie man ihn zeichnet: Man apperzipiert dies und das, hat ein oder zwei Einfälle, formt sie unmittelbar und bringt sie zu Papier. Sie sind die Stützpfeiler, die, mit den ersten Probetexten umgeben, die gesamte Komposition tragen. Bei den „Herren Söhnen“ zum Beispiel sind es die Maturafeier als Generalvorhalt und das Doktorat als chronologische Marke. Diese Stützpfeiler müssen gesichert sein, das Leitwerk muß stehen, vorher zeichne ich nicht. Dann erst wird die Komposition in Plänen mit genauen Daten, mit Personenangaben und Notierung der Tage aufgezeichnet und ausgearbeitet. Diese Kom-
Positionen kann man anschauen, sie müssen auch Korrekturen vertragen, sie müssen dehnbar sein.
In der literarischen Gesellschaft und speziell in dem Kreis, der sich um Heimito von Doderer gebildet hatte, sind diese Termini technici geläufig; sie kennzeichnen eine Form der strengen Romankomposition, eine bestimmte Art der Notation, die ihre Anhänger und Verteidiger wie ihre Gegner und Kritiker hat.
*
Während Doderer seine Kompositionen direkt „ins reine“ schrieb, beginnt bei Tramin nach der Erstellung der Kompositionszeichnung erst der lange Prozeß des Gestaltens, des Formulierens, des Bemühens um Kongruenz von Inhalt und Ausdruck. Er zeigt mir erste Manuskriptseiten, von Hand geschrieben und bis zur Unleserlichkeit korrigiert, getippte Manuskripte mit handschriftlichen Einfügungen, schließlich
saubere Manuskriptseiten in der Endfassung. Und dazu seine „Helfer“: Schreibmaschine und Tonbandgerät.
Es ist eine Arbeit wie an einem Fleckerlteppich. Wenn Zuflüssigkeit da ist, schreibe ich an der ersten Fassung, und zwar mit der Hand, weil das mehr zum kontrollierten Schreiben zwingt; die Maschine würde zum Sprudeln verführen. Diese Prim wird korrigiert, einige Male überarbeitet; dann lese ich sie auf Tonband; das Band diktiert sie mir in die Schreibmaschine. Die Sekund habe ich also maschinenschriftlich. Auch diese wird überarbeitet, korrigiert, wieder aufs Band gesprochen und als Terz getippt. Vielleicht bin ich dann mit der Fassung zufrieden, sonst arbeite ich weiter, immer im Eigendiktat über das Tonbandgerät in die Schreibmaschine, was weitere Ad-hoc-Korrekturmöglichkeiten gibt.
Das wickelt sich natürlich nicht fein säuberlich, Kapitel für Kapitel nacheinander ab. Ohne Zuflüssigkeit warte ich nicht lange darauf, sondern arbeite an den Korrekturen der ersten oder zweiten Fassungen schon vorliegender Kapitel. Es ist tatsächlich Arbeit an einem Fleckerlteppich, was vor allem auch durch meine berufliche und familiäre Situation und überhaupt durch die Lebensumstände bedingt ist.
Als Bankkaufmann arbeitet Tramin 45 Stunden in der Woche, für die schriftstellerische Arbeit bleiben ihm Abend, Wochenende und Urlaub. Damit teilt er das Los fast aller österreichischen Autoren, die in unserer Gesellschaft als Bibliothekare, Lehrerinnen, Mittelschulprofessoren oder Hilfsarbeiter leben.
Für die Familie ist solch ein Leben im Doppelberuf nicht leicht. Frau von Tramin klagt nicht, beim gemeinsamen Tee erzählt sie von der schriftstellerischen Tätigkeit ihres Gatten, von seinen Verhandlungen mit Verlagen, seinem Kampf mit
deutschen Verlagslektoren um die Austriazismen in seinen Büchern, die er bis aufs Blut verteidigt. „Es ist halt so“, akzeptiert sie, „daßer in seiner freien Zeit sehr viel arbeitet, an den Wochenenden und im Urlaub, und oft auch am späten Abend noch im Kaffeehaus, damit er Ruhe und Konzentration hat, und anderseits unser Sohn, der jetzt in die erste Klasse im Rainer-Gymnasium geht, nicht durch die Nachtarbeit des Vaters gestört ist.“
Herr von Tramin selber findet seinen Doppelberuf nicht einmal so anstrengend:
Zwar bin ich ständig beschäftigt; aber meine Arbeit im Büro und meine Arbeit als Schriftsteller sind Kontrastbeschäftigungen: Ich beschäftige meine beiden Gehirnhälften alternativ. Das Maximum an schriftstellerischer „Arbeitsleistung“ pro Tag sind zehn Seiten. Ich habe etwa vier Jahre an den „Herren Söhnen“ gearbeitet, ebenso vier Jahre an „Die Tür im Fenster“. Wirkliche Arbeit, Kapitel für Kapitel, Korrekturen, Neufassungen. Denn mein Rezept ist ein Wort Edisons: „99 Prozent Transpiration, 1 Prozent Inspiration.“
*
Auch heute abend übersiedeln wir, als die Nachtstunde für den Sohn gekommen ist, ins Kaffeehaus hoch über dem Matzleinsdorferplatz. Im Aufzug, der nicht recht funktioniert und uns zuerst in den Keller anstatt zur Dachterrasse führt, erinnert sich Peter von Tramin, daß ihn gerade dieser Defekt zur Erzählung „Ildiko“ inspiriert hat.
Mit „Ildiko“ gab es dann lustige Komplikationen in Ungarn. Diese Erzählung wurde nämlich übersetzt und in „Nagyvilag“ 1967/4 veröffentlicht. Als ich dann die Zeitschrift zu Gesicht bekam, merkte ich am Druckbild, obwohl ich nicht Ungarisch kann, daß der Schluß offensichtlich nicht stimmte. Als ich mich bei der Redaktion darnach erkundigte, erhielt ich tatsächlich mit vielen Entschuldigungen die Erklärung, daß die letzte Manuskriptseite verlorengegangen wäre, die Geschichte also zu früh und ohne Pointe abbrach. Aber niemand hatte es bemerkt, man hielt es wohl für „typisch modern“.
Beim Kaffee erzählt mir Peter von Tramin, daß er mit 13 Jahren seine erste „literarische Arbeit“ veröffentlicht hat: ein Märchen in der „Kinderpost“, Jahrgang 1946, und daß er als Kind außerordentlich viel gelesen hat, „viel und alles“. Nach der Matura und einigen Semestern Jus hat er sein Studium abgebrochen, als es mit der Familiengründung, der Praxis in einer Bank und der schriftstellerischen Arbeit zusammen zeitlich nicht mehr zu bewältigen war.
Schließlich führt das Gespräch auch zu den Kritikern. Peter von Tramin ist nicht gut auf sie zu sprechen. Er gerät fast in Rage über die Bedenkenlosigkeit der „Bemmerl-kritiken“ (10-Zeilen-Besprechungen), die Klappentexte oberflächlich und oft falsch nachbeten, die unzulässige Identifikationen zwischen seinen Romangestalten und ihrem Schöpfer vornehmen. Und vehement lehnt er den Versuch ab, ein Werk nach der Biographie seines Verfassers aufzuschlüsseln.
Umgekehrt ist es richtiger: Vom Werk kann man auf den Schriftsteller schließen. Es gibt kein direktes Kausalverhältnis zwischen sozialer und künstlerischer Wirklichkeit.
Erst als wir auf das Thema „Kaffeehaus“ zu sprechen kommen, wird unser Gespräch ruhiger, wieder verbindlich und konziliant wie vorher. Herr von Tramin liebt die Kaffeehäuser.
Diese Atmosphäre gibt mir die Illusion, ein Zoon Politikon zu sein. Das Kaffeehaus ist unbedingt notwendig zum Schreiben. Ich ziehe ja oft abends spät noch ins-Kaffeehaus, allerdings ein anderes, viel kleineres als dieses. Wo ein Vertreter seine Tagesbilanzen macht, zwei Rentner philosophieren, ein Hochschüler seinen kleinen Schwarzen trinkt. Vielleicht hält man mich dort für einen Spinner, der immer etwas zu schreiben hat. Aber das ist richtig so, frei und ungestört und doch in Verbindung mit Menschen.
In dieser Atmosphäre rundet sich das Bild seiner Arbeitsphilosophie, das mir Peter von Tramin bei diesem Besuch vermittelt hat: Neben dem Bekenntnis des Schriftstellers Tramin zu Heimito von Doderer hörte ich ein Bekenntnis des Menschen Tramin zum — Warten:
Ich halte viel vom Warten. Im Augenblick, wo man sich um etwas bemüht, geht es sicher nicht. Im Gegenteil, man muß sitzen bleiben und seine Arbeit tun. Man muß warten, daß die richtigen Sachen richtig passieren. Wenn ich ein aktiver Mensch wäre, wäre ich kein Schriftsteller geworden.