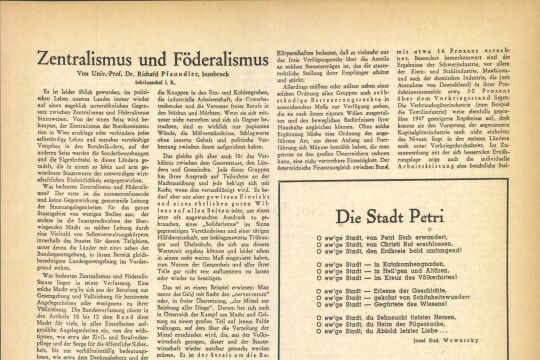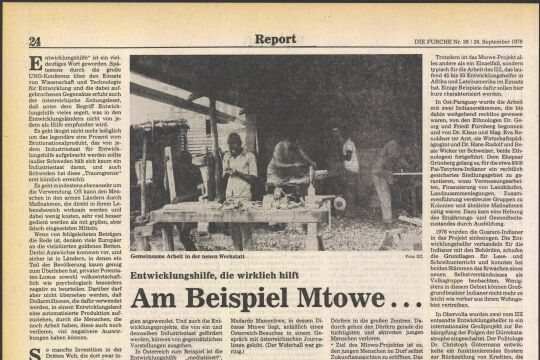Österreich soll demnächst ein Entwicklungshilfe-Gesetz bekommen. Dieses Gesetz ist im Gespräch. Nicht im Gespräch sind Österreichs Leistungen auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe in den letzten vier Jahren, denn seit 1970 ist Österreichs Entwicklungshilfe versiegt. So daß die Verabschiedung eines Entwick-lungshilfegesetzes zumindest als Entschuldigung dafür dienen wird, wenn auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe in den ersten vier Jahren einer SPÖ-Regierung wesentlich weniger geschehen ist als in den vorangegangenen Jahren einer ÖVP-Regieruhg. Dabei enthält aber dieses Gesetz keine Andeutungen einer Umorientierung, die eine „schöpferische Pause“ gerechtfertigt hätte. Es bleibt bei der Gießkanne.
Das Mißverhältnis zwischen dem, was notwendig wäre, und dem, was wirklich geschieht, ist natürlich eine internationale Tragödie, in der Österreich aber eine ganz besonders häßliche Rolle spielt. Die Vereinten Nationen leiteten im Jahre 1970 die „zweite Dekade“ der internationelen Entwicklungshilfe ein und formulierten damals die Zielvorstellung, gemäß derer jedes entwickelte Land (Industrieland) ein Prozent seines Bruttosozialproduktes in Form öffentlicher und privater Kapitalbereitstellung (also Privatinvestitionen eingeschlossen), 0,7 Prozent als öffentliche Entwicklungshilfe (staatliche Entwicklungshilfe) zur Verfügung stellen sollte.
Das erste Ziel wurde bislang eigentlich nur von Staaten erreicht, deren Wirtschaft stark mit den Wirtschaften ehemaliger Kolonialgebiete verflochten ist. Diese Wirtschaftsverflechtungen mit Exkolonien erklärt, daß etwa Belgien 1,16 Prozent, Frankreich 1,06 Prozent, Holland 1,42 Prozent und Großbritannien 1,11 Prozent des jeweiligen Bruttosozialproduktes für öffentliche und private Kapitalbereitstellung aufbringen, während es unter 16 dem Entwicklungshilfe-Komitee der OECD (DÄC) angehörenden Ländern bislang keinem einzigen gelungen ist, die geforderten 0,7 Prozent des Bruttosozialproduktes für die öffentliche Entwicklungshilfe bereitzustellen.
Dies ist deshalb besonders ungünstig, da der öffentlichen Entwicklungshilfe gegenüber Privatinvestitionen besondere Bedeutung zukommt, wie alle mit Entwicklungshilfe befaßten internationalen Körperschaften immer wieder betonen. Hinter dieser Formulierung verbirgt sich eine Anspielung auf den Ausbeutungscharakter eines großen Teiles der von Industrieländern in Entwicklungsländern getätigten privaten Investitionen.
Unter allen DAC-Ländern waren Österreich, Italien und die Schweiz bisher mit öffentlichen Entwicklungsgeldern am geizigsten. 1972 hat einzig Italien die österreichischen Anstrengungen unterboten: 0,08 Prozent des italienischen, 0,09 Prozent des österreichischen Bruttosozialproduktes flössen der Entwicklungshilfe staatlicher Stellen zu. Damit war es Österreich gelungen, sich in drei Jahren heroischer Anstrengung vom vorletzten auf den letzten Platz der internationalen Solidarität vorzu-kämpfen. Seit 1969 lagen Österreichs öffentliche Aufwendungen für Entwicklungshilfe in Relation zum Bruttosozialprodukt hinter denen sämtlicher anderen DAC-Länder, 1969 und 1970 ließen sich einzig die österreichischen Aufwendungen nicht mehr in Zehntel-, sondern nur noch in Hundertstel-Prozentsätzen ausdrücken.
Österreich redet sich dabei natürlich auf seine beschränkten budgetä-ren Möglichkeiten aus. Als die UNO-Generalversammlung im Herbst 1970 die Ziele der Entwicklungshilfe in den siebziger Jahren formulierte, mochte Österreich lediglich seinen guten Willen zu garantieren, darüber hinaus aber nichts konkretes. Österreich habe, so damals unser Außenminister, „das Prinzip betreffend das Ein-Prozent-Ziel für das Hilfsvolumen angenommen und ist durch Intensivierung seiner Bemühungen in letzter Zeit diesem Ziel wesentlich nähergekommen. Wenn Österreich auch zur Zeit nicht in der Lage ist, eine endgültige Verpflichtung hinsichtlich des Zeitpunktes zu übernehmen, wird es innerhalb der Grenzen seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten alle Anstrengungen unternehmen, um das Ein-Prozent-Ziel während der Dekade zu erreichen.“
Offenbar wußte Österreichs Außenminister damals bereits, daß die staatliche Entwicklungshilfe der Alpenrepublik vor dem Zusammenbruch stand, denn aus der Fortsetzung seiner Erklärung geht wohl ziemlich eindeutig hervor, daß sich vor allem die Privatwirtschaft anstrengen sollte: „Österreich anerkennt vollinhaltlich die besondere Rolle der öffentlichen Entwicklungshilfe. Während Österreich zur Zeit nicht in der Lage ist, das vorgeschlagene Ausmaß von 0,7 Prozent und den vorgeschlagenen Zeitpunkt anzunehmen, wird es innerhalb der Grenzen seiner wirtschaftlichen und budgetären Möglichkeiten bestrebt sein, einen wesentlichen Teil seiner Entwicklungshilfe in dieser Form beizustellen.“
Im folgenden Jahr war denn auch Österreich, in einer Phase der nahezu ausschließlich innenpolitisch motivierten Budgetpolitik, vom 0,7-Pro-zent-Ziel um genau eine Zehnerpotenz entfernt: Die Aufwendungen sanken auf 0,07 Prozent.
Wenn man auf das abgelaufene Jahrzehnt zurückblickt, so erscheinen die Jahre von 1965 bis 1968 als die goldenen Jahre österreichischter Solidarität mit den Entwicklungsländern — sehr golden waren freilich auch sie nicht. Immerhin erhöhte Österreich seine staatlichen Entwicklungsgelder von 0,11 Prozent des Bruttosozialproduktes im Jahre 1966 auf 0,12 und im folgenden Jahr auf 0,14 Prozent, ein Solidaritätsstandard, der freilich nur zwei Jahre lang durchgehalten werden konnte. Über ein Zwischenstadium von 0,11 Prozent im Jahre 1969 sackte der Aufwand für die Entwicklungshilfe in Relation zum Bruttosozialprodukt 1970 auf die Hälfte dessen von 1967 und 1968 ab.
Was wenig mit echten Grenzen wirtschaftlicher und budgetärer Leistungsfähigkeit, aber sehr viel mit politisch motivierten Prioritäten der Budgetpolitik zu tun hat. Entwicklungshilfe ist nicht eine Frage des Könnens, sondern eine des Wollens, wird nicht von den wirtschaftlichen Möglichkeiten, sondern von der Mentalität bestimmt.
Österreichs staatliche Entwicklungshilfe pflegt die Schwankungen auf den Märkten der internationalen Solidarität extrem mitzumachen, wenn es bergab geht, aber nur sehr zögernd, wenn es aufwärts geht. In den vergangenen Jahren ist der durchschnittliche Anteil der staatlichen Entwicklungshilfe an den nationalen Bruttosozialprodukten konstant zurückgegangen. Im Durchschnitt der DAC-Länder von 0,52 Prozent 1962, auf 0,42 Prozent 1967 und 0,34 Prozent 1972. Also um rund zwei Prozent pro Jahr. Aber in Österreich stagnieren, in einer Phase sich ausweitender Bruttosozialprodukte und inflationärer Entwicklungen, auch die Entwicklungshilfe-Nennbeträge.
Im Jahrzehnt von 1962 bis 1973 war Österreich nur ein einziges Mal — in Nennbeträgen — nicht der größte Geizhals der DAC, das war 1967 mit 15,2 Millionen Dollar, gegenüber 13 Millionen Dollar der Schweiz und 14,5 Millionen Dollar in Norwegen. 1968 erhöhte Österreich auf 16,4 Millionen, Norwegen auf 26,6 Millionen, die Schweiz auf 24,2 Millionen Dollar. In den folgenden Jahren gaben die anderen Länder immer mehr, Österreich immer weniger.
Dabei gleicht die Alpenrepublik einem Geizhals, der nichts verschenken will, aber seine Börse dann schon öffnet, wenn er sich einen Gewinn erhofft. Denn es entspringt bestimmt nicht altrustischen Motiven, wenn Österreich mit seinen Gesamt-Nettozuwendungen an Entwicklungsländer, welche die gewinnorientierten Kapitaltransfers der Privatwirtschaft enthalten, Staaten wie etwa Norwegen und Dänemark mehrmals übertroffen hat, für staatliche Entwicklungshilfe aber nur einen kleinen Bruchteil dessen übrig hat, was diese dafür aufwenden.
Nun bekommen wir also ein Gesetz über die Entwicklungshilfe. Und auf Grund dieses Gesetzes voraussichtlich schon im Herbst ein mittelfristiges Entwicklungshilfe-Konzept. Die seit 1970 gehandhabte, geradezu skandalöse Zugeknöpftheit dieses Staates wäre im nachhinein motiviert, brächte dieses Gesetz eine grundsätzliche Umorientierung der österreichischen Entwicklungshilfe, die in einigen Jahren Arbeit vorbereitet werden mußte, oder aber eine so kräftige Aufstockung, daß man reden könnte. Nichts von alledem.
Der Satz nach vorne findet nicht statt. Österreich stockt seine Budgetmittel für staatliche Entwicklungshilfe um rund 50 Prozent auf, laut Bundesvoranschlag von 409 Millionen Schilling 1973, auf 626 Millionen für 1974. Das entspricht weniger als der Hälfte dessen, was Länder wie Norwegen oder die Schweiz bereits zwei Jahre früher aufwendeten (Norwegen und die Schweiz rangieren vor Österreich am Tabellenende). Holland etwa gab bereits vor zwei Jahren das Zehnfache, Dänemark das Dreifache, Belgien das Sechsfache.
Natürlich darf man die Schillingmilliarde nicht verschweigen, die aus Devisenreserven der Nationalbank in zwei Jahresraten als einmaliges Darlehen für Zwecke der Entwicklungshilfe der Weltbank (zweimal 300 Millionen) sowie der Asiatischen und der Interamerikanischen Entwicklungsbank (jeweils zweimal 100 Millionen Schilling) zur Verfügung gestellt wird. Dank der 500-Millionen-Schilling-Rate von 1974 erreichen wir fast die Aufwendungen unserer Vordermänner am Tabellenende — freilich die mittlerweile gesteigerten Beträge, die sie bereits vor zwei Jahren aufgewendet haben.
Aber auch eine Umorientierung in den Methoden findet nicht statt. Österreich kann es sich nicht leisten, wenigstens das nicht vorhandene Geld durch etwas alpenländisches Gehirnschmalz zu ersetzen und als Know-how-Spender neue Modelle der Entwicklungshilfe zu erarbeiten. Denn wir können ja unsere Mittel leider nicht konzentrieren. Wo andere für ein Entwicklungsprojekt zehn oder hundert Millionen Dollar investieren, hauen wir, um vornehm dazustehen, eine halbe, wenn nicht gar eine ganze Million drauf. Zwar sind, dem Vernehmen nach, „geographische und fachliche Schwerpunktsetzungen“ in Vorbereitung, doch zumindest der geographischen voraussichtlich so viele, daß man schwerlich von Schwerpunkten sprechen kann, Die Liste der möglichen Länder ist lang, sie reicht von der Atommacht Indien bis zu den Erdölländern, auf deren Freundschaft wir Wert legen, und eine Konzentration auf wenigstens ein Land pro Kontinent gilt als „außenpolitisch kaum durchse'tzbar“.
Das -heißt: Es bleibt bei der Gießkanne. Zwar wird sie nicht viel hergeben, dafür werden aber um so anspruchsvollere Wünsche die großzügigen Gaben begleiten. Soll doch bei der Vergabe der Mittel auf die sozialpolitische Entwicklung der bedachten Länder geachtet und eine Steigerung des Lebensniveaus und eine bessere Verteilung der vorhandenen Güter sowie eine Vermehrung der Arbeitsplätze angestrebt werden.
Beim Setzen fachlicher Schwerpunkte tun wir uns leichter. Hierher gehört vor allem die technische Hilfe, worunter die Errichtung einer Musterfarm ebenso zu verstehen ist wie ein Zuchtrinder-Geschenk oder der Betrieb einer Schule mit österreichischen Lehrkräften. Entwicklungshilfe dieser Art wird seit vielen Jahren geleistet. Hier rangiert die österreichische Schule in Istanbul ebenso wie die gewerbliche österreichische Schule in Thailand, aber auch die von der Alpenrepublik traditionellerweise gewährten Stipendien für Studenten aus Entwicklungsländern gehen unter diesem Titel in das Entwicklungshilfe-Budget ein.
Beteiligte sehen nur eine Alternative zur Gießkanne: Sie sollte, wenn sich der Strahl schon nicht stärker konzentrieren läßt, wenigstens kräftiger fließen. Doch das wird sie nicht. Österreich müßte sich in einem bisher nirgends deutlich gewordenen Ausmaß anstrengen, um wenigstens mit jenen Tendenzen Schritt halten zu können, die selbst bei kräftig steigenden Entwicklungshilfe-Nennbeträgen deren Effekt immer weiter verringern. Was freilich eine internationale Erscheinung ist.
Denn seit 1972 hat der Realwert der Entwicklungshilfe, umgelegt pro Kopf der Entwicklungsländer, um ein Sechstel abgenommen, wie die DAC bereits in ihrem Bericht für 1972 registriert — was seit der Ölkrise passiert ist, wird noch von keiner Statistik erfaßt.
Österreich huldigt, wie könnte es anders sein, auch hier ganz besonders der von vielen Ländern hochgehaltenen Devise, daß wir, wenn wir schon Geld hergeben, es wenigstens auch wieder zurückbekommen wollen. Technische Hilfe, sprich österreichische Exportartikel, geben wir umsonst — Geld wird, soweit es sich nicht um Beiträge an internationale Körperschaften der Entwicklungshilfe handelt, nur in Form von Krediten gegeben.
Womit wir den gefährlichen Trend einer immer stärkeren Verschuldung der Entwicklungsländer fördern. Sie betrug bereits Ende 1971 laut Weltbank 60 Milliarden Dollar und die Belastung durch Schulden und Schuldenlasten steigt um durchschnittlich 14 Prozent pro Jahr, was dem Doppelten der Exportsteigerungen entspricht. In derselben Zeit müssen sie ihre Exporte steigern, um wenigstens — real — dieselben Exporterlöse zu erwirtschaften. Durch das nach wie vor zunehmende Auseinanderklaffen der Rohstoff- und Industriewarenpreise verringerten sich die Ausfuhrerlöse der Entwicklungsländer innerhalb von acht Jahren bis 1970 um einen Betrag, der genau einem Drittel der gesamten öffentlichen Entwicklungshilfe entsprach.
Das heißt, daß die Rohstoffländer gegenüber den Industrieländern immer ärmer werden — und immer mehr zu Schuldnern. Österreich sollte sich ernsthaft überlegen, ob es — wenn es nicht mehr geben kann — nicht wenigstens dazu übergehen sollte, das Wenige, was es in Form öffentlicher Entwicklungshilfe in Geldform zur Verfügung stellt, überhaupt herschenken sollte. Das wäre doch immerhin ein Modell.