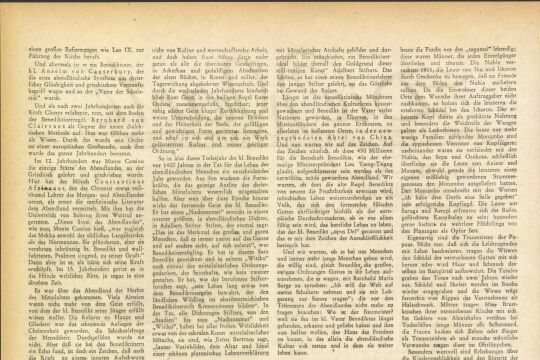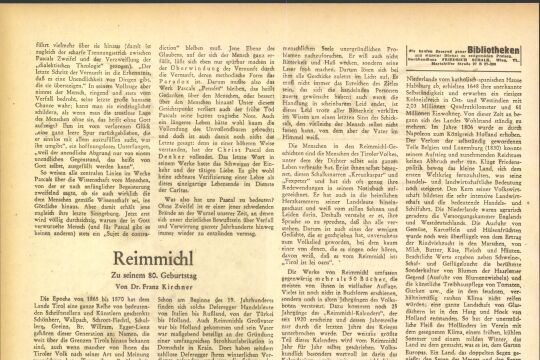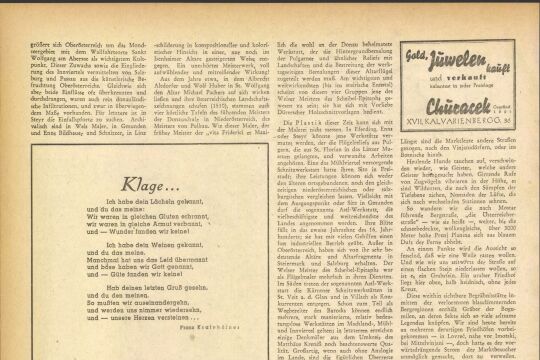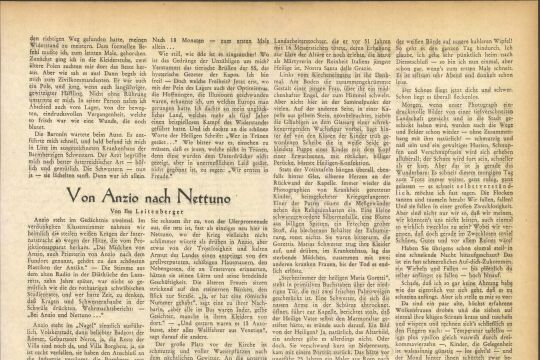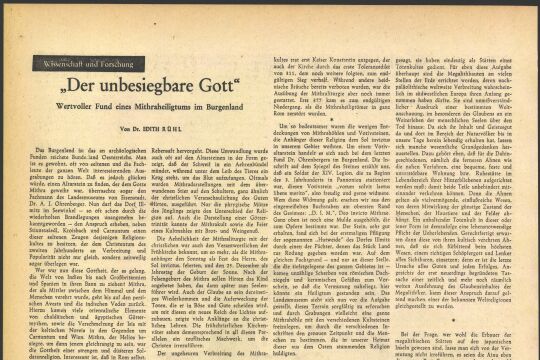Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wo der Tod belächelt wird
Tod, wo ist dein Stachel, möchte man fragen, wenn man erlebt, wie heiter es bei Totenfeiern in manchen Teilen der malaiischen Inselwelt zugeht. Auf Bali, diesem Wunderland der Tropen, gestalten sich die Leichenverbrennungen zu einem pomphaften Freudenfest.
Die Leiche wird auf hohen, mit buntem Zierat geschmückten Bambusgerüsten durch das Dorf getragen. Weißgekleidete Frauen und Mädchen haben Bastkörbe mit Blumen, Reiskuchen und Früchten beladen. Die Opfergaben sollen den Toten bei der Einäscherung begleiten. Angeführt von einem Game-lanorchester ziehen die Menschen fröhlich plappernd durch die Reisfelder zum Fluß, der nach der Verbrennung die Asche des Verstorbenen aufnehmen soll.
Die Balinesen glauben, daß durch die Kremation die Seele vom Körper befreit wird und zu den Göttern aufsteigen kann - und das ist auf Bali ein freudiges Ereignis.
Die Armen des Dorfes warten oftmals mit der Verbrennung ihrer Familienangehörigen, bis ein Vornehmer stirbt. Dann wird das Totenfest in wochenlanger Arbeit vorbereitet. Die Pfosten der Häuser und Hütten werden mit bunten Stoffen umwickelt. Am Tage der Einäscherung kommen Dorfbewohner von nah und fern.
Nach 42 Tagen findet das Fest der zweiten Purifikation statt. Wieden wer-
den Opferspeisen hergerichtet und dem Fluß oder dem Meer übergeben. Manche Familie gerät durch diese kostspieligen Totenfeste in Schulden. Aber den Balinesen kommt es auf ein gutes Einvernehmen mit den Göttern an, und dagegen verblaßt jedes rationale Denken.
Die Menschen auf Bali werden im Durchschnitt nur 35 Jahre alt. Das Bewußtsein um die schnelle Vergänglichkeit alles Irdischen läßt sie ihr Leben genießen. Die Balinesen sind ihren hin-duistischen Göttern ergeben, das Aufbegehren gegen das Schicksal ist ihnen fremd. In den unzähligen balinesischen Bräuchen lebt der aus Indien überkom-
mene Hinduismus. Der Grundzug des hinduistischen Volksglaubens auf Bali ist jedoch im Gegensatz zu Indien nicht tragisch, sondern heiter.
Als die große Nachbarinsel Java im 15. Jahrhundert vom Islam erobert wurde, zogen sich die Priester und Künstler nach Bali zurück. Später verboten die holländischen Kolonialherren Indonesiens jede christliche Missionstätigkeit auf Bali. Dadurch blieben Glaube und Künstlertum des Hinduismus bis heute fast rein erhalten. Manchem Besucher Balis erscheint die Insel noch als eine heile Welt.
Auf der nördlich gelegenen, orchi-deenförmigen Insel Sulawesi, dem früheren Celebes, sind die „hängenden Gräber" der Toradja eine touristische Attraktion, hier ist der Besucher ziemlich perplex, wenn er in den Felswänden hinter seinem Hotel eine Galerie aufrecht stehender Leichen sieht.
In Wirklichkeit sind es puppenhafte Nachbildungen Verstorbener, die hier und anderswo im Toradjaland aufgestellt sind. Die sterblichen Uberreste befinden sich in übereinandergeschich-teten, vielfach undicht gewordenen Holzsärgen. Knochen schauen daraus hervor, in manchen Galerien sieht man Totenschädel aufgereiht.
Unter den Inselbewohnern vom Stamme der Toradja hat sich animisti-sches Brauchtum erhalten. Die christliche Missionierung liegt noch nicht allzu weit zurück. Ursprünglich gingen die Toradja auf Kopfjagd, um in Zeiten von Mißernten und Seuchen eine „segenbringende" Trophäe heimzubringen, die das Übel wenden sollte. Der Kopf eines Erschlagenen war auch eine wichtige Grabbeilage für einen verstorbenen Häuptling.
Das Gesellschaftssystem der Toradja war streng hierarchisch gegliedert, es kannte fürstliche Privilegien und Sklavenwirtschaft. Dem Tod eines Adeligen folgte ein tagelanges Bestattungszeremoniell. Noch heute herrscht im Toradjaland ein eigenartiger Totenkult, finden sich Trauergäste aus nah und fern zu ausgedehnten Zeremonien ein. Nun werden freilich nur noch Büffel, Schweine und Küken geopfert.
Von der ethnischen Vielfalt Indonesiens geben die Friedhöfe der Inselhauptstadt Ujung Padang, in der Kolonialzeit Makasser genannt, ein eindrucksvolles Bild. Auf dem Europäer-Friedhof der Stadt grasen jetzt Kühe; ebenso verwahrlost ist der Chinesen-Friedhof mit seinen hufeisenförmigen, aufwendigen Gräbern; daneben gibt es einen Moslem-Friedhof und auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Friedhof für indonesische Christen, schließlich noch einen Soldatenfriedhof aus dem Zweiten Weltkrieg.
Viele Gesichter hat auch Madagaskar, die große Insel im Indischen Ozean. Während sich die Gelehrten immer noch darüber streiten, woher die Madagassen stammen, deutet vieles darauf hin, daß die Vorfahren der Me-rina in Auslegerbooten aus Insulinde kamen. Ein Viertel der neun Millionen Madagassen sind Merina. Im 19. Jahrhundert hatten Merina-Könige die 18 Inselstämme vereinigt und den ma-
laiisch klingenden Merina-Dialekt zur Staatssprache Madagaskars erhoben.
Die braunhäutigen, mandeläUgigen Merina, die vor allem das Hochland der Insel bevölkern, lassen sich ungern als Afrikaner bezeichnen. An der Küste siedelten vornehmlich negroide Stämme. Etwa ein Drittel der Bevölkerung Madagaskars bekennt sich zum christlichen Glauben, eine kleinere Minderheit folgt den Geboten des Islam, die Mehrheit hängt Naturreligionen an.
Des Sonntags ziehen adrett gekleidete Kirchgänger durch die steilen Kopfsteinstraßen der Hauptstadt Antananarivo. Der Chorgesang in den katholischen und protestantischen Kirchen zieht sich manchmal über Stunden hin. Auf dem Lande aber huldigt die Bevölkerung vielfach noch animisti-schen Bräuchen, da umtanzen barfüßige Frauen und Männer blutende Tieropfer, und in manchen Gegenden wird immer noch ein bizarrer Exhumie-rungskult geübt.
Vieles ist asiatisches Erbe, wie das ausgeprägte Familiendenken und die Ahnenverehrung, nicht zuletzt das „Fady", ein weites Register von Tabus. Die Einstellung vieler Madagassen zum Leben und zum Tode kommt im „Fa-madihana", einem alten Merina-Brauch, zum Ausdruck. Der Tod wird nur als eine Stufe zu neuem Leben angesehen. Die Verstorbenen bleiben Mitglieder der menschlichen Gesellschaft, ihre Seelen wohnen in den Häusern der Lebenden.
Die Ehre, die man einem Toten erweisen will, bemißt sich an der Zahl der Leichentücher, in die er gehüllt wird. Die Trauergemeinde umfaßt selten weniger als hundert Personen. Alle vier bis fünf Jahre, je nach dem Ratschluß des Familienastrologen, müssen die Leichentücher erneuert werden.
Diese Prozedur, das eigentliche Fa-madihana, respektive „Umwenden der Leichen", ist eine fröhliche Angelegenheit. Berufstänzer und Musikanten werden aufgeboten, Umzüge wechseln mit Festmahlzeiten. Den mumienartigen Bündeln werden neue Mitglieder der Familie vorgestellt, man erzählt die neuesten Witze, spielt die letzten Schlager und berichtet über alle wichtigen Vorkommnisse der vergangenen Jahre.
Solcherart sollen die Seelen günstig gestimmt werden. Im übrigen heiligt man den Grundsatz: alles, was das Leben bietet, ist Grund zur Freude. Je mehr Kinder, desto größer das persönliche Glück. Im Schöße der Großfamilie fühlt sich der Einzelne geborgen. Sein Ziel ist, das Leben in Frieden zu genießen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!