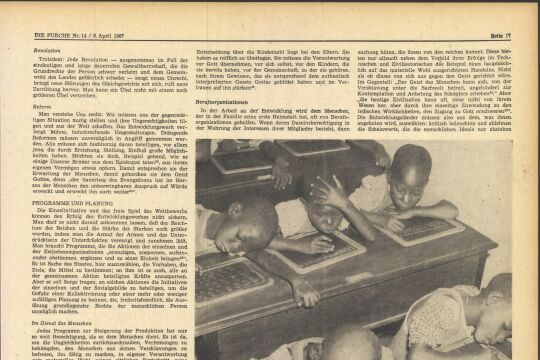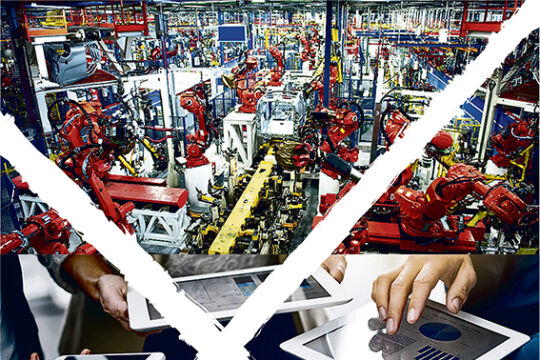Immer mehr Menschen begreifen, dass das bedingunglose Konkurrenzdenken zerstörerisch ist. Eine „antagonistische Kooperation“ in Politik und Gesellschaft ist zum Wohl aller von Nöten.
Die Krise, die wir gegenwärtig durchleben und die nicht nur die Wirtschaft, sondern unsere gesamte Lebensweise vor allem im Norden unseres Planeten in Zweifel zieht und unsere Demokratien bedroht, kann unseren Sinn für ein „gutes Leben“ angesichts der Endlichkeit stärken. Allerdings nur, wenn wir bereit sind, die Augen für die Gefahren und die Chancen zu öffnen und uns eine neue Kultur der Gemeinsamkeit zu erarbeiten, ja zu erstreiten. Das ist anspruchsvoll, aber möglich. Denn Zukunft haben wir nur gemeinsam.
Wenn ich von einer neuen Kultur der Gemeinsamkeit spreche, dann meine ich nicht eine vom Himmel fallende moralische Konversion und auch keinen paradiesischen Zustand, in dem wir einander nur um den Hals fallen. Eine solche Idee würde sich erneut an unserer Endlichkeit versehen und auch daran, dass unser Verhalten und unsere Einstellungen nicht losgelöst von unseren wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Lebensverhältnissen entstehen können.
Ich meine damit die Erarbeitung eines Grundkonsenses, der nicht einfach besteht, sondern von allen Menschen als Bürgern durch die bestehenden Konflikte hindurch gewonnen werden muss. Eine neue Kultur der Gemeinsamkeit achtet den Konflikt, befähigt auch dazu, ihn ehrlich auszutragen, aber sie stärkt die unaufhörliche Besinnung auf unsere gegenseitige Abhängigkeit und auf das gemeinsame Ziel, in Freiheit und Gerechtigkeit zu überleben und immer wieder, ohne Arroganz der Macht, Kompromisse zu suchen. Das heißt, sie pflegt auf allen Gebieten des gesellschaftlichen und politischen Lebens eine „antagonistische Kooperation“.
Der Begriff klingt wie ein Widerspruch. Aber genau auf diese Kunst kommt es an: die Spannungen auszuhalten, die in Unterschieden liegen, und trotzdem das Gemeinsame zu wollen. Auch im Fremden, zunächst Unverständlichen das Gemeinsame suchen, das Fremde nicht aus der eigenen, der vertrauten Perspektive heraus einfach richten.
„Neu“ nenne ich sie, weil wir noch nie so darauf angewiesen waren wie heute, gemeinsam zu handeln, um „gut“ zu leben.
„Neue“ Chancen hat diese Kultur, weil mehr und mehr Menschen begreifen, wie uns das besinnungslose Konkurrenzdenken, die unbedachte Übertragung des ökonomisch sinnvollen Wettbewerbs auf alle anderen Lebensbereiche, gegeneinender aufbringen und einander wie im Staatsentwurf des Thomas Hobbes zu Wölfen machen. Wie sie nicht nur unsere Lernfähigkeiten unterminieren, sondern überhaupt alle unsere Ressourcen in einem verschwenderischen Konsumrausch zerstören.
Anderer Umgang mit Energie, Natur, Klima
Notwendig wird die Gemeinsamkeit auch immer mehr, weil wir die wachsende Komplexität der Informationen und Zusammenhänge, in denen wir leben, nicht mehr in Konkurrenz zueinander, sondern nur noch miteinander bewältigen können. Viele im Finanzsektor haben z. B. eingestanden, dass sie die Produkte, mit denen sie handelten, nicht mehr durchschauten. Das macht ihr Handeln nicht verantwortlicher, aber es zeigt, wie die Kultur der Konkurrenz nicht zuletzt wegen der wachsenden Komplexität unserer Informationen systematisch in die Verantwortungslosigkeit geführt hat. Die können wir uns nicht mehr leisten.
Unsere Welt ist auch moralisch endlich. Aber es gibt immer mehr Menschen, die gelernt haben und anders handeln wollen. Unpathetisch, manchmal fast spielerisch, verbunden mit dem Versuch, das Leben auch zu genießen. Sie engagieren sich häufig nicht in den traditionellen politischen und gesellschaftlichen Organisationen, sondern in gemeinnützigen Nichtregierungsorganisationen, die der Globalisierung gerecht werden, indem sie transnational handeln.
Die neue Kultur der Gemeinsamkeit steht technischem Fortschritt nicht feindlich gegenüber. Sie erkennt nüchtern dessen prinzipielle Grenzen, aber sie nutzt und entwickelt seine Chancen. Er soll helfen, die Ressourcen zu schonen und trotz ihrer Endlichkeit ein „gutes“ Leben auch für jene vor allem im Süden unseres Erdballs zu ermöglichen, die bisher wenig Gewinn daraus ziehen konnten. Die neue Kultur der Gemeinsamkeit verzichtet aus diesem Grund auch nicht auf Wachstum, aber sie strebt nach neuen Indikatoren dafür und nach Strukturen und Akteuren einer dazu dienlichen Governance, um es qualitativ neu und angemessen zu bestimmen und umzusetzen.
In dem dringlich gebotenen ganz anderen Umgang mit Natur, Energie und Klima, der der Endlichkeit gerecht wird, schlägt das Herz der neuen Kultur der Gemeinsamkeit. Hier brauchen wir unabdingbar einen Paradigmenwechsel. Sie rückt in unseren Entscheidungen und Handlungen vor allem den Faktor „Zeit“ ins Zentrum – d. h. die Gemeinsamkeit mit den Generationen der Zukunft wie der Vergangenheit. Sie bedenkt die Endlichkeit unserer Mittel, die Gefahr kurzfristiger Erfolgsorientierung und die verantwortliche Verbundenheit mit den lebenden wie den zukünftigen Generationen. Sie hat bei allem die „Nebenwirkungen und Risiken“, aber auch die Chancen im Blick, für die Menschen auf allen fünf Kontinenten, für die organischen Kreisläufe der Natur, für die durch neue Produktionstechniken eröffnete Möglichkeit eines Recycling von Produkten, um Rohstoffe zu sparen, für die physische und psychische Erholung der arbeitenden Menschen, deren Kraft ebenso endlich ist wie die Rohstoffe der Natur. Aber auch für die Stärkung von Freiheit und rechtsstaatlicher Demokratie, auf die wir für eine effiziente Wirtschaft, vor allem aber für ein „gutes“ Leben angewiesen sind wie auf die saubere Luft zum Atmen. Gemeinsamkeit bestimmt hier auch die Richtung unserer Analyse.
Kreative Ressourcen mobilisieren
Die Vielfalt der Gesichtspunkte, die bei allen unseren Entscheidungen und Handlungen in Zukunft zu bedenken ist, können wir eben nicht allein, jeder für sich, berücksichtigen. Auch das ist die Kultur der Gemeinsamkeit: Wir müssen aus dem versparteten, sektor- und branchenbezogenen Denken ausbrechen und alle kreativen Ressourcen für das Projekt einer besseren Zukunft mobilisieren. Hierfür brauchen wir die Kooperation von Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft einschließlich der sehr wichtigen Gewerkschaften, auch von Wissenschaft und Kultur.
Die Entfesselung der Konkurrenz war die dominante Entwicklung seit dem Beginn der neunziger Jahre, aber sie hat nicht alles beherrscht. Denn gleichzeitig ist seit dem ersten Bericht des Club of Rome 1972 über die „Grenzen des Wachstums“ ein Bewusstsein für die globalen Gefahren und die Notwendigkeit entstanden, sie gemeinsam zu bewältigen.
Zunächst war dieses Bewusstsein rein bewahrender Natur. Es verband sich mit Appellen zum Maßhalten und zum Verzicht – und geriet damit in Widersprüche zur Dynamik der kapitalistischen Wirtschaft. Heute sind wir einen Schritt weiter. Denn wir wissen, dass sich die Steigerung von Wertschöpfung und Wohlstand mit der Bewahrung der Schöpfung verbinden lässt. Deshalb geht es schon seit Längerem nicht mehr um die einfache Frage: Wachstum – ja oder nein? Sondern darum, gemeinsam ein bekömmliches Wachstum zu gestalten.
Marktwirtschaft nicht per se schlecht
Dafür müssen wir auch nicht das gesamte System revolutionieren. Die Marktwirtschaft ist nicht per se blind für die Belange der Natur und die Bedürfnisse der Menschen nach einem intakten Umfeld. Es wäre relativ einfach, die sogenannten externen Kosten der Herstellung von Gütern, also den Verbrauch an kostenlos zur Verfügung gestellten natürlichen Ressourcen und die Belastung der Umwelt z. B. durch Emissionen, in die betriebswirtschaftliche Rechnung einzubeziehen. Hier gibt es handfeste Möglichkeiten für einen Neubeginn, wir müssen es nur wollen und mutig angehen.
Die neue Kultur der Gemeinsamkeit verspricht keine perfekte Utopie, aber sie schenkt uns die Chance, uns mit der Endlichkeit so zu versöhnen oder wenigstens zu verständigen, dass ihr unausweichlicher und heilsamer Stachel bleibt, ohne die Möglichkeit eines „guten“ gelingenden Lebens zu vernichten. Können wir uns mehr wünschen?
* Leben angesichts der Endlichkeit.
Auszüge aus der Rede anlässlich des Festakts der Salzburger Hochschulwoche 2010 zum Generalthema „Endlich! Leben und Überleben“ (Salzburg, 8.8. 2010)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!