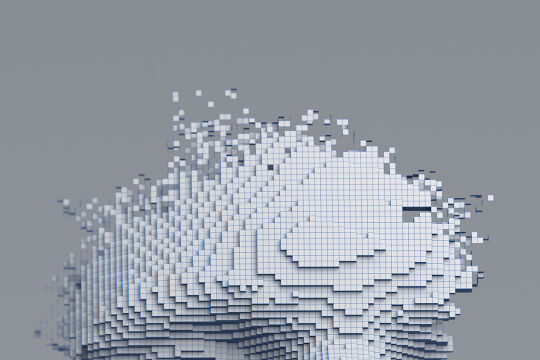Konrad Paul Liessmann: „Vor Asketismus fürchte ich mich“
Der Philosoph Konrad Paul Liessmann über sein neues Nietzsche-Buch „Alle Lust will Ewigkeit“, die Lust an Konzentration, die Unlust an gesellschaftlicher Transformation, Allergien gegenüber Verboten und die ewige Spannung zwischen Lust und Schmerz.
Der Philosoph Konrad Paul Liessmann über sein neues Nietzsche-Buch „Alle Lust will Ewigkeit“, die Lust an Konzentration, die Unlust an gesellschaftlicher Transformation, Allergien gegenüber Verboten und die ewige Spannung zwischen Lust und Schmerz.
Während in der Pandemie die große Lustlosigkeit um sich griff, hat sich Konrad Paul Liessmann einen Traum erfüllt und sich in einem Buch dem „Mitternachtslied“ von Friedrich Nietzsche genähert. „Alle Lust will Ewigkeit“ heißt das vor Kurzem erschienene Opus, das die zentralen Fragen des menschlichen Lebens berührt. Welche Rolle hierin die Lust spielt und wo aus philosophischer Perspektive ihre Ambivalenzen liegen, erklärt Liessmann im FURCHE-(Podcast-)Gespräch.
DIE FURCHE: Herr Professor Liessmann, wie kommt es, dass ein Philosoph in einem Buch ein einziges Gedicht umkreist und dabei Lust und Ewigkeit in den Fokus nimmt?
Konrad Paul Liessmann: Es ist eine ältere Lieblingsidee von mir, mich einmal diesem Gedicht „O Mensch, Gieb Acht!“ [sic!] aus „Also sprach Zarathustra“ genauer zu widmen. Das Gedicht kannte ich ja schon lange, bevor ich den „Zarathustra“ genau gelesen hatte, nämlich durch die Vertonung von Gustav Mahler im vierten Satz seiner dritten Sinfonie. Es gibt seit dem 19. Jahrhundert bis heute unzählige weitere Vertonungen, vom klassischen Klavierlied bis zu Techno- und Popversionen. Und ich fragte mich, was es mit diesem Gedicht auf sich hat, das ja gar keinen richtigen Titel trägt: Viele nennen es „Mitternachtslied“, Nietzsche nannte es in einem Notat auch das „Trunkene Lied“. In meiner letzten offiziellen Vorlesung an der Universität im Sommersemester 2018 habe ich dann jede Vorlesungseinheit einer Verszeile gewidmet. Meine Frage war: Lässt sich eineinhalb Stunden lang laut über den Vers „O Mensch! Gieb Acht!“ oder „Was spricht die tiefe Mitternacht?“ nachdenken? Aus der Aufzeichnung dieser Vorlesung sind dann die Grundstrukturen dieses Buches entstanden, das ich mit großer Lust genau in den Phasen des ersten und zweiten Lockdowns im Jahr 2020 geschrieben habe.
DIE FURCHE: Also in einer Zeit, die für viele den Gipfel der Lustlosigkeit bedeutet hat.
Liessmann: Für mich war das eine sehr lustvolle Zeit. Auch deshalb, weil ich relativ unbeeindruckt von Ablenkungen war, ohne Vortragseinladungen, Symposien, Konferenzen, Festspiele, Kulturveranstaltungen, Vernissagen oder Finissagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es zumindest eine Zeitlang sehr schön ist, wenn es all das nicht gibt; und dass das vielleicht überhaupt erst zur Entdeckung ganz anderer Lüste führt – etwa jener uns schon ganz abhanden gekommenen Lust, sich wirklich auf eine Sache konzentrieren zu können.

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
DIE FURCHE: Dieser Lust konnten viele aber schon deshalb nicht frönen, weil sie nicht allein in Ruhe nachdenken konnten, sondern sich womöglich in beengten Wohnverhältnissen multiplen Herausforderungen gegenübersahen – vom Home-Office über das Home-Schooling bis zu existenziellen Sorgen. Ist die Lust der Konzentration ein Luxus, den man sich leisten können muss?
Liessmann: Natürlich war und bin ich in einer privilegierten Situation. Dennoch habe ich mit vielen Menschen gesprochen, die unter dem Siegel der Verschwiegenheit bekundet haben, diesen Lockdown auch eine Zeitlang durchaus genossen zu haben – eben weil dieser Stress und dieses Gefühl weg ist, ständig zu etwas verpflichtet zu sein und kein Event versäumen zu dürfen.
DIE FURCHE: Und dort, wo die Lebensumstände dramatischer waren?
Liessmann: Auch dort haben wir interessante Erfahrungen machen können: Etwa, was es bedeutet, wenn Kinder nicht in die Schule gehen können. Das bedeutet ja nicht, dass sie nichts lernen, sondern nur – und das ist das Verlogene an der Schuldebatte –, dass sie zu Hause sein müssen. Und in unserer modernen Lebenswelt gehört es offenbar mit zum Schlimmsten, was Menschen passieren kann, dass ihre Kinder da sind. Die Hauptaufgabe der Schule, hat uns die Pandemie gelehrt, ist die Befreiung der Eltern von ihren Kindern. Bestimmte Formen sozialer Nähe halten wir gar nicht mehr aus. Hier hat sich ein Paradoxon gezeigt: Auf der einen Seite wurde ständig beklagt, dass man Abstand halten muss – und auf der anderen Seite waren einem die Kinder zu Hause viel zu nah. Das Gebot der Distanzierung ist im familiären Zusammenhang in einen Fluch umgeschlagen.
Für mich war der Lockdown eine lustvolle Zeit. Er hat zur Lust geführt, sich auf eine Sache konzentrieren zu können.
DIE FURCHE: Das war zweifellos häufig der Fall. Zugleich hat aber in vielen Familien auch die Möglichkeit zur von Ihnen so gerühmten Konzentration gefehlt – schlicht deshalb, weil mehrerlei nebenbei erledigt werden musste. Berufstätige Eltern waren eben keine Lehrer, die sich auf ihre Aufgabe konzentrieren konnten.
Liessmann: Auf der einen Seite stimmt das natürlich – aber man könnte daraus auch den Schluss ziehen, Wohnverhältnisse preislich so zu gestalten, dass Menschen eben nicht gezwungen sind, in beengten Verhältnissen zu leben. Wir schließen aber immer sofort daraus, dass alles außer Haus passieren muss. Und auf der anderen Seite war das Lernen in der Schule ja auch vor der Pandemie nicht ablenkungsfrei. Ganz im Gegenteil: Sehr viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, dass der distanzierte Unterricht zum Teil viel effizienter war, weil alle Störungen gefehlt haben. Doch diese Nachteile haben offensichtlich niemanden gestört, solange sie in der Schule stattgefunden haben. Man hat daraus sogar eine didaktische Maxime gemacht und gesagt: Die Aufmerksamkeitsspanne von jungen Menschen pendelt eben zwischen drei und sieben Minuten, und danach muss die Lehrperson die Methode wechseln. Zu Hause gelten aber diese didaktischen Innovationen offenbar nicht. Da kommt dann die große Klage, dass sich das Kind nicht konzentrieren kann. Ich habe schon den Eindruck, dass viel von der jeweiligen bildungspolitischen, ideologischen Position geprägt war und nicht von einem nüchternen Blick auf die tatsächlichen Verhältnisse.
DIE FURCHE: Kommen wir zurück zur Frage, was diese Pandemie grundsätzlich mit unserem Lebensgefühl und in besonderer Weise mit der Lust gemacht hat. Matthias Horx hat ja anfangs eine bescheidenere Welt prophezeit. Nun, nachdem viele das Gefühl hatten, sich in einem Albtraum oder „falschen Film“ zu befinden, scheint die Lust auf den Exzess ungebrochen. Das US-Wirtschaftsmagazin „Bloomberg Businessweek“ prophezeit gar eine Wiederkehr der „Roaring Twenties“.
Liessmann: Diese vollmundigen Prognosen eines Herrn Horx und anderer sogenannter Zukunfts- oder Trendforscher habe ich immer für blanken Unsinn gehalten. Jeder, der sich ein bisschen mit pandemischem Geschehen in der Historie beschäftigt hat, weiß, wie schnell so etwas vergessen wird. Schon seit den ersten Monaten der Pandemie reden wir ja von nichts anderem als davon, wie wir zu den früheren Verhältnissen zurückkehren können. Und diese große Befreiung erleben wir nun offensichtlich – ob das epidemiologisch klug ist, bleibt dahingestellt.
Und zu Ihrer Formulierung, sich „wie im falschen Film“ zu fühlen: Man kann angesichts dieses pandemischen Jahres schon fragen: Was war der falsche Film? Man könnte ja auch sagen, dass wir uns die letzten Jahrzehnte eingelullt hatten in die Illusion eines permanenten Fortschritts, dass wir Sicherheit und Gesundheit für alle garantieren können. Und plötzlich kommt diese Pandemie! Eine der größten Schockerfahrungen war, dass man sehen musste, wie hochqualifizierte Wissenschafter und Virologen einfach nichts zu sagen wussten. Helfen Masken oder helfen sie nicht? Wie überträgt sich das Virus überhaupt? Das wird uns sicher noch beschäftigen. Aber ich bin mir sicher, dass sogar dieser Schock schnell vergessen sein wird – und nach zwei Jahren werden wir so tun, als hätte es dieses Virus nie gegeben. Wir werden uns genauso wenig auf eine nächste Pandemie oder andere mögliche Katastrophen vorbereiten wie vor 2020.
Wenn sich Studentinnen in Berlin weigern, Immanuel Kant zu lesen, weil er irgendwo einmal etwas Rassistisches bemerkt haben soll, gibt es keine Lust am Denken mehr.
DIE FURCHE: Das führt mich zur Frage, wie man Menschen Lust machen kann auf eine – notwendige – Transformation ...
Liessmann: Notwendig ist gar nichts in der Geschichte. Wir können unsere Lebensstile ändern, weil wir andere Prioritäten setzen. Wir müssen es aber nicht tun. Das ist der Unterschied zwischen Maßnahmen, die wir setzen können, um die Klimaveränderungen in den Griff zu bekommen, und dieser Pandemie. Andererseits sollten wir uns klarmachen, dass es eben einen Zusammenhang gibt zwischen Lust- und Schmerzerfahrungen – das ist ein zentrales Thema meines Buches. Es war falsch, Lust zu versprechen und nicht dazuzusagen, was der Preis dafür ist, ökonomisch und ökologisch. Ich halte nichts davon, diesen Zusammenhang zu beschönigen. Ich halte aber auch nichts davon zu predigen, wie schön Verzicht sein kann. Wenn jemandem etwas wichtig ist, ist Verzicht nicht schön. Er ist nur dann schön, wenn etwas nicht mehr wichtig ist, aber dann ist es kein Verzicht mehr.
DIE FURCHE: Wie sollte also die Politik agieren, um Lust an einem nachhaltigeren Lebensstil zu schaffen?
Liessmann: Es ginge darum, Zusammenhänge einsichtig zu machen. Es ist aber ein Unterschied, einen Diskurs zu führen über Mobilitätsfragen oder mit dem Verbot von Binnenflügen zu drohen. Ich bin dagegen allergisch, wenn einem ständig etwas verboten wird: Es wird einem verboten, sich so oder so zu bewegen, so oder so zu sprechen oder zu denken. Wenn man den Eindruck hat, überall steht ein Verbotsschild, dann fühlt man sich beengt. Und wir haben gerade in der Pandemie die Erfahrung gemacht, wie schlimm es ist, sich beengt zu fühlen.
Konrad Paul Liessmann im FURCHE-Podcast
DIE FURCHE: An den von Ihnen angesprochenen „Sprech- und Denkverboten“ reiben Sie sich durchaus lustvoll. Auch in Ihrem Buch graut Ihnen vor überzogener „Achtsamkeit“. „Man geht achtsam einher“: Diesen Satz Nietzsches sehen Sie nicht als Auftrag, sondern als Warnung. Warum?
Liessmann: Ich war immer der Auffassung, dass wir uns die ganze Diskussion über Political Correctness sparen könnten, wenn wir uns an die Höflichkeitsregeln des 19. Jahrhunderts halten würden. Denn natürlich gehört es zum Ausdruck eines aufgeklärten Menschen, dass man sich mit Achtung und Respekt begegnet. Was mich aber stört und irritiert, ist, dass man derzeit einen Sprachessenzialismus verfolgt, wonach das Böse in den Begriffen selber liege – und man die alte Einsicht von Ludwig Wittgenstein, wonach die Bedeutung eines Wortes in seinem Gebrauch liege, vergessen hat. Deswegen muss man ja auch ständig nach neuen Begriffen suchen, denn bei jedem Begriff – und sei er noch so wohlmeinend – kann sich jemand beleidigt fühlen. Es sind Begriffskaskaden, mit denen wir konfrontiert sind, und das schlägt irgendwann ins Gegenteil um: Anstatt sich respektvoll und verständlich zu begegnen, herrscht blankes Unverstehen, weil kaum jemand mehr diese Abkürzungen entschlüsseln kann. Außer man betreibt es als eigene Wissenschaft, aber dafür ist mir mein Leben eigentlich zu kurz.
DIE FURCHE: Wobei es im akademischen Bereich mittlerweile ein Netzwerk gibt, das all dies kritisiert und „Wissenschaftsfreiheit“ fordert. Haben Sie selbst tatsächlich den Eindruck, dass die Freiheit und die Lust am Denken behindert werden?
Liessmann: Ich bin nicht Mitglied dieser Initiative. Aber die Kolleginnen und Kollegen haben den Eindruck, dass eine bestimmte Form der akademischen Auseinandersetzung nicht mehr möglich ist, weil es gerade in den Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften einen ideologischen Mainstream gibt, dem man entweder folgt, oder man ist aus diesem Diskurs verbannt. Und auch ich habe den Eindruck, dass eine bestimmte Form einer Lust am Denken verunmöglicht wird durch verordnete Denkblockaden.
DIE FURCHE: Zum Beispiel?
Liessmann: Wenn Studentinnen und Studenten sich in Berlin weigern, die Schriften des bedeutendsten Aufklärers des 18. Jahrhunderts, Immanuel Kant, zu lesen, weil sie irgendwo gelesen haben, dass er auch rassistische Bemerkungen gemacht haben soll, dann kann ich nur sagen: Da gibt es keine Lust am Denken mehr!
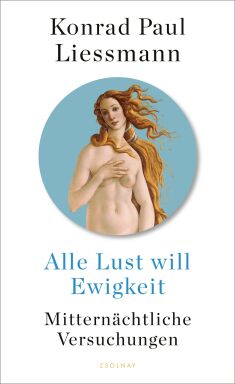
Alle Lust will Ewigkeit
Mitternächtliche Versuchungen
Von Konrad Paul Liessmann
Zsolnay 2021
320 S., geb., € 26,80
DIE FURCHE: Dieses Kant-Beispiel ist verstörend. Aber ist Ihnen Ähnliches auch an einer österreichischen Uni passiert?
Liessmann: Mir persönlich nicht, und ich habe auch den Eindruck, dass die von protestantischer Ethik gekennzeichnete Geistesmentalität wesentlich rigider ist als jene in Österreich. Das Einzige, was mir hierzulande aufgefallen ist, war, dass man an der Universität für Angewandte Kunst Alice Schwarz, der Ikone des deutschen Feminismus, Redeverbot erteilen wollte. Das habe ich als Ironie der Weltgeschichte bzw. Realsatire empfunden.
DIE FURCHE: Apropos (angewandte) Kunst: Im Lockdown wurde von der „Florestan-Initiative“ Klage beim Verfassungsgerichtshof gegen Schließung der Kultureinrichtungen eingebracht – weil es ein Menschenrecht auf Kunst und Kultur gebe. Andere nennen Kunst ein „Lebensmittel“. Ist sie das? Oder befriedigt sie „nur“ die Lust? Oder macht sie völlig anderes?
Liessmann: Wäre Kunst ein Lebensmittel, müssten 90 Prozent der Menschen längst verhungert sein. Schon aus diesen rein soziologischen Überlegungen heraus kann man nicht davon sprechen, dass Kunst ein Lebensmittel ist. Ich würde aber auch aus philosophischen Überlegungen sagen: Sie darf gar kein Lebensmittel sein. Denn das Schöne an der Kunst ist ja genau, dass sie Ausdruck der Fähigkeit des Menschen ist, auch etwas hervorzubringen und zu genießen, was nicht den Notwendigkeiten des Daseins unterliegt. Das war der große Gedanke von Friedrich Schiller in seinen Briefen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“. In der Kunst und in der Wissenschaft zeigt der Mensch, dass er tatsächlich frei sein kann. Ich halte Kunst also für einen essenziellen Ausdruck menschlicher Freiheit. Genau deshalb würde eine prinzipielle Einschränkung der Kunst den Menschen also tatsächlich zutiefst treffen.
Ich finde es spannend, dass Religion selbst ein zutiefst ambivalentes Verhältnis zur Lust hat und gerade die christliche Religion das Leid ins theologische Zentrum rückt.
DIE FURCHE: Kommen wir am Ende zur religiösen Sicht auf Lust; diese reicht von der erwähnten Askese bis zur Ekstase. Wobei dem Christentum in besonderer Weise Lustfeindlichkeit attestiert wird. Zu Recht?
Liessmann: Das Problem ist tatsächlich, dass das Christentum diesen Verdacht nie losgeworden ist. Jetzt bin ich aber auch nicht der Überzeugung, dass das nur ein theologischer Irrtum war. Denn Lust kann tatsächlich etwas sein, das Menschenleben negativ tangiert und soziale Beziehungen zerstört. Auf der anderen Seite wird gerade Religion von vielen gedeutet als sublimierte Form erotischer Ekstase: Alle Anzeichen von Verzückung, die religiöse Menschen in einem ekstatischen Zustand haben, deuten das ja auch an. Ich finde es sehr spannend, dass Religion selbst ein zutiefst ambivalentes Verhältnis zur Lust hat und gerade die christliche Religion eine ist, die das Leid ins theologische Zentrum gerückt hat.
DIE FURCHE: Im Buddhismus wiederum geht es darum, sich gänzlich von Lust und Schmerz zu befreien. Sie haben gemeint, Sie würden sich vor dem neuen Asketismus fürchten, aber können Sie einer solchen Idee etwas abgewinnen?
Liessmann: Natürlich. Denn das Aufgespanntsein zwischen Lust und Schmerz führt auch dazu, dass das Leben ständig zwischen Depression und Ekstase hin- und hergeht. Und das führt zum Wunsch, das Ganze zu einem Ausgleich zu bringen. Das kann ein schlechter Ausgleich sein im Sinne einer Mittelmäßigkeit, was Nietzsche hämisch als „die kleinen Lüstchen“ für den Tag und für die Nacht beschrieben hat. Und die Pandemie hat uns ja gelehrt, dass es so einfach nicht ist, diese Mittelmäßigkeit aufrechtzuerhalten. Und dann gäbe es noch die philosophische, eigentlich nihilistische Konsequenz: Es soll alles irgendwann aufhören. Aber das heißt natürlich letztlich, die Lebendigkeit soll aufhören. Sigmund Freud hat mit seiner späten Theorie des Todestriebes hier etwas ganz Wesentliches erfasst: Nämlich dass alles, was nach Lust strebt und deshalb naturgemäß auch Leid erfahren muss, letztlich danach strebt, in den Zustand zurückzukehren, aus dem es gekommen ist: nämlich in den anorganischen, in den Tod. Nirwana, dieser buddhistische Begriff, beschreibt nichts anderes. Nur ist uns das nicht geschenkt. Wir müssen durch diese Spannungen von Lust und Schmerz hindurch. Solange es ums Leben geht, um Sexualität, Kunst oder auch um Fragen der Macht, wie sie in Österreich gerade so aktuell verhandelt werden, kommen wir aus dieser Spannung aus Lust und Leid nicht heraus.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!





























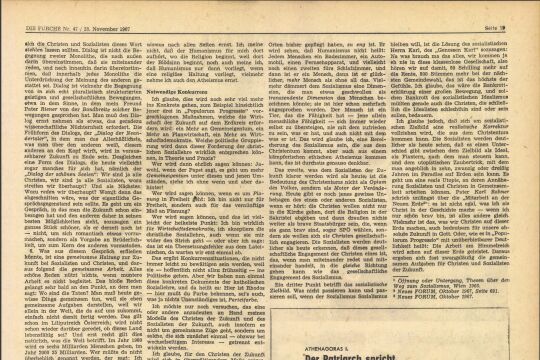




























.jpg)