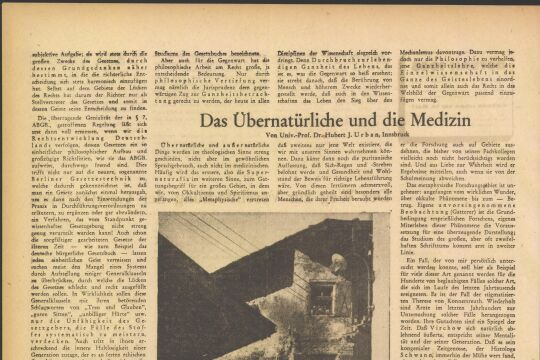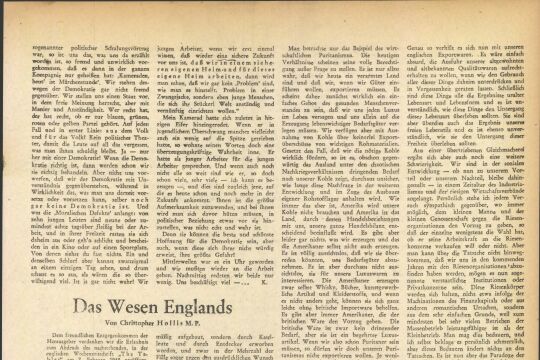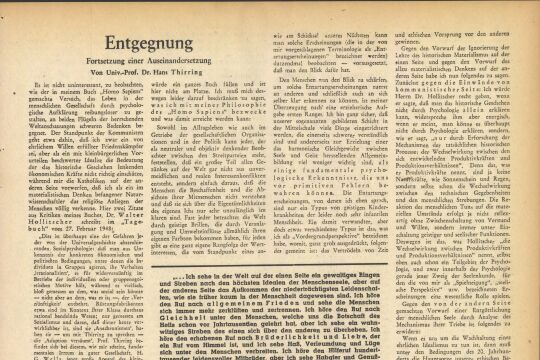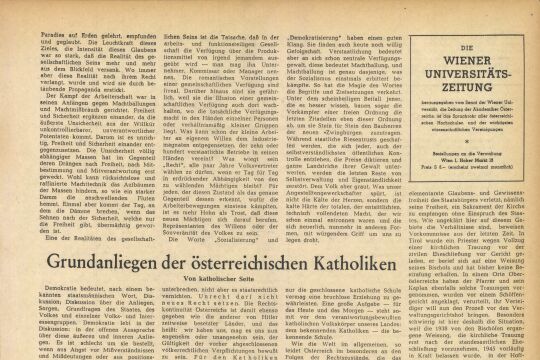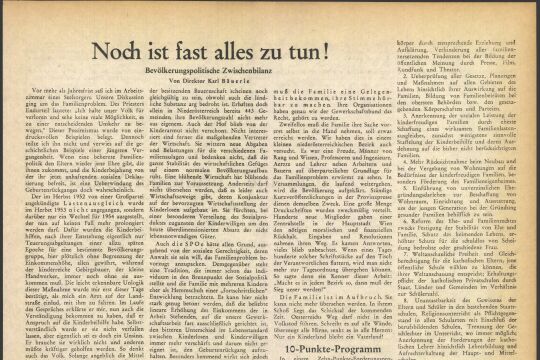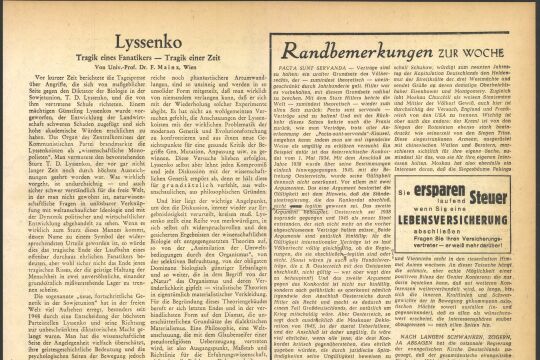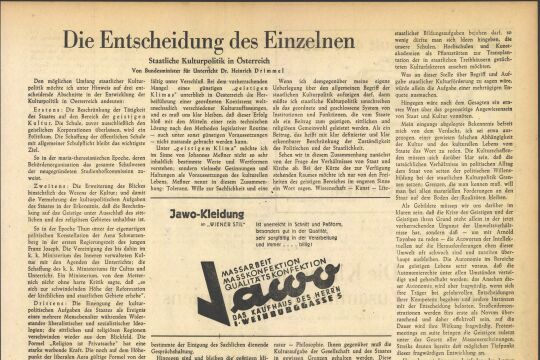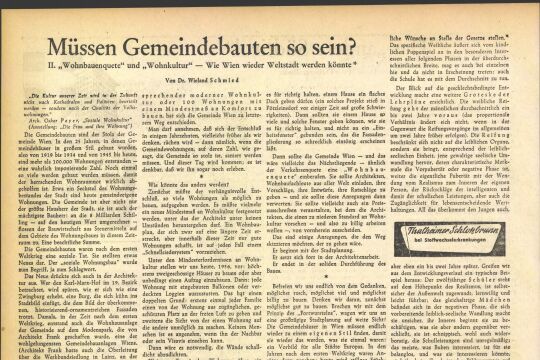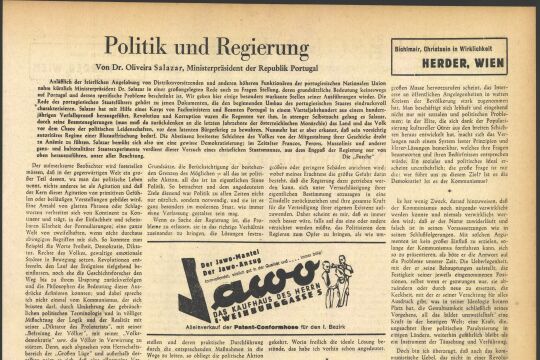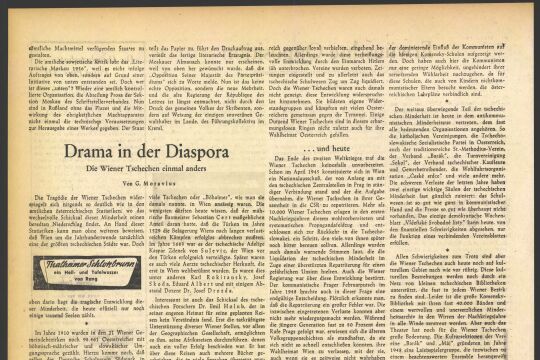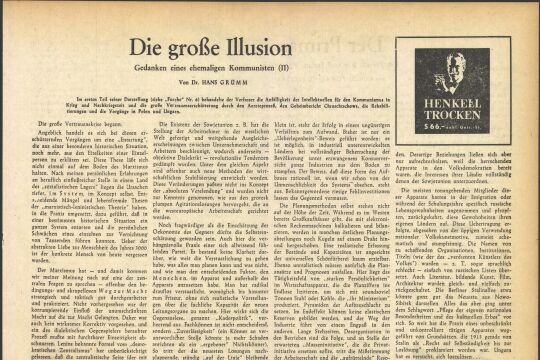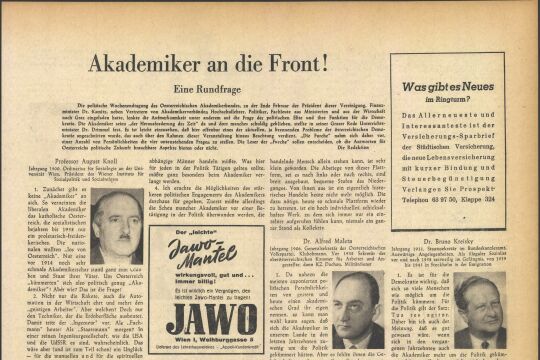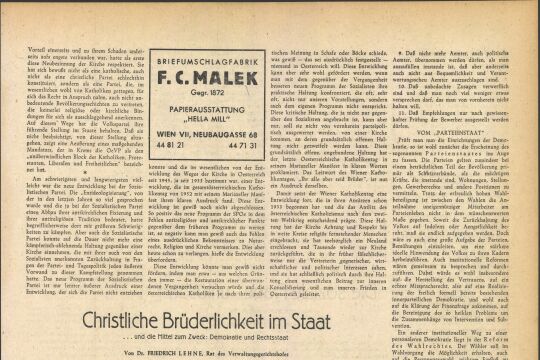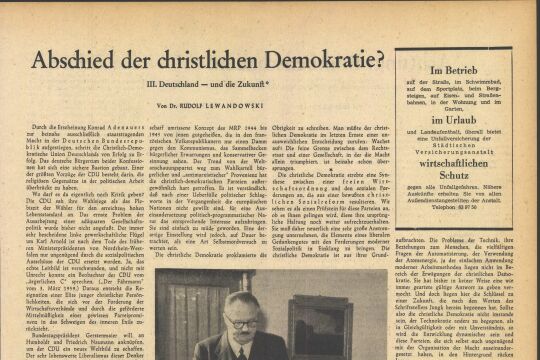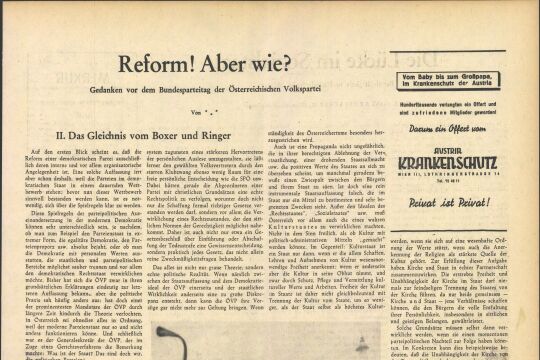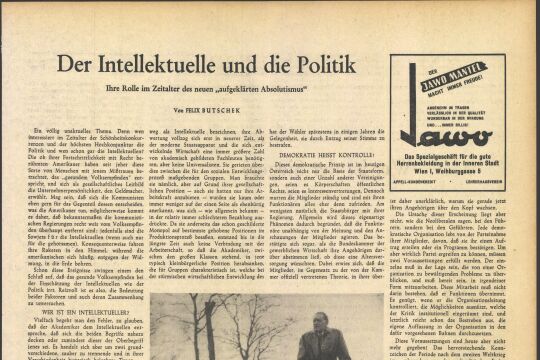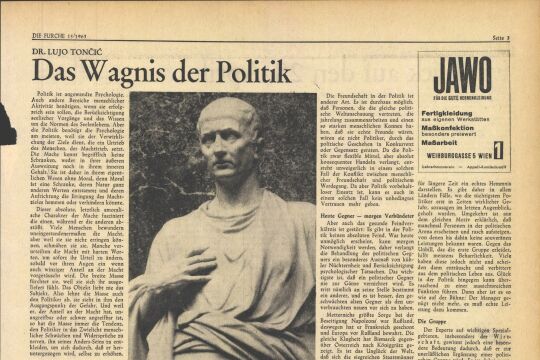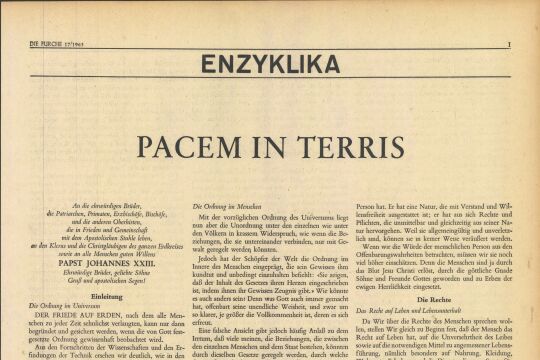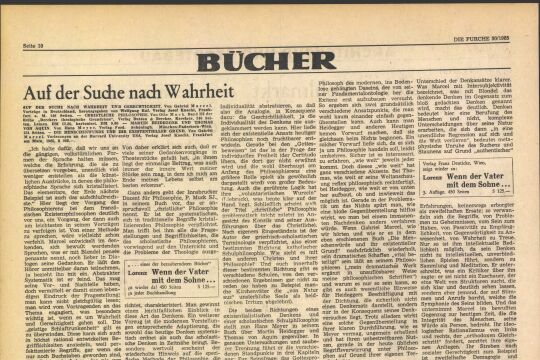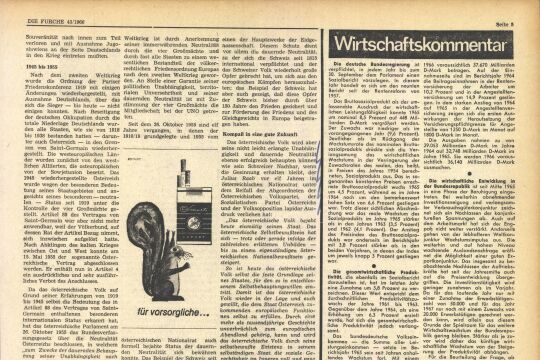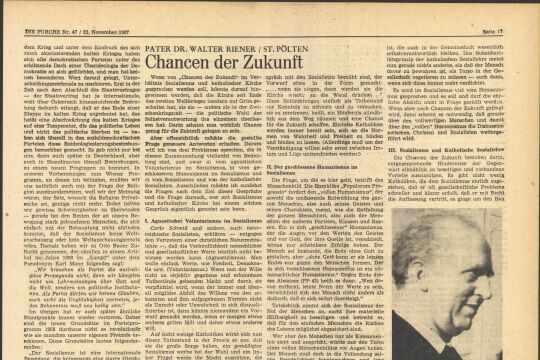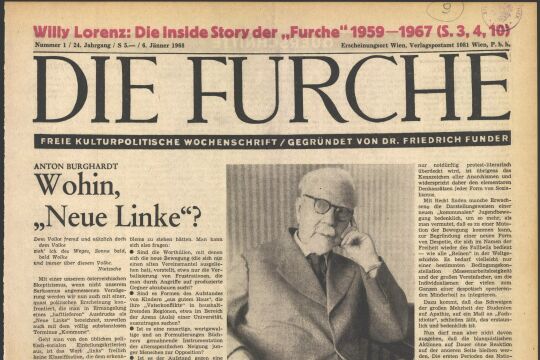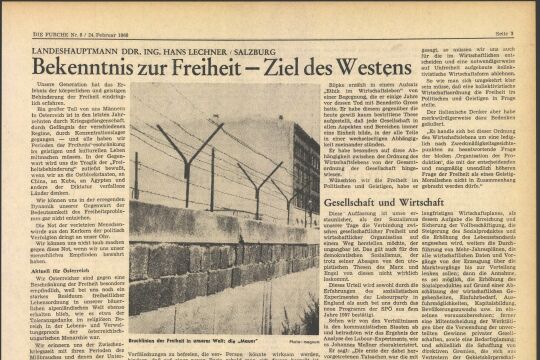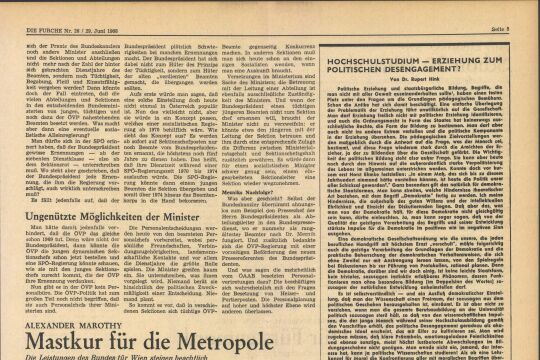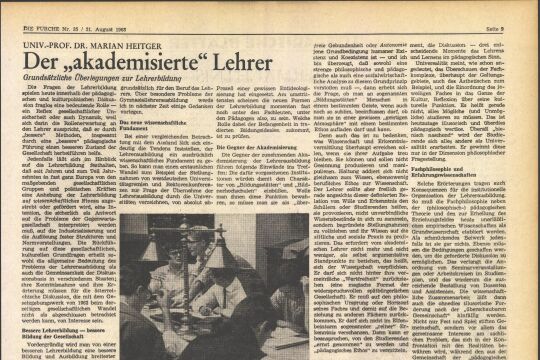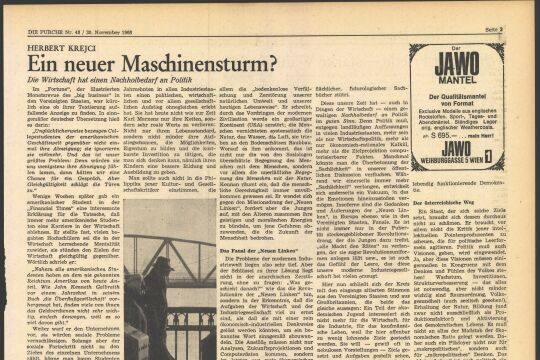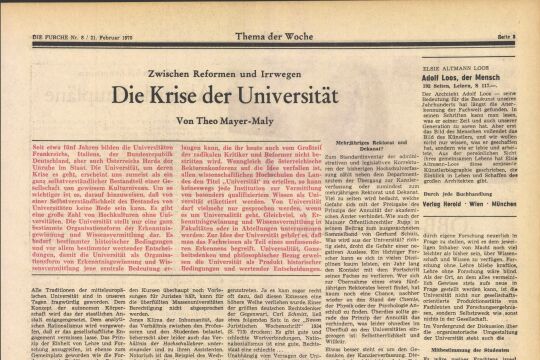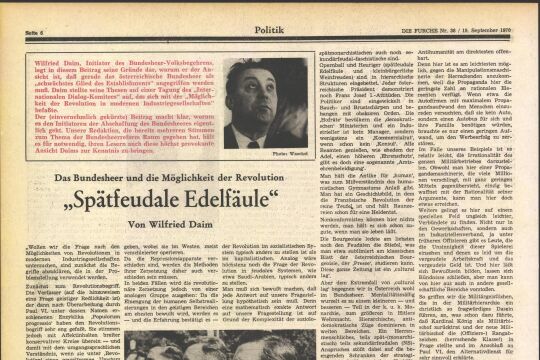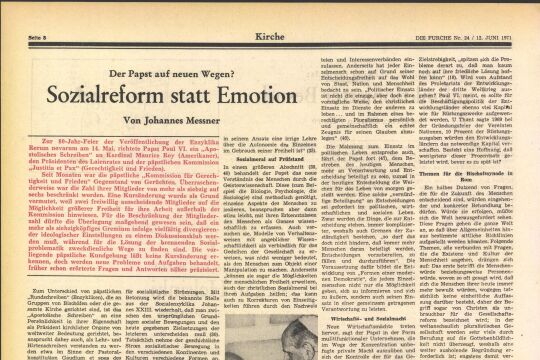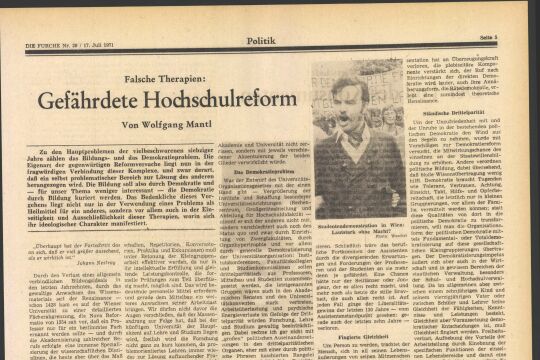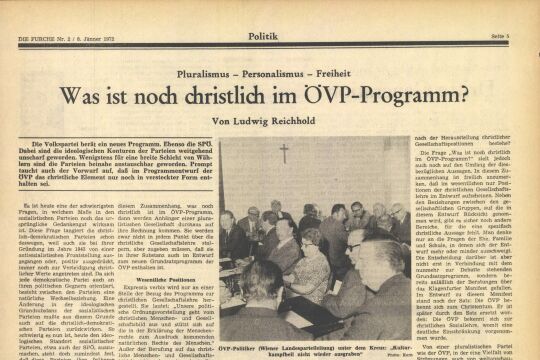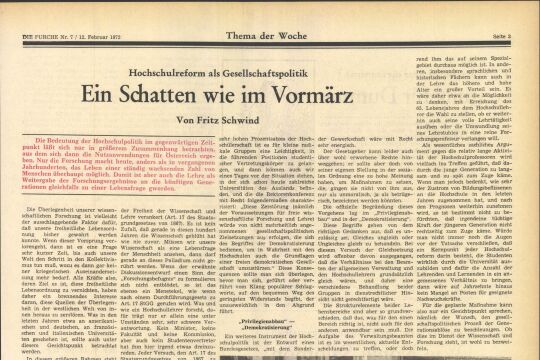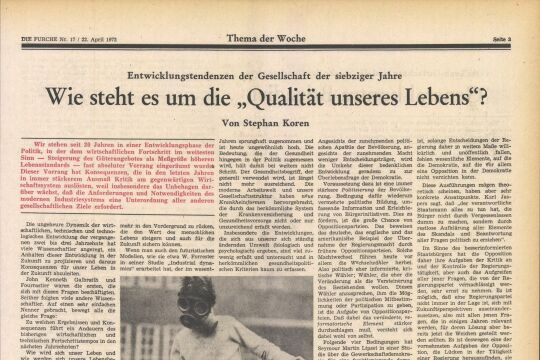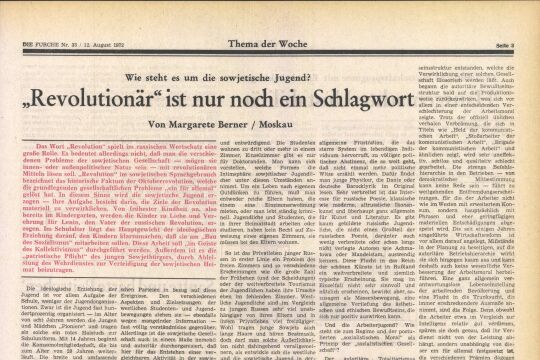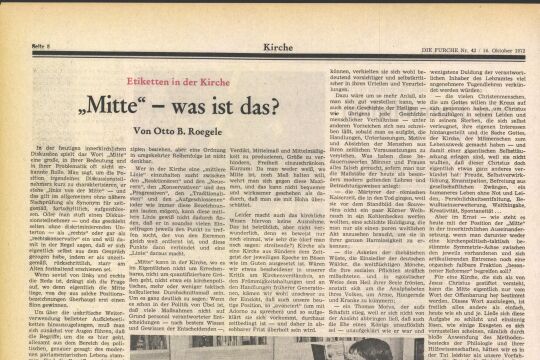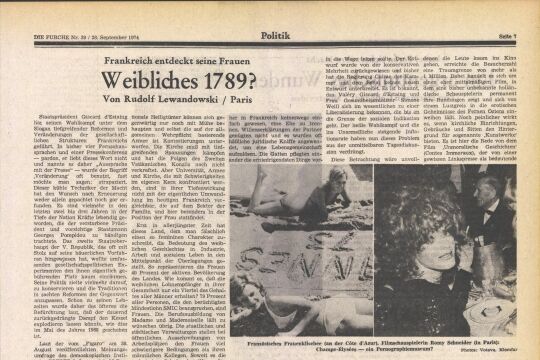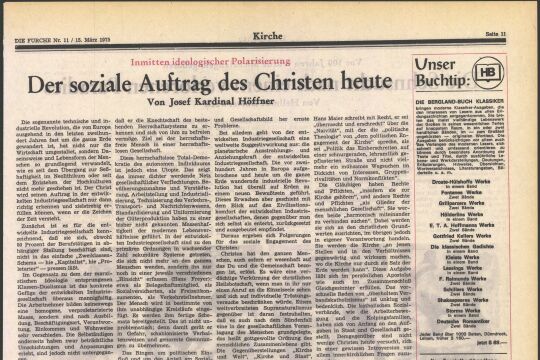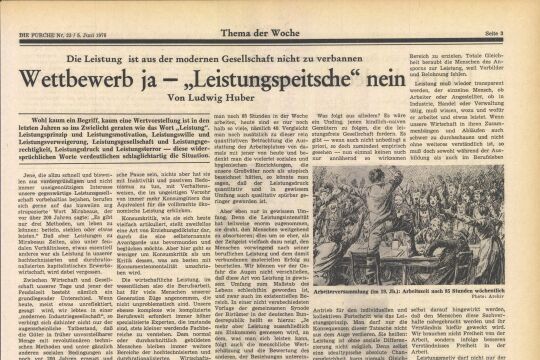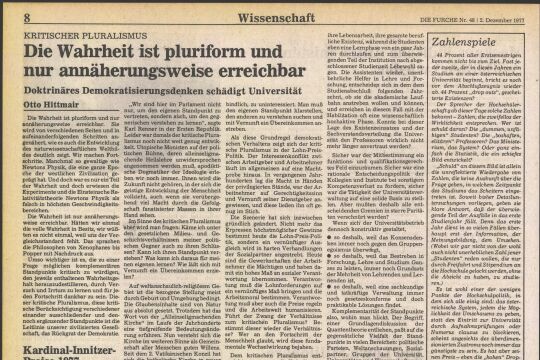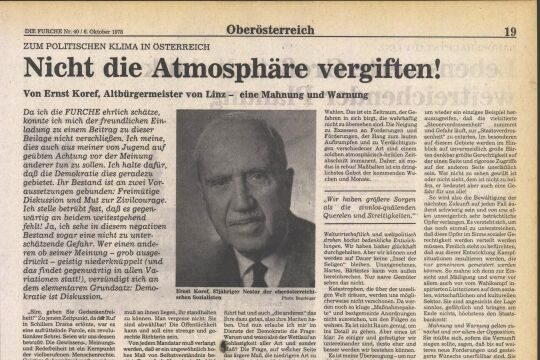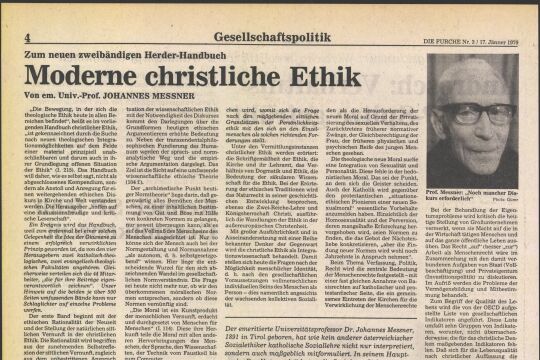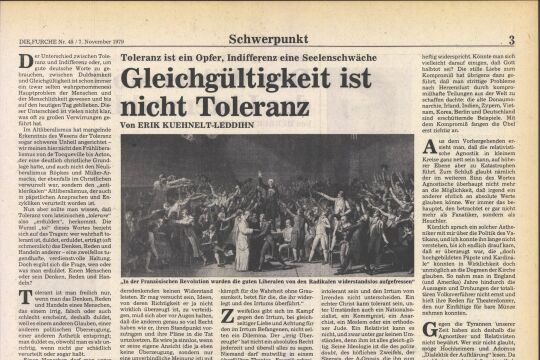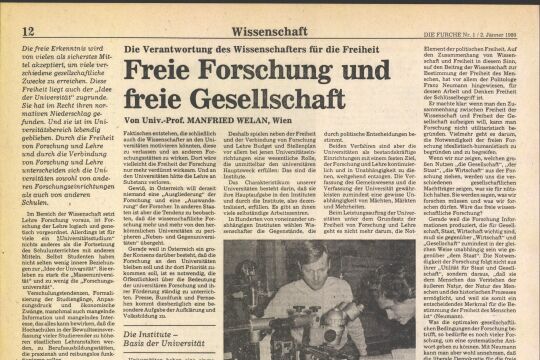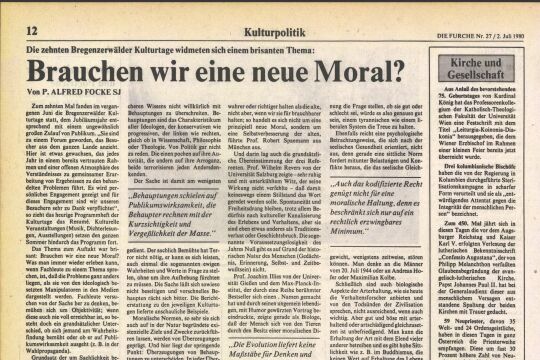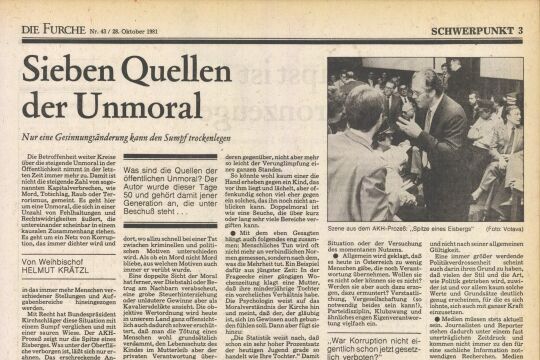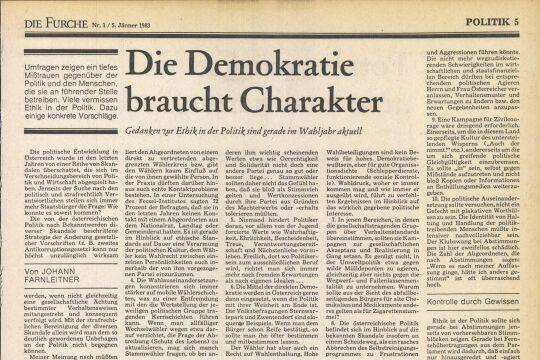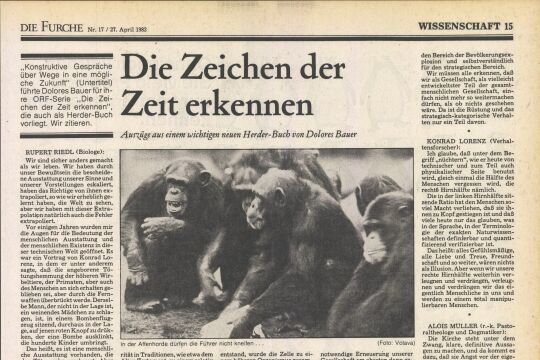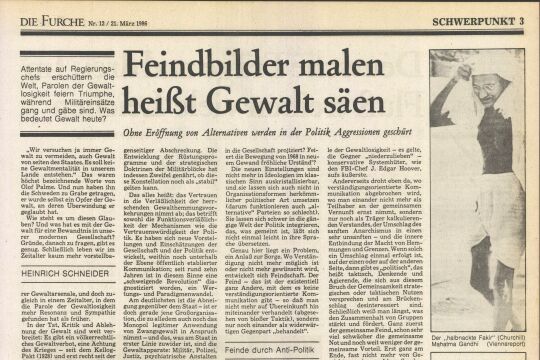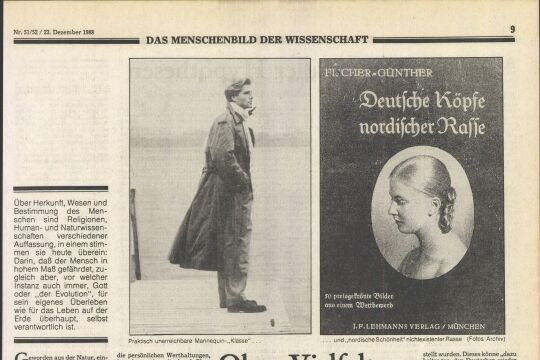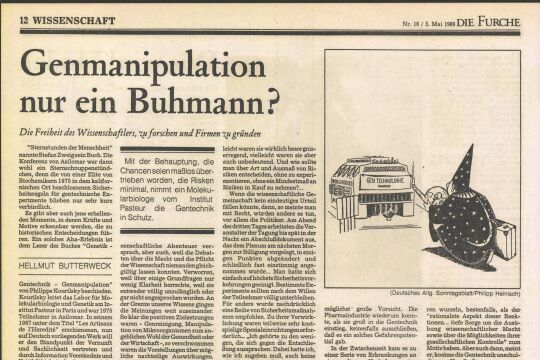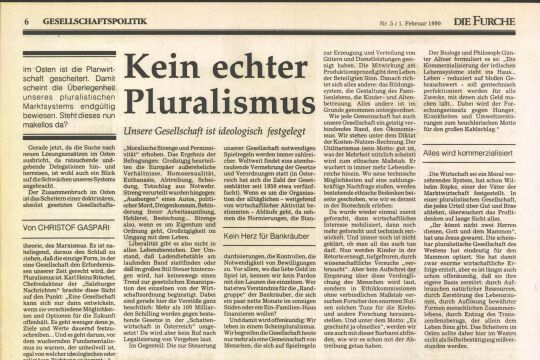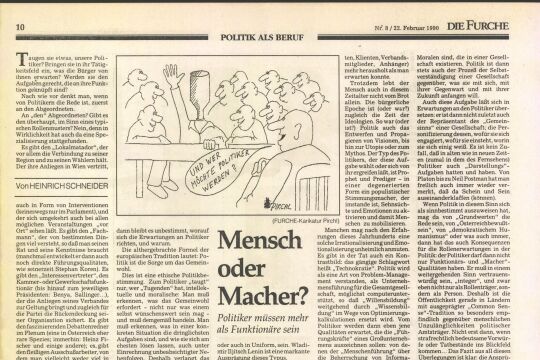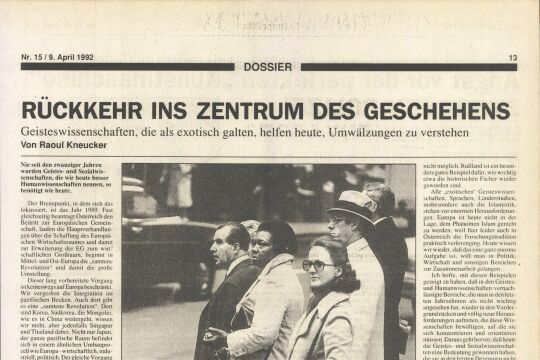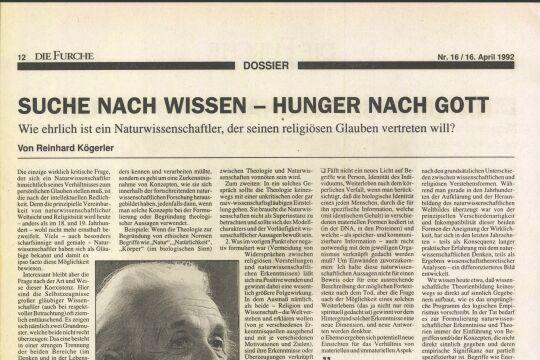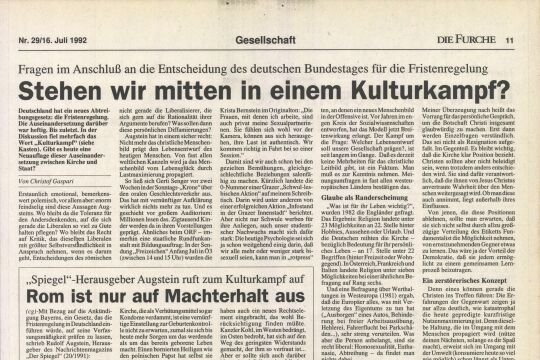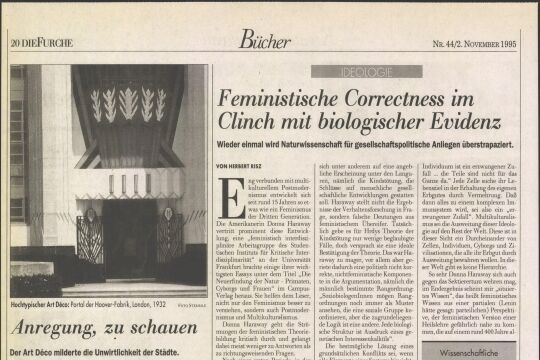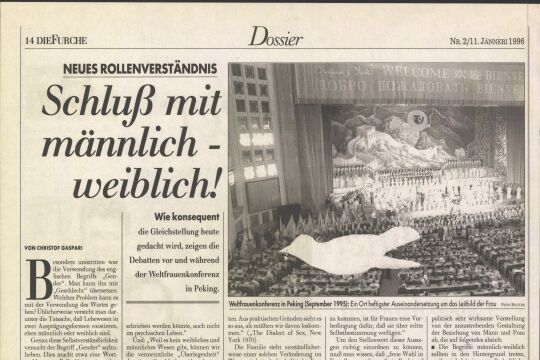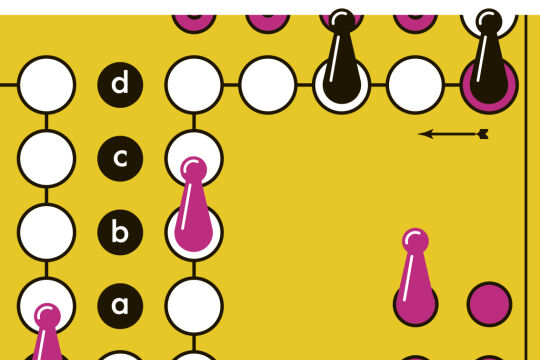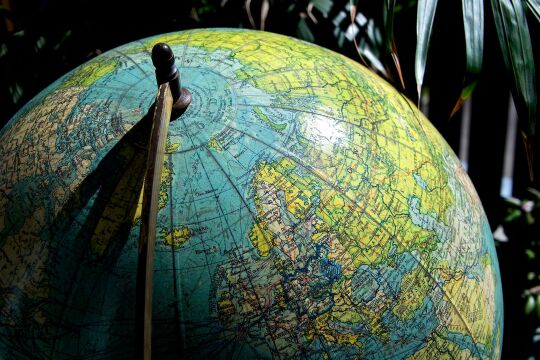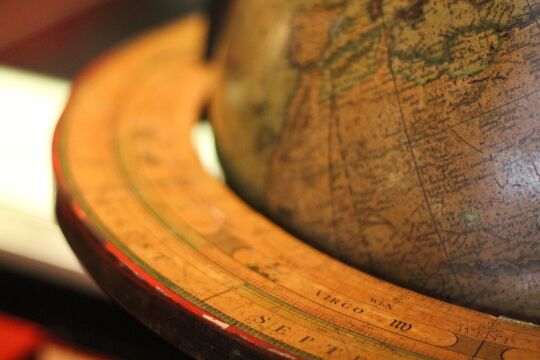Frau sein
DISKURSWissenschaftsfreiheit: Disziplinieren statt argumentieren?
Um die freie Forschung an den Universitäten sei es schlecht bestellt, meint die Initiatorin des „Netzwerks Wissenschaftsfreiheit“. Ein Gastkommentar.
Um die freie Forschung an den Universitäten sei es schlecht bestellt, meint die Initiatorin des „Netzwerks Wissenschaftsfreiheit“. Ein Gastkommentar.
Damit sich ein Freiheitsrecht richtig entfalten kann, muss ein Klima der Freiheit bestehen. Insbesondere in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften steht es um dieses Klima der Freiheit nicht zum Besten. Der Grund dafür ist, dass gerade im letzten Jahrzehnt hochgradig politisierte und moralisierte identitätspolitische Agenden in diesen Disziplinen immer einflussreicher wurden.
Wissenschafterinnen, die diesen Agenden anhängen, zeigen eine starke Neigung zur Zweckentfremdung von Forschung und Lehre. Für sie steht nicht das ergebnisoffene Streben nach Erkenntnis im Zentrum, sondern die Frage: Wie lassen sich Forschung und Lehre nutzen, um die Gesellschaft nach der eigenen Weltanschauung zu formen? Ihr Hauptziel lautet: Gerechtigkeit für sogenannte nichtprivilegierte Gruppen. Gerechtigkeit ist in ihren Augen erst dann verwirklicht, wenn diese Gruppen überall exakt ihrem Bevölkerungsanteil entsprechend vertreten sind. Dabei lassen sie nur eine Erklärung für Unterrepräsentationen, etwa von Frauen, Migrantinnen oder Musliminnen in Parlamenten, gelten: strukturelle Diskriminierung. Andere Erklärungen, egal wie gut sie empirisch belegt sind, werden abgewehrt – nicht durch Argumente, sondern durch persönliche Angriffe auf diejenigen, die sie vorbringen.
Moralische Diskreditierung
Agendawissenschafterinnen agieren also nach dem Motto „Disziplinieren statt argumentieren“. Durchgesetzt wird dieses Prinzip mit drei Mitteln: der moralischen Diskreditierung, der sozialen Ausgrenzung und der institutionellen Bestrafung. Konkret: Wissenschafterinnen, die mithilfe empirischer Studien zu „missliebigen“ Ergebnissen kommen, werden nicht mit den Instrumenten der Wissenschaft widerlegt: den valideren Daten beziehungsweise dem tragfähigeren Argument. Sie werden als Sexisten, Rassisten oder als islamophob etikettiert, um sie moralisch canceln zu können. Die soziale Ausgrenzung solch moralisch gecancelter Personen ist dann der nächste Schritt. Da der Mensch eine moralische und soziale Haut hat, geht von beiden Vorgehensweisen ein „chilling effect“ aus, der signalisiert: Vorsicht, mit bestimmten Forschungsfragen und aus empirischen Ergebnissen abgeleiteten Argumenten betritt man karrieregefährdendes Terrain. Am wirkungsvollsten ist aber das Disziplinierungsmittel der institutionellen Bestrafung. Gerade weil das Wissenschaftssystem von Abhängigkeitsverhältnissen geprägt ist, entfaltet dieses Mittel fast garantiert seine beabsichtigte Wirkung, nämlich die Vermeidung von Forschung zu Fragen, auf die Agendawissenschafterinnen mit Disziplinierungsmaßnahmen reagieren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!