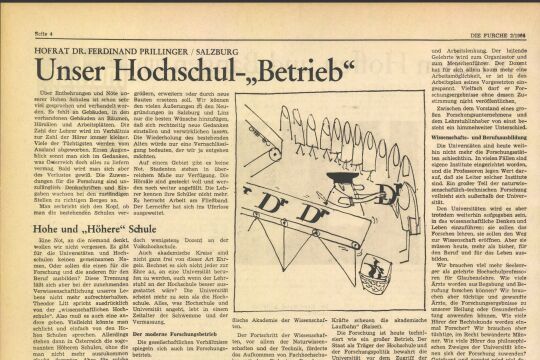Die Wienbibliothek im Rathaus lud zum Symposium über die Wissensgesellschaft nach der Wende von 1989. Der Philosoph und Kulturwissenschafter Wolfgang Müller-Funk sprach u.a. zur heutigen Wissensgesellschaft.
Den Begriff „Wissensgesellschaft“ hab ich unlängst aus berufenem Munde vernommen. Präsident Medwedew sagte, Russland müsse eine „Wissensgesellschaft“ werden, es dürfe nicht länger nur ein Rohstofflieferant sein. Diesem nachgeholten Diskurs sieht man die Modernisierungsrhetorik, von der soziologische Stichwortgeber und diverse Trendforscher bestens leben, von Weitem an. Sie bringen jene „Plastikwörter“ hervor, wie sie die Politik liebt, weil sie Sein und Sollen, Diagnose und Botschaft miteinander verschränken: Das ist eine scheinbare Anleitung zu einem politischen Handeln, das vom Gestus lebt, richtig zu liegen, die passende Formulierung gefunden zu haben. Wissenschaft als Dienstleisterin der offiziellen Politik. Das ist das Wissen, das heute politisch erwünscht ist. Kurzum, die Formel „Wissensgesellschaft“ lebt von einer ihr innewohnenden, womöglich kontrafaktischen Suggestion.
Ökonomisierung des Wissens
Der unspezifische Gebrauch des Wortes „Wissen“ verschleiert, dass es keine Gesellschaft gibt, die nicht von irgendeinem Wissen lebt. Das gilt auch für die „Industriegesellschaft“, die man Ende der 1980er Jahre im Namen der Wissens- oder auch Informationsgesellschaft verabschiedet hat.
Es nimmt sich eigenartig aus, dass diesem Wissen die Nachsilbe -schaft abhanden gekommen ist, obschon es doch um neue Inhalte und Formen von Wissenschaft geht, die in den Mittelpunkt heutiger Gesellschaften rücken. Von welchem Wissen ist da die Rede? Warum gibt es keinen Verweis auf Bildung und Wissenschaft? Eines ist sicher: „Mein“ Wissen als Kultur- und Humanwissenschaftler ist damit nicht primär gemeint; die Rede ist von einem Wissen, das im Sinne der Bemerkung des russischen Präsidenten ökonomisch so wichtig ist wie die Förderung von Erdgas und Erdöl. Es geht also um die Produktion eines Wissens, das sich rechnen soll. Dieses Wissen bildet die Basis für die Prosa von Antragsprozeduren und Seminarevaluierungen.
Das Kalkül hinter der Formel von der „Wissensgesellschaft“ suggeriert, Wissen sei so ähnlich förderbar und produzierbar wie Erdöl und Kohle. Eine einschlägige Kennerin hat in diesem Zusammenhang von der Rückkehr der Planwirtschaft gesprochen. Es müssen Entwicklungspläne geschrieben, Effizienzüberlegungen angestellt, Planziele aufgestellt, Evaluierungsprozeduren durchlaufen, Peer-Review-Verfahren vorgenommen werden. Kein Forschungsantrag, wo man nicht angeben muss, was die „Dissemination“ eines Projektes oder eines Instituts sein wird.
Bologna ist auch, nicht nur das Ergebnis einer veränderten Bildungsökonomie und -politik. Es ist der ökonomistische Wahn von Menschen, die in ihrer Mehrheit keine Ökonomen sind. Anders wäre es nicht erklärlich, dass wir im deutschsprachigen Raum so viele ausgezeichnete junge Wissenschaftler produzieren, die wir, nachdem wir einiges Geld in sie investiert haben, auf die Straße setzen. Kein Unternehmen in der Welt würde ohne Not junge, begabte Mitarbeiter nach fünf Jahren entlassen, um sodann neue aufzunehmen, die man nach fünf Jahren.
Ich habe übrigens meinen Zweifel, ob die nationalen und europäischen, von potenziell konkurrenzierenden Kollegen begutachteten Programme zur Forschungsförderung, in die die Ideologie der „Wissensgesellschaft“ eingeschrieben ist, wirklich so innovatives und kreatives Wissen generieren, wie sie vorgeben. Durch ihre Rahmenvorgaben verstärkt sie viel eher das Bestehende, als dass sie Neues wenigstens nicht behindert. Aus der Wissenschaftsgeschichte nicht erst seit Thomas S. Kuhn wissen wir, wie defensiv und konservativ wissenschaftliche Disziplinen im Hinblick auf die Verteidigung des einmal erworbenen symbolischen Terrains sind, das musste Mendel ebenso erfahren wie Freud. Ich habe in dem Bereich „Kulturwissenschaften“ (einem Bereich, der sich nicht ganz zu Unrecht als innovativ und korrektiv versteht) in den letzten zehn Jahren unzählige Forschungsschwerpunkte erlebt, Gedächtnis, Übersetzung, Raum, Transfer, Körper un dergleichen mehr. Ich hege den Verdacht, dass die Schwerpunktsetzungen nicht selten den intellektuellen Prozessen hinterher eilen, sie werden dann zu Schwerpunkten, weil es bereits wichtige, vielleicht die wichtigsten und grundlegendste Publikationen schon gibt.
Den Worten folgen keine Taten
Wenn die Forschungskohorten das betreffende Terrain abgegrast haben, bis kein Gras mehr wächst, begibt man sich auf das nächste Terrain, wird der nächste „Turn“ ausgerufen. Was dabei produziert wird, ist weniger „Wissen“ als schnell vergängliche Mode. Was bleibt, sind oftmals die Werke jener Köpfe, die Michel Foucault als Diskursbegründer bezeichnet hat. Eines scheint mir sicher: In der „Wissensgesellschaft“ von heute würde es kein Projektgeld für die „Kritik der reinen Vernunft“ oder für die Psychoanalyse geben, um nur zwei Beispiele zu wählen.
Diskursgeschichtlich betrachtet ist die „Wissensgesellschaft“ die Grundlage, der ideologische Boden für unsere nicht enden wollende Bildungsdebatten. Dabei stehen die vollmundigen Absichtserklärungen der Politik insbesondere hierzulande in einem grotesken Missverhältnis zu den Taten. Je mehr von ihr die Rede ist, desto weniger geschieht in der Praxis. Es scheint so zu sein, dass dem Land – um jetzt in meinem Feld zu bleiben –, in dem Psychoanalyse, analytische Philosophie, Phänomenologie oder moderne empirische Sozialforschung maßgeblich mit entstanden sind, einem der reichsten Länder dieser Erde, die Entwicklung von Wissen nicht besonders am Herzen liegt, nicht viel wert ist, schon gar nicht viel Geld. Diese Gleichgültigkeit ist das eigentliche Skandalon.
Warum sind einem Land wie Österreich Bildung, Ausbildung und Wissenschaft so wenig wert? Warum werden noch immer der soziale Status akademischer Titel hervorgehoben, Bildung und Wissenschaft im öffentlichen Diskurs derart hintangehalten? Warum gibt es kaum Politiker, die die Courage besitzen zu sagen, dass es noch keine Schul- und keine Universitätsreform, keine guten Schulen und akademischen Einrichtungen gegeben hat, die zum Nulltarif zu haben sind?
Geld ist nicht alles, aber – um hier der Ökonomie doch zu ihrem Recht zu verhelfen – maßgeblich. Was uns von den erfolgreichen Universitäten dieser Welt trennt, das ist bildlich gesprochen die Differenz des Budgets zwischen Manchester United und Rapid Wien. Es macht vom Grundstudium bis zum Doktoratsprogramm einen erheblichen Unterschied, wie viele Studierende auf einen Professor kommen, ob in einem Seminar 15 Leute sitzen oder 75, wie intensiv meine Magisterarbeit betreut wird. Wenn man die Dinge verändern will, muss die Gesellschaft dafür Geld zur Verfügung stellen. Ob man das über Studiengebühren lukriert (wie in den angelsächsischen Ländern), ob er über steuerliche Belastungen (wie in Skandinavien) oder durch unpopuläre Sparmaßnahmen in überbürokratisierten Bereichen, darüber lässt sich geflissentlich streiten. Ohne zusätzliches Geld lässt sich weder die Situation an den Schulen, noch des Grundstudiums noch der inneruniversitären Forschung verbessern. Dabei geht es um Infrastruktur, mehr Lehrpersonal und um die Integration von jungen Forscherinnen und Forschern.
Prinzipiell soll jeder und jede studieren können; es kann indes im Gesamtinteresse einer Gesellschaft liegen, dass nicht alle alles beliebig lange studieren können.
Auch die Gegenüberstellung von „Bildung“ und „Ausbildung“ halte ich für problematisch. Denn die Bildung, auch die politische, soziale und menschliche, sollte eigentlich – auf dem „eigentlich“ liegt der Akzent – das vornehmste Ziel des sekundären Bildungsbereiches, der höheren Schulen sein, während die tertiäre Ausbildung doch die Berufswahl in sich trägt: ich studiere Medizin, weil ich Ärztin werden möchte und ich studiere Musik, weil ich einen musikalischen Beruf ausüben möchte.
Berechtigter Kern der Kritik
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass jene wenigen Einrichtungen in Österreich, die strenge Zulassungsbeschränkungen kennen, die Kunst- und Musikhochschulen, aber auch die diversen Theater-Seminare, die mit dem höchsten internationalen Prestige sind, mit vielen ausländischen Lehrenden und einem hohen internationalen Prozentsatz. Die jungen Leute, die in diese durchaus konkurrenziellen Einrichtungen kommen, möchten – aus ganz egoistischen Motiven – erstklassige Musiker, Künstler, Schauspieler und Regisseure werden. Eine solche Haltung sollten wir im gesamten universitären Bereich fördern möglichst ohne bürokratische Reglements, wie sie aus dem angelsächsischen Bereich einströmen.
Und im Hinblick auf die studentischen Proteste, die einen mehr als berechtigten Kern haben, würde ich meinen, dass es Korrekturen an Bologna geben sollte. Man kann beispielsweise keine fremde Sprache und Kultur in sechs Semestern ohne Auslandsaufenthalt professionell kennen und verstehen lernen. Die Änderungen betreffen wohl auch das ECTS-Punkte-System und viele andere Details. Aber es wäre unredlich zu sagen, dass Bologna nicht auch ein Moment von Fortschritt in sich trägt: Denn die angestrebte Europäisierung bedeutet wissenschaftlich, politisch und lebensgeschichtlich einen Stimulus, ein Mehr an Internationalität, ein höheres Maß an kultureller und sozialer Kompetenz, ein Weniger an Provinzialität. Gerade kleinere Länder müssen daran ein hohes Interesse haben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!