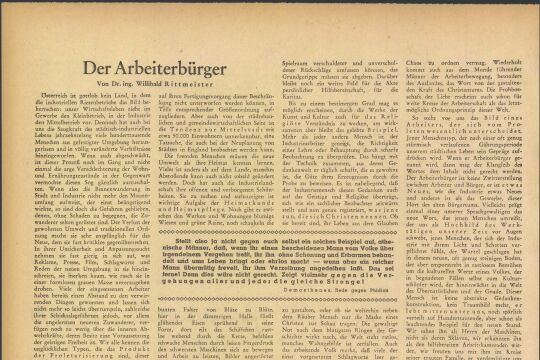Wir haben uns schon seit langem daran gewöhnt, zwischen manueller und nicht-manueller Arbeit eine scharfe Trennungslinie zu ziehen. An und für sich ist dies etwas durchaus Natürliches, und die Geschichte kennt eine solche Scheidung seit jeher. Doch dieses Auseinanderhalten ist nur insoweit natürlich und zeitlos, als man es rein technisch, zur äußerlichen Definition einer Arbeit auffaßt und verwendet. In früheren Zeiten ist dies ja auch so gewesen, und erst das 19. Jahrhundert ist auf die Idee gekommen, diesen äußerlich-technischen Unterschied auch zu einem sozialen, gesellschaftlichen Wertmaß zu machen. Denn die Standesunterschiede der vorhergehenden Zeit wurzelten in ganz anderen Bereichen: Herkunft, das Maß an Verantwortung, das zu tragen war, und die Leistung innerhalb des Berufes selbst bestimmten den gesellschaftlichen Standort des Menschen. Die Arbeit als solche wurde also im wesentlichen gleich eingeschätzt, einerlei ob es nun eine „hohe“ oder „niedrige“ war. Die Abkapselung der Zünfte unterstreicht diese Einstellung nur: man hielt den eigenen Stand für etwas so Wertvolles, daß man ihn eben möglichst rein erhalten wollte. (Die Diskriminierung mancher Berufe, zum Beispiel der Henker oder Bader, kommt ja weniger vom Sozialen als vielmehr vom Kultischen her.)
Die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts hat diesem Zustand aber ein jähes Ende gemacht. Die Fabrik sdijen keine schöpferische Arbeit zu kennen, def berufliche Ehrgeiz fand keine Ansatzstellen mehr und die entsetzlichen Arbeitsbedingungen der damaligen Zeit taten ein übriges, den Wert der Handarbeit herabzusetzen. Hunderttausende, Millionen von Menschen, die einst ein persönliches Verhältnis zu ihrem Beruf gehabt hatten, sahen sich mit einemmal normierten und schematischen Arbeitsbedingungen unterworfen und verloren damit die seelische Bindung an ihren Beruf. Goethe hat die Entpersönlichung der Arbeit in den „Wanderjahren“ wunderbar vorausbefürchtet, und die Maschinenstürmer — wie man sie damals nannte — zertrümmerten die neuen Werkbänke nicht bloß, weil sie in ihnen die lohndrückenden Konkurrenten sahen, sondern weil sie spürten, daß hier die Räuber ihrer Arbeitsfreude aufgestellt waren.
In der Folgezeit wurde der Industriearbeiter zu einem Muster, nach dem das
Das Befinden Dr. Funders
Die Besserung im Befinden unseres schwer erkrankten Chefredakteurs Doktor Friedrich F u n d e r schreitet erfreulicherweise fort, wenn es auch noch längere Zeit dauern wird, bis er wieder zu seiner Berufsarbeit zurückkehren kann, überaus zahlreich sind die Kundgebungen liebevollster Teilnahme, die dem Kranken aus weitesten Kreisen der Bevölkerung und auch aus dem Auslande zukommen.
Bild des manuellen Arbeiters überhaupt gezeichnet wurde, und mehr und mehr kristallisierte sich der Gegensatz zum nicht-manuell tätigen Menschen heraus. Allmählich verwandelte sich dieser Gegensatz von einem technischen in einen sozialen, und an Stelle des wenig verwendeten Begriffs „nichtmanuell“ trat der des „geistigen Arbeiters“. Dies aber war eine der verhängnisvollsten Fehlunterscheidungen, die man nur machen konnte. Denn damit prägte man einerseits jeder nichtmanuellen Arbeit den Stempel des Geistigen auf, sprachaberaufder anderen Seite der Handarbeit als solche den Geist ab. Der Fortschrittsglaube des jungen Liberalismus tat das Seinige dazu: man werde in einigen Jahrzehnten die Technik ohnedies so vervollkommnet haben, daß der sie „bedienende“ Mensch schließlich völlig überflüssig sein werde, und so war es kein Wunder, wenn die Tätigkeit dieses Maschinen-beflieners nicht allzu hoch im Kurs stand.
Die tiefe Kluft, die sich zwischen manueller und nichtmanueller Arbeit aufgetan hat, wird am besten deutlich aus den Entsagungen, die Hunderttausende von Arbeitervätern auf sich nehmen, um ihre Söhne durch Handelsschulen, Realgymnasien und Universitäten durchzubringen. Wenn diese Menschen nicht wirklich das Gefühl hätten, damit aus ihren Kindern etwas Besseres zu machen, wären sie gar nicht imstande, die finanziellen Opfer auszuhalten,. die ein studierender Sohn ihnen aufbürdet. Dabei ist es aber keineswegs so, daß man unter „etwas Besserem“ nur den Doktor oder Ingenieur meint. Es ist die Schreibtischarbeit, der „white-collar-job“, wie es die Amerikaner nennen, der diesen sozialen Nimbus ausmacht. Aber weil der Karteischreiber im äußeren Bild der Arbeitskleidung dem Universitätsprofessor ähnelt oder in einer ähnlichen Umgebung wie der Rechtsanwalt seine acht Stunden absitzt, so ist er deswegen noch lange kein geistiger Arbeiter. Gewiß gibt es bei den Papierbesdireibern mehr Intelligenzberufe als bei den Handarbeitern. Aber auch in dieser zweiten Kategorie finden wir eine Unzahl von Menschen, die schöpferisch tä,tig ist, Verantwortung tragen und deren Ausbildungszeit ein Vielfaches von dem beträgt, was die meisten Büroangestellten als Lehrzeit benötigen. Die letzten Jahre haben es uns deutlich genug bewiesen, wie rasch man aus einem Mechaniker einen Postbeamten machen kann, wie schwierig und langwierig jedoch der umgekehrte Weg ist. Der vieldiskutierte „Lauda-Plan“, nach dem 20.000 Staatsbürokraten in die Industrie übergeleitet werden sollen, hat darum neben den psychologischen auch höchst sachliche Hindernisse zu überwinden: man kann nämlich Facharbeiter — und solche, nicht Hilfsarbeiter brauchen wir — n ij: h t in Schnellsiedekursen ausbilden. Das haben auch die Umschulungsversuche der Arbeitsämter bald genug bewiesen.
Weil nun so viele Menschen am sozialen Ansehen des „geistigen“ Arbeiters teilhaben wollen, ist der Zustrom zu den nichtmanuellen Berufen in den letzten Jahrzehnten 90 ungeheuer gestiegen. Es ist übrigens interessant, daß man das Verhängnivoll dieser Entwicklung schon sehr früh erkannt hat. So hat zum Beispiel im Jahre 1830 Kaiser Franz I. vor der Vermehrung der höheren Schulen gewarnt. Seitdem hat sich aber — um nur ein Beispiel herauszugreifen — die Bevölkerung Vorarlbergs nur verdreifacht, während die Absolventenziffer der dortigen höheren Schulen in gleicher Zeit auf fast das Hundertfache angestiegen ist.
Die Folgen dieser ganzen Entwicklung können wir in mehreren Bereichen feststellen. Zunächst ist durch den Massenandrang das Niveau unser einst mit Recht so berühmten Gymnasien urtd Realschulen im Lauf der letzten 30 Jahre ganz wesentlich gesenkt worden. Vor dem ersten Weltkrieg konnte eben ein Abiturient wirklich lateinisch und griechisch, das heißt er verstand ohne Schwierigkeit jeden Schriftsteller und war imstande, eine lateinische Abhandlung abzufassen. Heute wird es sehr wenige Maturanten geben, die das von sich behaupten können. An den Universitäten liegen die Dinge ähnlich. Trotz der schlechten Wirtschaftslage ist die Zähl der Studierenden bei uns immer noch so hoch, daß zum Beispiel ein Seminarbetrieb mit zehn, zwölf Studenten — wie er früher selbstverständlich war — in vielen Fächern sehr selten geworden ist.
Die wertmäßige Unterscheidung zwischen Hand- und Schreibtischarbeit bewirkt zweitens, daß Menschen mit einer gewissen Handwerkstradition dauernd aus ihren erlernten oder angestammten Berufen abwandern und damit die Qualität der handwerklichen Produktion dauernd absinkt. Freilich zeigt es sich bald, daß diese Menschen einen ziemlich fragwürdigen Tausch gemacht haben, als sie in die neue Sphäre der Büroarbeit einzogen. Und damit stoßen wir bereits auf die dritte Folgeerscheinung.
Die wirtsch'aftliche Bewertung der nichtmanuellen Arbeit hat auf der ganzen Welt einen Tiefpunkt erreicht, den vor 25 Jahren niemand vorauszusagen gewagt hätte. Uberall sind die Sdireibtisch-arbeiter auf der Lohnliste von den Handarbeitern überholt worden. Nicht nur die unteren Angestellten wurden davon betroffen, auch die echten Intelligenzberufe sehen vielfach die Grundlagen ihrer Existenz schwanken. Was liest ntan nicht täglich .über resigniert auswandernde Professoren, Aufrufe zur Besserung des Loses der Ärzte, Beamten usw.
Schließlich ist auch der ungeheure Verwaltungsapparat, den sich nicht nur der Staat, sondern auch die Privatwirtsdiaft zugelegt hat, eine Folge des übergroßen Angebots an Verwaltern, Registrierern, Listenschreibern und Karteiordnern. Wo eine solche Unzahl von Menschen in Stellungen und Posten drängt, werden ganz automatisch immer neue Stellungen und Posten geschaffen. Schon allein das Helfen- und Unterbringenwollen stampft erfahrungsgemäß immer neue Arbeitsgebiete, Ressorts und Referate aus dem Boden.
Nun beginnen sich seit dem Ende des zweiten Weltkriegs gewisse Anzeichen zu zeigen, aus denen man vielleicht auf eine Lösung dieses verfahrenen Zustandes hoffen könnte. Immer häufiger kann ipan nämlich feststellen, daß geistig schaffende Menschen ihre Kinder ein Handwerkerlernen lassen und so mit dem Vorurteil der „niederen“ Handarbeit brechen. Und zwar sind das keineswegs nur jene, die vielleicht eine völlige Umwandlung unserer Gesellschaft befürchten und einfach einem Schlosser unter einem bolschewistischen Regime größere Uberlebungschancen voraussagen. Nein, auch Menschen mit einer wesentlich optimistischeren Auffassung entschließen sich zu “diesem Schritt, über den sie vor zehn, zwölf Jahren noch als eine romantische Form des Salonbolschewismus geladit hatten. Man beginnt nämlich einzusehen, daß Handarbeit keineswegs a priori Bildung ausschließt. Die zum Teil recht schönen Erfolge der Volkshochschulen und die Nachrichten, die aus dem Ausland über Arbeiterbildung zu uns gelangen, haben gewiß manche Eltern in diesem Entschluß bestärkt.
Diese Entwicklung hat noch eine andere gute Seite: es läßt sich wohl denken, daß die gehobene Facharbeiterschaft und das Handwerk ihrerseits d-urch Nachwuchs mit einer gewissen Bildungstradi-tion einen bedeutenden Aufschwung erleben. Wenn nämlich ein junger Mensch mit jenem gepflegten Kunst-Verständnis — wie wir es trotz Verarmung noch in vielen Beamtenfamilien vorfinden — nun ins Handwerk hinüberwechselt, so ist es, ganz klar, daß man etwas von diesem Geist auch in seinen Erzeugnissen wieder finden wird. — Aber auch die Intelligenzler und Büroarbeiter werden günstige Wirkungen verspüren: denn jetzt werden sich nur mehr jene für diese Berufe entscheiden, die auch tatsächlich Anlage, Neigung und die notwendigen Fähigkeiten mitbringen. Die unzähligen Verlegenheitslösungen, die man nur mangels eines echten Berufswunsches eingeht, werden dann jedenfalls bald aus der Mode kommen. Es wäre in diesem Zusammenhang interessant, einmal in einer Handelsakademie — um nur ein Beispiel herauszugreifen — zu fragen, w i e-viele der dort sitzenden Schüler sich wirklich eine Vorstellung von ihrer zukünftigen Beschäftigung machen.
Wenn wir nun überlegen, was für ein armseliger Ersatz bei so vielen Menschen an die Stelle des Berufsstolzes getreten ist • und was sich an Steckenpferden und Hobbies in die erste Linie gedrängt hat, dann werden wir den Wert einer Entwicklung, die diese Abirrungen korrigiert, gewiß nicht zu gering einschätzen.