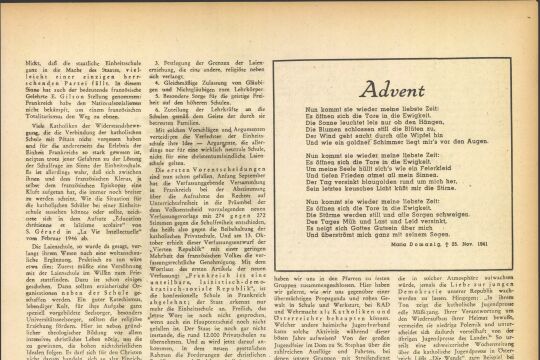Der Regen hat unserer Schaufensterpromenade ein Ende gesetzt. Da sitzen wir nun seit einer halben Stunde im Cafe Odeon und besehen uns, was an unserer Fensterecke vorbei über das Züricher Bellevue gegangen, getrippelt und gefahren kommt. Der Zeitvertreib ist vergnüglich genug und aufschlußreich obendrein, mehr noch als das Studium von Statistiken über die Höhe oder die Verteilung des schweizerischen Volkseinkommens. Die Zahlen besagen, daß die Schweiz im Wohlstand lebt, daß es nicht etwa einer Minderheit, sondern breiten Volksschichten gut geht, daß die Kaufkraft und die Umsätze im Detailhandel im allgemeinen immer noch steigen. Sie geben aber keine Auskunft darüber, wie sich die Schweizer zu ihrem eigenen Wohlergehen einstellen. Die Beobachtungen aus unserer Fensterecke lassen keinen Zweifel zu: so viele Autos, so viele neue, teure Wagen, so viele neue, teure Mäntel, Anzüge, Handschuhe, Taschen, Schuhe, so viel Schmuck — die Leute, seien sie nun dazu imstande oder nicht, legen Wert darauf, gut zu leben.
Auf den ersten Blick nehmen sich so die Dinge ziemlich einfach aus, bilden eine einfache Figur, in wenigen Strichen zu zeichnen. Der Schweizer hat oder verdient mehr Geld als früher, gibt mehr Geld aus als früher für einen bestimmten Gegenstand, um besser zu leben. Eine Erklärung dafür zu finden, ist weniger leicht, denn lassen sich die Zunahme des Besitzes und der höhere Verdienst allenfalls aus wirtschaftlichen Zusammenhängen begründen, so erhält man daraus noch keine Antwort auf die Frage, wie es zu den größeren Ausgaben kam. Wer viel Geld hat, braucht darum noch lange nicht notwendigerweise viel auszugeben. Und vor allem bleibt noch unklar, wie der Schweizer darauf verfiel, seine Lebenshaltung zu ändern, den Standard zu erhöhen und darauf Wert zu legen. Dies nämlich ist ein Novum in der Geschichte des Landes.
Es will noch nicht viel heißen, daß die Autos und Fernsehapparate, Badezimmer und Waschmaschinen sich fortwährend mehren; auch anderswo machen sich diese Bedürfnisse stärker geltend. Mit Automation und American Way of Life haben die Veränderungen, die für die schweizerische Lebenshaltung bezeichnend sind, nichts zu tun. Wer aber hätte es sich in den dreißiger Jahren träumen lassen, daß sich beispielsweise zwei kaufmännische Angestellte minderen Ranges über die respektive Güte von Rhein- und Moselweinen unterhalten könnten? Und Leute, die vordem in braver Hausmannskost geradezu eine moralische Stütze des Bürgertums erblickten, bestellen sich heute seelenruhig Scampi ä l’Indienne oder Fondue Bour- guignonne. Aber ebenso wichtig wie gutes Essen und Trinken ist es geworden, Kleider nicht nur von „währschaftem“ Stoff, sondern auch von gutem Schnitt zu tragen, und endlich ist auch großen Teilen des Volkes das Sitzleder abhanden gekommen; man reist, alt und jung, oft und überall hin, mit Vorliebe über die Grenzen, um bestätigt zu finden, wieviel besser man selber dran ist. Einigermaßen betrüblich sei zu vermerken, daß bloß 21 Prozent der Lohnempfänger es sich leisten können, ihre bezahlten Ferien regelmäßig (!) in Ferienorten zu verbringen, hieß es besorgt und vorwurfsvoll im Bericht zu einer Untersuchung darüber, wie der Schweizer seine Ferien verbringe ...
'
An Klageliedern über den Stand der Dinge fehlt es nicht. Als Ziel der Vorwürfe erscheinen die überhöhten Ansprüche und ihre hemmungslose Befriedigung: der Bürger, die Wirtschaft, Gemeinden, Kantone und Bund, alle sollen sie über ihre Verhältnisse leben ... und niemand mehr wolle sparen. Die Behauptung, das Sparen sei in Mißkredit geraten, ist ein Gemeinplatz der Biertische geworden und hält sich hartnäckig, trifft aber nicht zu. Sind die Spareinlagen bei den Banken, am Volkseinkommen gemessen, deutlich zurückgegangen, so steht anderseits fest, daß die Schweizer seit 1945 mehr Lebensversicherungen abschließen, und zwar in einer Anzahl und Höhe, wie man es kaum für möglich gehalten hätte. Gespart wird im großen und ganzen nicht weniger, sondern mehr, anders jedoch und aus anderen Ueber- legungen heraus als früher. Diese Erscheinung gehört mit zu den vorher zitierten Fakten und vermag ihnen ein deutlicheres Profil zu geben. Mit den individuellen Lebensversicherungen hat es aber sein Bewenden noch lange nicht. Gemeinden, Kantone und Bundesbetriebe versichern ihre Angestellten immer besser und schaffen immer höhere Rücktrittsgehälter, in edlem Wetteifer'mit der gesamten Industrie des Landes, und bezeichnend ist, daß von den großen Sozialversicherungen der Eidgenossenschaft, vor Jahrzehnten schon vorgesehen, die Alters- und Hinterlassenenfürsorge erst 1948 in Kraft trat, die allgemeine Invalidenfürsorge erst 1960 wirksam wird. Auf dem Fünffrankenstück, dem schönen, schweren Fünfliber mit dem Bildnis Teils, heißt die Umschrift „Dominus providebit“. Augenscheinlich würden die heutigen Eidgenossen zum selben Zwecke eher Schillers Teil zitieren: „Der kluge Mann baut vor.“ In diesem Drang nach wirtschaftlicher Sicherheit glauben viele Beobachter den eigentlichen Motor des heutigen helvetischen Lebens zu erkennen, und weil die Schweiz in den Welthändeln während längerer Zeit gut weggekommen ist, vermuten sie, der Bürger, im Grunde seines Herzens beunruhigt und verängstigt, fühle sich dem Lauf der Dinge in der großen Welt nicht mehr gewachsen, versuche krampfhaft, seine eigene Existenz zu sichern und sich ihrer fortlaufend dadurch zu vergewissern, daß er übertrieben viel Wert auf die Lebensgenüsse lege, sein Leben also als eine Art fortgesetzter Henkersmahlzeit auffasse und betreibe. Den bisher beigebrachten Tatsachen trägt ein solches Urteil nicht übel Rechnung, läßt indessen einige andere, eben die entscheidenden, beiseite.
Gut zu leben, sicher zu leben, darum geht es dem Schweizer, gewiß, doch daneben um eines mehr: friedlich zu leben. Nicht von der traditionellen Neutralität dem Auslande gegenüber wollen wir hier sprechen, sondern vom Willen, im eigenen Hause Frieden zu halten.
Wenn die Spannungen zwischen Unternehmern und Arbeitern derart gesunken sind, daß wir füglich von einem regelrechten Arbeitsfrieden sprechen dürfen, so ist das ein Werk aus den Jahren seit 1945, und zwar ein Werk aller Beteiligten, sichtbar in der großen Zahl von beiderseits freiwillig abgeschlossenen und beiderseits verbindlichen Gesamtarbeitsverträgen, wie sie heute in allen Branchen anzutreffen sind. Arbeitskonflikte sind sehr selten geworden. Es ließe sich mehr dergleichen anführen, doch sind uns hier weniger die Ergebnisse wichtig als der Geist, aus dem heraus sie zustande kommen. Nichts könnte ihn besser unter Beweis stellen als eine vor kurzem erschienene Mitteilung des Arbeitgeberverbandes schweizerischer Maschinen- und Metallindustrieller, die wir darum im vollen Wortlaut anführen wollen (Sperrungen im Original!):
„Um die bestehenden guten Beziehungen zu festigen und in vertraglicher Form zu verankern, ist kürzlich zwischen dem Arbeitgeberverband schweizerischer Maschinen- und Metallindustrieller einerseits und dem Schweizerischen Kaufmännischen Verein, dem Schwei zerischen Werkmeisterverband und dem Verband schweizerischer Angestelltenvereine der Maschinen- und Elektroindustrie anderseits eine Vereinbarung getroffen worden. Darin verpflichten sich die Vertragspartner, die verständnisvolle Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Angestellten innerhalb der Betriebe zu fördern. Wenn in Fragen der Anstellungsverhältnisse der Angestellten, die grundsätzlich auf dem individuellen Dienstvertrag beruhen, allgemeine Richtlinien oder Empfehlungen zur Diskussion stehen, soll in g e- mtinsamen Verhandlungen ein gegenseitiges Einvernehmen angestrebt werden. Ferner erklären sich die Vertragspartner bereit, wichtige Fragen, die die Angestellten der Maschinenindustrie allgemein berühren, von Fall zu Fall zu besprechen und sich nach Treu und Glauben um Lösungen' zu bemühen.“
Wie sollte eine solche Haltung auf die sozialen Verhältnisse beschränkt bleiben? Die politischen Kämpfe der zwanziger und dreißiger Jahre, von früheren ganz zu schweigen, sind in ihrer Art gar nicht mehr denkbar. Opposition kennt das politische Leben tatsächlich nur noch als Wahlstrategie und -taktik. Es handelt sich bei der politischen Arbeit, die der Schweizer, seiner Abkunft eingedenk, oft und gern als Kuhhandel bezeichnet, nicht mehr darum, einen Modus vivendi, sondern, in Wahrheit darum, einen Modus bene vivendi zu finden, und darüber herrscht schöne Einigkeit. Wenn die Sozialistische Partei bei der nächsten Gesamterneuerung des Bundesrates zwei Vertreter stellt, so wird dadurch nur beurkundet, was tatsächlich seit mehreren Jahren feststeht: Die Parteien rückten einander näher, nicht weil sie sich schwach und ausgesetzt gefühlt hätten, sondern im Willen zur Verständigung. Endlich zeigt sich der Friedenswille im Verhältnis der Konfessionen, und wer die Schweizer kennt, weiß, daß hier die heikelsten Fragen des Zu-
sammenlebens berührt werden. In absehbarer Zeit sollen sich die eidgenössischen Räte und später das Volk damit beschäftigen, ob das Verbot des Jesuitenordens in der Bundesverfassung noch gerechtfertigt sei. Wie sehr sich die Dinge entwickelt haben, mag man daran ermessen, daß eine solche Entscheidung noch um 1950 dem Volk nicht hätte vorgelegt werden dürfen.
In einer Rede an das Volk, kurz nach dem Krieg, bezeichnete ein Bundesrat die Haltung, die dem Bürger nun not tue, als „hochgemuten Pessimismus". Es ist nicht sicher, daß sich der Bundesrat zu jener Zeit über den Inhalt seiner Worte klar war, jedenfalls aber traf er den Nagel auf den Kopf. Das Wort wird noch immer gern zitiert und beweist so, daß der Schweizer, der sich an bundesrätliche Worte sonst nicht länger als an andere Reden zu erinnern pflegt, sich darin selber erkennt. Er hat rundherum in den Augen der Welt lauter Splitter (Balken) gesehen, hat sich degoutiert davon abgewandt und darangemacht, die Balken (Splitter) aus den eigenen zu ziehen. „Wenn schon die anderen sich unmöglich benehmen, wollen wenigstens wir etwas Anständiges zuwege bringen, so gut es immer gehen will“ — so läßt sich endlich die Haltung am einfachsten wiedergeben, so lassen sich die Erscheinungen, die uns beschäftigt haben, am ehesten erklären. Daß dieserart der behördlich empfohlene hochgemute Pessimismus unterwegs in Gefahr geraten ist, zu einem hochmütigen zu werden, ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dafür gut schweizerisch ebenso wie die pädagogisch betonte Seite dieser Geisteshaltung. Ein echtes Verständnis für die Probleme des Auslandes wird man deswegen vom durchschnittlichen Schweizer noch für eine Weile nicht erwarten dürfen; denn .. . „was sollen wir uns mit ausländischen Händeln befassen, solange es in unseren Cafes Teegläser gibt, die tropfen?“ ... fragte eben jüngst ein Kabarettist im Radio, und er sprach nicht ganz im Scherz.