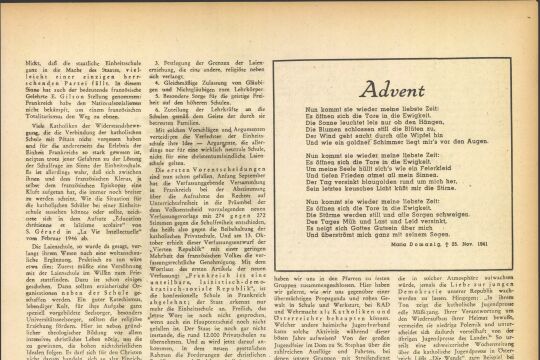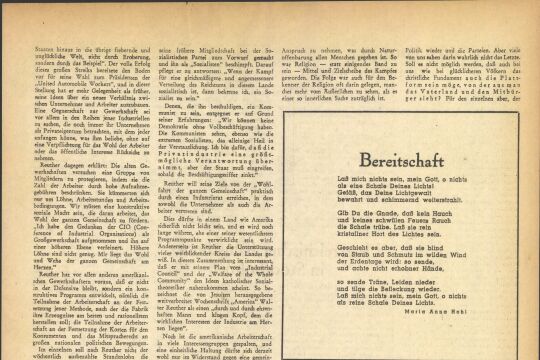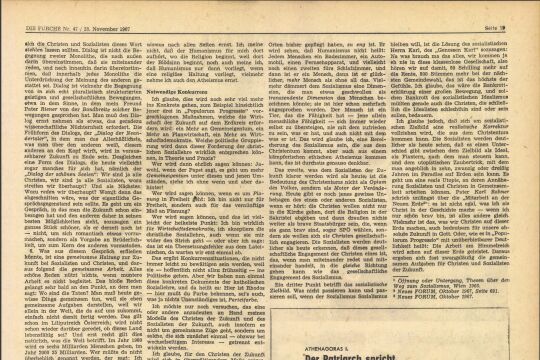In der dritten Messe vom hohen Weihnachtsfeste haben wir in der Lesung, dem Brief an die Hebräer entnommen, die Worte gehört: „Du hast, o Herr, im Anfang die Erde geschaffen, und das Werk Deiner Hände sind im Himmel. Sie werden vergehen, Du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid veralten, wie ein Gewand wirst Du sie ändern, und sie werden sich ändern. Du aber bist immer derselbe und Deine Jahre ändern sich nie“ (Hebr. 1, 12). — Unsere Lebensjahre sinken hinab in den Strom der Zeit, bis ihre Zahl erfüllt ist und zum Ende kommt. Die Jahre des Herrn aber ändern sich nie.
Warum die ernstein Töne? Ist es nicht Aufgabe der Kirche, Hoffnung zu künden und Trost zu spenden? Ja, gewiß, das ist ihre Aufgabe, und sie hat es auch seit zweitausend Jahren immer getan. Aber die Religion ist keine Nervenberuhigungs-pille, die an Stelle des guten Gewissens einen sanften Schlaf garantieren soll, die Kirche ist keine psychotherapeutische Anstalt zur Ausbügelung von Zivilisationsschäden.
Lassen Sie mich einen Augenblick die Bibel, die Heilige Schrift des .Neuen Bundes, aufschlagen an der Stelle, wo Mattliäus (4, 17) die Botschaft Jesu kurz zusammenfaßt. Wir lesen hier: „Von da an begann Jesus zu predigen. Seine Botschaft lautete: .Bekehret euch; denn das Himmelreich ist nahe' . — Sein erstes Wort war also die Forderung nach innerer Umkehr, nach einem Umdenken, wie es im ursprünglichen griechischen Text ausgedrückt wird. Es ist daher auch der Kirche aufgetragen, dieses Herrenwort immer wieder zu verkünden: Kehrt um, denkt um! Wer diesen Ruf nicht vernimmt, nicht vernehmen will, kann die Hoffnung nicht ahnen, den Trost nicht spüren, den jene Umkehr erschließt.
Kehrt um, denkt um, so geht es nicht weiter! Das hat die Kirche auch in diesem Lande stets wiederholt. Sie hat es den einzelnen Menschen gesagt: Das Leben ist mehr als die Möglichkeit, immer mehr zu konsumieren, immer raffinierter zu genießen, die Gesellschaft ist mehr als der große Kuchen, von dem jeder ein immer größeres Stück verspricht oder sich versprechen läßt; der Staat mehr als eine Versicherungsanstalt, von der man bei immer kleineren Beiträgen immer größere Leistungen erwarten kann. Das alles hat einmal ein Ende, nicht nur in bezug auf die materiellen Voraussetzungen, sondern auch hinsichtlich der begrenzten menschlichen Fähigkeiten, zu konsumieren und zu genießen.
Die Kirche hat in diesem Sinne den politischen Kräften des Landes, den Parteien und der Regierung, zugerufen, den Staat nicht als Privatbesitz zu betrachten, den man nach Belieben unter sich aufteilen könne, das große Erbe aus schwerer Zeit nicht in kleinlichen Prestigekämpfen zu vertun.
Die Kirche hat die neuen Formen einer politischen Zusammenarbeit im Lande begrüßt, weil sie eine ruhige Entwicklung, den Frieden im Inneren und den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu garantieren schienen, vor allem aber, weil sie meinte, daß der Streit der Väter in dem wiedergewonnenen Vaterland sich zu einer fruchtbareren Einheit verbinden lasse und so die Grundlagen von Staat und Nation aus dem Kampf der Meinungen herausheben könne. Die Kirche hat dafür manchen Vorwurf in Kauf genommen, sie würde, ähnlich wie vielleicht in der Vergangenheit, sich zu sehr an eine bestimmte Regierungsform binden wollen, an eine Regierungsform, die weder mit der Republik noch mit der Demokratie gleichgesetzt werden kann. Jede Form der Zusammenarbeit ist oder muß eine Leistungsgemeinschaft sein, eine Leistungskonkurrenz, ein Leistungswettbewerb. Jede Zusammenarbeit darf und muß nach ihren Leistungen beurteilt werden. Es wäre Demagogie, diese Leistungen nicht zu sehen, es wäre aber auch Blindheit, nicht eine weitgehende Ermüdung und Erschlaffung festzustellen. Die gemeinsame Regierungsform der beiden großen Parteien hat uns weitgehend den inneren Frieden im Lande gewahrt, hat mitgeholfen, die volle Freiheit des Staates zu erringen, war die Grundlage für den wirtschaftlichen Aufstieg, hat immer weitere Kreise der Bevölkerung in ein umfassendes System der sozialen Sicherheit eingebaut. Die Vorbereitung der dynamischen Rente, die Erhöhung der Altersrenten über die Grenze des absoluten Existenzminimums sind solche Leistungen im vergangenen Jahr.
Wo aber der Wille zur Zusammenarbeit fehlt, können keine Früchte der Zusammenarbeit erwartet werden. Ohne den Willen, zur Lösung zu kommen, gibt es keine Lösung. Gibt es diesen Willen heute noch? Gerade für jemand, der immer wieder zur Zusammenarbeit gerufen, an die gemeinsame Verantwortung appelliert hat, ist es schmerzlich, hören zu müssen, daß sich in beiden Parteien die Kräfte mehren, die von einer solchen Zusammenarbeit sich nicht mehr viel versprechen, die an eine solche Zusammenarbeit nicht mehr glauben. Zusammenarbeit setzt Vertrauen voraus. An die Stelle des Vertrauens ist das Mißtrauen und die Angst getreten. Die Angst aber war noch immer der Nährboden für die Panik, für die Flucht in die Gewalt.
So gehen wir in das zwanzigste Jahr unserer Zweiten Republik. Zwanzig Jahre war die Erste Republik alt, als sie äußerer Gewalt erlag, nachdem sie schon Jahre vorher im Inneren abgestorben war, an Angst und Mißtrauen, an verlorenem Vertrauen des Volkes, am verlorenen Glauben einer Jugend. Soll der Teufelskreis sich wieder schließen? Führt der Weg wieder zurück? Wir wissen, was an seinem Ende stand.
Vor fünf Jahren hat dieses Jahrzehnt begonnen, in dem das Schicksal unseres Jahrhunderts sich entscheiden wird. Vor fünf Jahren hatte ich mich an die Jugend gewandt, an die Jugend, die anders ist, aber sicher nicht schlechter als manche Jugend vor ihr.
Ich richte heute wiederum das Wort an die Jugend. Ich kann und muß es heute um so eindringlicher tun, da nicht wenige aus der Generation der Väter und Vorväter scheinbar keinen Ausweg mehr wissen, als die Schattenspiele einer unheilvollen Vergangenheit wieder aufzuführen, alte Gespenster neu zu drapieren, in blindgewordenen Spiegeln die Schreckbilder von einst zu suchen. Damit hat die Jugend nichts zu tun, das begreift sie nicht: Die Schattenspiele, die Gespenster und die blinden Spiegel. Lernt die Vergangenheit erkennen, lernt aber die Gegenwart lieben und an die Zukunft glauben! Die Jugend der Ersten Republik hatte den Glauben an das Land und sein Volk weitgehend verloren. Euch, der Jugend unserer Zeit, ist dieser Glaube eine Selbstverständlichkeit. Laßt euch nicht irre machen, seid aber auch nicht ungerecht gegen eure Väter.
An diese Verantwortung hat die Kirche appelliert, und an sie appelliert sie immer. Die äußeren Formen der Zusammensetzung einer Regierung können wechseln, können müde und brüchig werden. Die gemeinsame Verantwortung aller für diesen Staat, die Zusammenarbeit aller aber ist viel mehr als eine Koalitionsform, sie muß bleiben in jedem System.
Wie überall, wo Menschen beisammen wohnen, müssen einige der grundlegenden Dinge vollkommen außer Streit gestellt sein: die Gleichheit aller vor dem Gesetz, der Respekt vor dem Gesetz und dem Richter, das Recht aller Menschen, gerechten Teil zu haben an den Erträgnissen der gemeinsamen Arbeit. Es muß hierzulande außer Streit gestellt sein das Bekenntnis zur Republik, zur Demokratie und zum Entscheid des Volkes; das Bekenntnis zum Vaterland und seiner Stellung nach außen sowie zu den Notwendigkeiten seiner Verteidigung.
Dazu gehört auch das^Befeenntnis zu den wesentUchsten^J^mTcfeh-.'j^aer gemeinsamen Wertordnung, in dem die geistigen Werte, die Bildung im weitesten Sinne, einen hohen Rang einnehmen. Dazu gehören die Mei-nungs- und Pressefreiheit, der Respekt vor der Überzeugung des anderen, auch der religiösen Uberzeugung; die Anerkennung des Wertes der Religion und die Uberzeugung, daß die Kirche außerhalb des politischen Meinungsstreites steht und daß Kirche und Religion von keiner Seite als politische Argumente verwendet werden können.
Recht und Freiheit aber können nicht isoliert betrachtet werden. Sie werden erst dann zur Realität, wenn sie mit den Pflichten korrespondieren, die der einzelne der Gemeinschaft gegenüber hat. Die Freiheit, das Recht, die Demokratie kann man nicht mit Geld kaufen. Sie kann man nur durch eigenen Einsatz, durch Mitbeteiligung sichern.
Wer sich nicht engagiert, wer jede persönliche Anteilnahme scheut, der soll sich nicht wundern, wenn andere an seiner Stelle Politik machen. Wer will, daß etwas geschieht, der muß etwas tun. Wenn ich für die Demokratie bin, dann muß ich mich am politischen Geschehen beteiligen und nicht nur auf die „droben“ schimpfen, weil sie es nicht besser machen. Wenn ich für die Sauberkeit bin, dann muß ich die Unsauberkeit bekämpfen und nicht den für einen Dummkopf halten, der sich nicht am „Geschäft“ beteiligt. Wenn ich für die Ehrlichkeit bin, dann kann ich nicht in den Chor der Heuchler und Pharisäer einfallen. Wenn ich für die Meinungsfreiheit bin, dann muß ich offen reden. Wenn ich für Geistesfreiheit bin, dann darf ich nicht schweigen um der Karriere willen. Wenn ich eine Menschheit für ein erstrebenswertes Ziel halte, dann darf ich das beklagenswerte Geschehen im Kongo nicht als Vorwand nehmen, mich von meinem Beitrag an der Hilfe zu drücken. Wenn ich für den Frieden bin, dann muß ich auch etwas für den Frieden tun. Wenn ich für die Brüderlichkeit aller Menschen schwärme, kann ich nicht alte Rassenvorurteile konservieren. Wenn ich für das Recht bin, dann kann ich nicht den Richter bekämpfen, weil er nicht für mich entschieden hat.
Auch in der Religion ist es nicht anders. Ich kann nicht die Öffnung der Kirche im Konzil begrüßen und weiterhin in meiner Enge bleiben. Ich kann nicht für ein Gespräch der Feinde eintreten, wenn ich mit meinem Freund nicht reden kann und nicht reden will. Ich kann nicht die Wiedervereinigung der christlichen Konfessionen ersehnen, meinen eigenen katholischen Glauben aber in einen Rechts- und Linkskatholizismus aufspalten. Auch hier gilt: Wer will, daß etwas geschieht, muß etwas tun. Ein bloßes Lippenbekenntnis zu einem Prinzip gilt nicht. Mittun, sich engagieren, darauf kommt es an.
Das zwanzigste Jahr der Republik ist auch das zehnte Jahr des Staatsvertrages. Sollen wir uns nicht gerade in diesem Jahr des Vermächtnisses des großen österreichischen Staatsmannes Julius Raab erinnern und an sein Wort „Haltet die rot-weißrote Fahne hoch ? Sollten wir neben der rotweißroten Fahne, über die auch einmal gestritten wurde und die heute unser aller selbstverständlicher Besitz ist, nicht auch zu einem gemeinsamen österreichischen Staatsfeiertag kommen?
Die katholische Jugend hat sich nach dem Krieg für ihre Arbeit das Motto gewählt: „In der Liebe zu Österreich soll uns niemand .übertreffen.“ Sollten die österreichischen Parteien, jede Partei für sich, nicht heute bekennen: In der Leistung für Österreich soll uns niemand übertreffen? Die Demokratie als Leistungswettbewerb im Staat, in der Gemeinde, aber auch in der Wirtschaft!
Im neuen Jahr feiert die Wiener Universität ihr 600jähriges Jubiläum. Auch im geistigen Raum geht es nicht ohne Leistungswettbewerb. Wir können die großen Erfolge der Wiener Hohen Schule nur dann mit Berechtigung anführen, wenn wir uns wenigstens bemühen, es unseren Vorvätern gleichzutun, nicht mit Worten, sondern mit Taten. Die Entscheidung in der weltweiten Auseinandersetzung mit dem Kommunismus fällt nicht auf der Konsumfront, nicht in den Produktionsstatistiken allein, sondern sie fällt auf geistigem Gebiet.
Die Kirche, die selbst viele Jahrzehnte aus dem geistigen Leben der Hochschulen ausgeschaltet war, die Kirche, die für den Dialog eintritt, wird, wie überall, so auch auf den Hochschulen ein Gespräch nicht scheuen. Die Wahrheit wird immer stärker sein als jeder Versuch, sie zu manipulieren. Es geht auch hier um die Ordnung der Werte.
Aber auch das ist nicht der letzte Wert. Ich bin vor wenigen Tagen aus Indien zurückgekehrt, wo ich am Eucharistischen Weltkongreß teilgenommen habe. Es ist eine andere Welt, die sich dem Europäer dort auftut. Eine Welt, von der auch wir so manches lernen können. Nicht die wirtschaftliche Macht, nicht der politische Einfluß ist dort am höchsten geschätzt, auch nicht der Weise, der Gelehrte, sondern der Heilige. Jener, dessen Seele sich über die Welt erhebt und Verbindung mit dem Unendlichen sucht. Jeder Inder aber, sei er noch so hoch oder noch so niedrig, verwendet täglich einen Teil seiner Zeit zum Gebet, zur täglichen Sammlung, zur täglichen Besinnung. Sich zu sammeln, einzukehren bei sich, sich zu besinnen in der Hast der Tage auf die letzten Fragen des Daseins, Zwiesprache zu halten mit Gott, mit der Seele, das ist Gebet. Fehlt uns das nicht allen? Wir müssen wieder lernen, in uns selber stille zu sein, daß wir den Ruf Christi vernehmen: Kehrt um, denkt um, besinnt euch auf euer Eigentliches und Wesentliches.