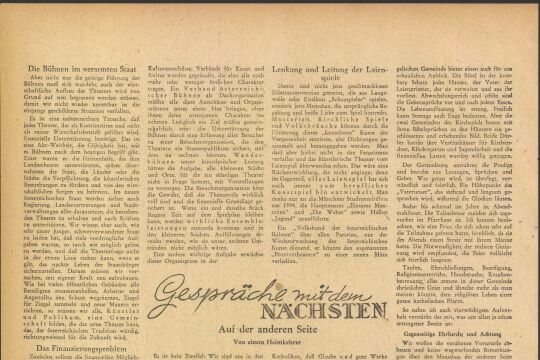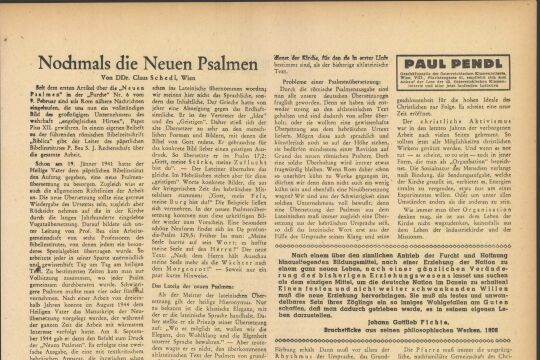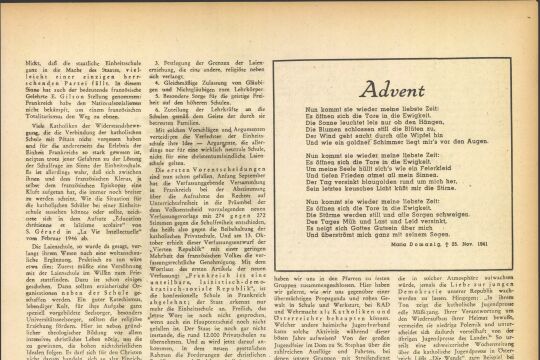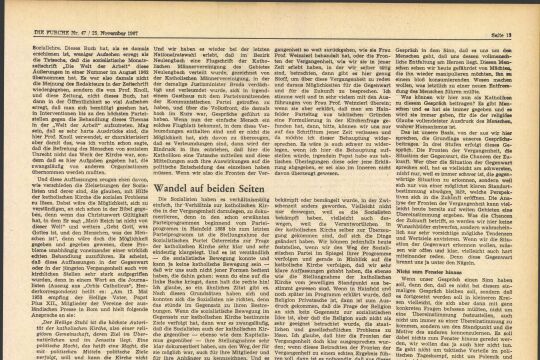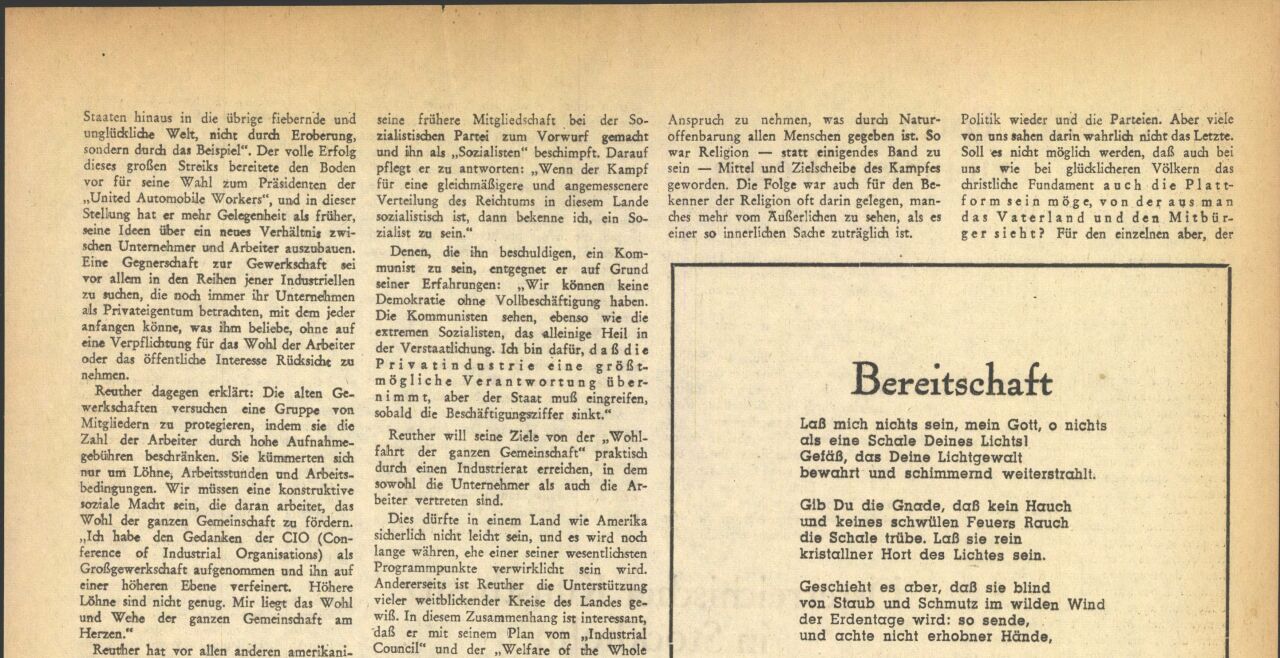
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die andere Seite
Der Aufsatz eines der jüngeren Generation angchörenden Sozialisten in Folge 22 der „Furche” „Von der Aufgabe des Laienchristen” hat eine Aufnahme gefunden, wie sie nicht allzuoft dem flüchtig erscheinenden Zeitungswort zuteil wird. Hier war ein feuriger Funken gefallen und hatte eine Flamme auf- schlagen lassen. Jede Post brachte Antworten auf den Zuruf des Verfassers, Zuschriften voll tiefer Ergriffenheit, missionarischer Bereitschaft, reuiger Bekenntnisse und auch des Zweifels. Menschen aus allen Kreisen österreichischer Bevölkerung sprachen aus diesen Briefen, Männer der Katholischen Aktion ebenso wie junge Sozialisten aus dem steirischen Kohlengrubengebiet. In Gemeinschaften wurde der Artikel diskutiert, Kanzelredner befaßten sich mit ihm. „Seien wir hellhörig für den Befehl”, hatte der Verfasser des Artikels geschrieben, „unser Christentum weiterzugeben, scheuen wir uns nicht, Uraltes in das Atomzeitalter zu übersetzen. Ein ehrliches Glaubenswort aus ehrlichem Herzen hat noch immer zu überzeugen vermocht. Gehen wir hinaus zu unserem Nachbar, wenn uns unsere Religion wirklich etwas bedeutet, ziehen wir aus mit Eifer, Takt und einfältiger Klugheit, es gibt viele, allzu viele, denen es so geht, wie cs mir ergangen ist, daß ich aus tausend Gründen zum Worte Gottes nicht gelangen konnte, und der tausendhundertste Grund war die Lauheit meiner christlichen Nachbarn. Wo bliebe denn unsere Liebe, wenn wir von unserem Schatz nicht austeilen wollten!”
Aus der Fülle der Antworten auf die aufrüttelnde Frage veröffentlichen wir heute die nachstehende, deren Autor ein der Jungmannschaft angehörender, i m öffentlichen Leben stehender Akademiker ist.
Das Gespräch wird fortgesetzt. „Die Furche”
In den dreißiger Jahren wurde in Wien das englische Stück „Journey’s End” gegeben. Bei uns hieß es „Die andere Seite” und wir sahen, daß es auch Menschen mit allen Freuden und Leiden waren, die auf der „anderen Seite” im Schützengraben lagen. Das gleiche fühlte der Christ, der in der „Furche” den Aufsatz „Von der Aufgabe des Laienchristen” las. Hier tut ein Sozialist der jüngeren Generation an die „Furche” seine christliche Meinung kund. Wie bei dem Kriegsstück wirkt der Aufsatz ein Doppeltes: einmal die Erkenntnis des Wahnsinns, daß man in hoffnungslosen Schlachten eines festgefahrenen Stellungskrieges sich ineinander verbiß. Dann aber das Gefühl der Freude, daß es nun weltanschaulich langsam Zeit wird, aus den Schützengräben herauszusteigen und zu erkennen, daß auch der andere drüben ein Mensch und — was, soviel mehr bedeutet — ein abendländischer Christ ist.
Die offene Darlegung der inneren Situation des Verfassers nötigt fast nun auch die Lage desjenigen zu zeichnen, der eben „auf der anderen Seite” stand.
Die Darstellung des jungen Sozialisten ruft uns die Situation der ersten Republik klar vor Augen, sie macht den Sinn für alles das klar, das damals unbewußt war und erst heute so richtig gedeutet werden kann. — Die Situation der ersten Republik war dadurch charakterisiert, daß sie gewissermaßen von der Ahnung der Katastrophe — die dann 1934 eintrat — überschattet war. Innerlich war man sozusagen psychologisch genötigt, dem anderen gram zu sein. Denn er trug — mehr oder weniger bewußt — eine dem Gegner provokatorisch erscheinende Uniform. Aufmärsche und Lieder schienen danach angetan, den Gegner herauszufordern, zuerst leidenschaftlich abzulehnen und dann mit anderen Vorzeichen und womöglich größerer Intensität dasselbe zu tun. Dieser Kriegszustand ließ alle Zusammengehörigkeit zurücktreten. Auch das christliche Fühlen und das christliche Bekenntnis war in diesen Konflikt hineingezogen. Auf der einen Seite grundsätzliche Ablehnung alles dessen, was von der Kirche kam. Auf der anderen Seite das Bestreben, auch das für sich als christliches Anrecht in Anspruch zu nehmen, was durch Naturoffenbarung allen Menschen gegeben ist. So war Religion — statt einigendes Band zu sein — Mittel und Zielscheibe des Kampfes geworden. Die Folge war auch für den Bekenner der Religion oft darin gelegen, manches mehr vom Äußerlichen zu sehen, als es einer so innerlichen Sache zuträglich ist.
Die Jahre 1934 bis 1938 brachten eine weitere Verschärfung dieses Gegensatzes. Trotz des Versuches der Kirche, sich von der Politik zurückzuziehen, war es damals doch wohl so, daß für jede mißliebige etwa offensive Maßnahme der Regierung letztlich irgendwie die Kirche und mit ihr die Religion verantwortlich gemacht wurden, schon weil in der Verfassung der christliche Staat besonders betont worden war. Während politisch gerade in jene Zeit die Tatsache fällt, daß erstmals wieder das Bekenntnis zu Österreich rein und vorbehaltlos ausgesprochen wurde, so ist doch damals wenig dazu geschehen, daß sich die Grundlage entwickeln konnte, auf der zuletzt jedes Gemeinwesen beruht, nämlich das gemeinsame Ruhen aller Staatsbürger auf einer über allen stehenden und allen Zweifeln entrückten weltanschaulichen Grundlage.
Das Jahr 1938 nahm jede äußere Sicherheit für denjenigen, der sich zu Österreich und darüber hinaus zum Christentum bekannte. Aber es hat eines gegeben: die Möglichkeit, fern allen Augenblicksnotwendigkeiten sich über all das klar zu werden, was man im Kampf und im Drange der Tagesgeschäfte in den vergangenen Jahren zuwenig überdenken und zuwenig in sich aufnehmen konnte. Der Weg wurde frei zumErkennen Österreichs und zum tieferen Verständnis dessen, was es heißt, ein Christ zu sein. Es begann das Suchen nach dem zeitlos Christlichen, das Ausscheiden alles dessen, was bloß geschichtlich geworden. Für diese Arbeit bot die Zeit, da es einen nicht lockte, Zeitungen zu lesen, und all das, was an großen Dingen angeblich die Welt bewegte, so fremd geworden war, die rechte Gelegenheit.
Wer Christ zu sein versuchte, den erfaßte mit Macht das Verstehen, daß es um eines ging: um den Aufbau des inneren Menschen. Und bezeichnenderweise trägt das Buch, in dem der Aufbau der Seelsorgearbeit im Kriege beschrieben wird, den Titel „Aufbau im Widerstand”. Also auch jetzt ein Widerstand gegen bisherige Mängel, Fehler, Vorurteile, Leidenschaften.
Dies setzte den Aufbau des Christlichen in uns allen voraus, einen wirklichen Wiederaufbau, in dem nach dem Satz „anima est forma corporis” das innere Sein des Menschen wieder Form werde für alles das, was er aufbaut. Und viele haben dies verstanden und nicht zuletzt die junge Generation hat es gelernt, im Gegenspieler von gestern den Menschen zu sehen, mit dem man letztlich „in einem Boot sitzt”.
Im Frühjahr 1945 gab es dann kein Theoretisieren mehr, sondern es hieß, sofort praktisch Hand anlegen. Nun kam die Politik wieder und die Parteien. Aber viele von uns sahen darin wahrlich nicht das Letzte. Soll es nicht möglich werden, daß auch bei uns wie bei glücklicheren Völkern das christliche Fundament auch die Plattform sein möge, von der aus man das Vaterland und den Mitbürger sieht? Für den einzelnen aber, der während des Krieges Christus und den Wahrheiten der Religion ein Stück nähergekommen ist, der ins öffentliche Leben trat und dort wirklich als Christ’ wirken will, ergab sich der Vorsatz, gewissermaßen ein Gelübde, sich mit aller Kraft vor der Versuchung zu hüten, das allein überzeugende Beispiel des christlichen Lebens und der christlich en Tat durch christlich klingende Worte zu ersetzen. Glaubt mein sozialistisches Gegenüber, der Verfasser des Artikels in Nr. 22 der „Furch e”, nicht, daß es mehr als auf die Anrede der noch Fernstehenden, den Beckehrungsversuch durch das wohlgemeinte Wort, auf dieses Beispiel ankommt, das jeder nach besten Kräften in seinem kleinen oder großen Bereiche geben soll?
Ich möchte ihm danken, daß er in mir und sicher in jedem anderen die Hoffnung auf eine nicht mehr ferne Zeit bestärkte, wo das christliche Bekenntnis über Parteiunterschiede hinweg als das selbstverständliche Gemeinsame gelten werde. Diese Hoffnung ist wie die Morgenröte eines neuen Tages. Dann wäre ein Zusammenarbeiten auch auf anderen Gebieten als dem der Politik möglich, eine Zusammenarbeit nicht nur von Gruppen, sondern von Persönlichkeiten, von Christen, die sich bemühen, das immer gültige Beispiel Christi im täglichen Leben zu verwirklichen. Diese Möglichkeit gibt uns auch die Hoffnung, daß der Wiederaufbau des inneren Menschen rascher vorwärtsschreiten könne, daß hier ein wirklicher Ansatzpunkt für di£ Demokratie gefunden wird. Dann könnte bei allen Gegensätzen, die immer bestehenbleiben werden, jene fairneß, jenes Vertrauen herrschen, das letztlich den Menschen zum Christen macht und allein fruchtbare politische Tätigkeit und Demokratie ermöglicht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!