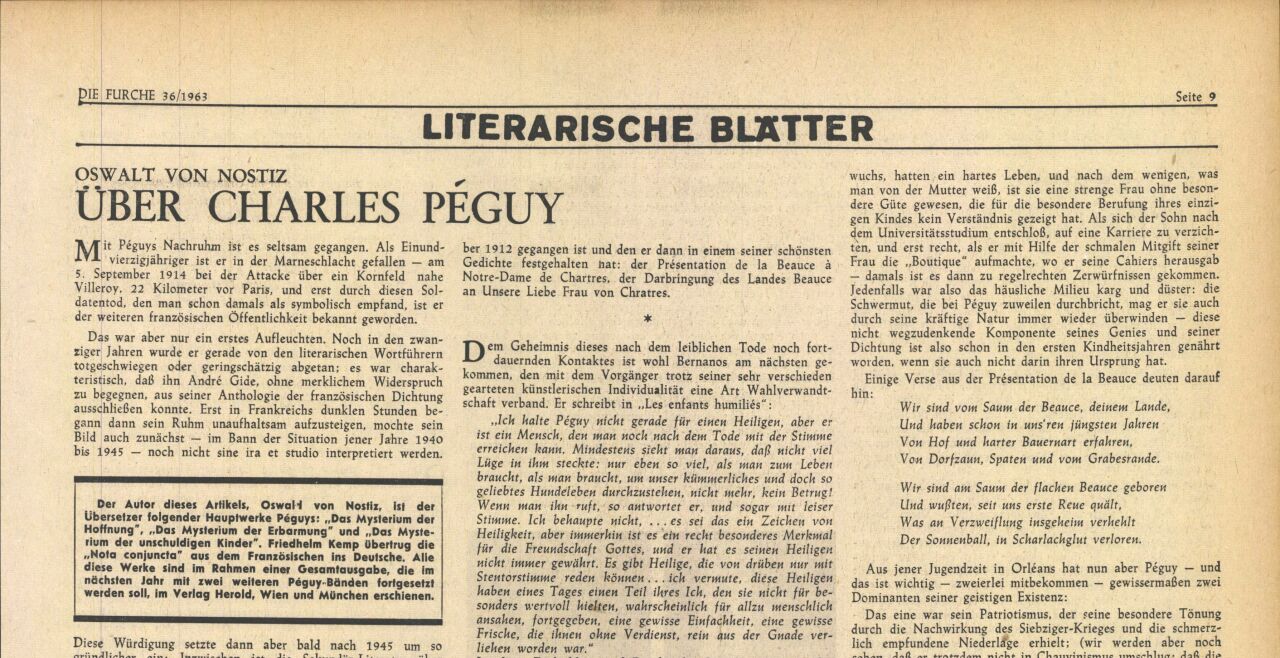
“VT it Pėguys Nachruhm ist es seltsam gegangen. Als Einund- 1Y1 vierzigjähriger ist er in der Marneschlacht gefallen — am 5. September 1914 bei der Attacke über ein Kornfeld nahe Villeroy, 22 Kilometer vor Paris, und erst durch diesen Soldatentod, den man schon damals als symbolisch empfand, ist er der weiteren französischen Öffentlichkeit bekannt geworden.
Das war aber nur ein erstes Aufleuchten. Noch in den zwanziger Jahren wurde er gerade von den literarischen Wortführern totgeschwiegen oder geringschätzig abgetan; es war charakteristisch, daß ihn Andre Gide, ohne merklichem Widerspruch zu begegnen, aus seiner Anthologie der französischen Dichtung ausschließen konnte. Erst in Frankreichs dunklen Stunden begann dann sein Ruhm unaufhaltsam aufzusteigen, mochte sein Bild auch zunächst — im Bann der Situation jener Jahre 1940 bis 1945 — noch nicht sine ira et Studio interpretiert werden.
Diese Würdigung setzte dann aber bald nach 1945 um so gründlicher ein: Inzwischen ist die Sekundär-Literatur über Pėguy gewaltig angeschwollen und schwillt noch weiter an: Um nur einiges zu nennen, gibt es die umfangreichen Werke von Romain Rolland, seinem Weggenossen, aber keinem objektiven Interpreten, von Andrė Rousseaux und von Jean de la Porte, die wichigsten Arbeiten von Albert Bėguin und Jean Onimus, als letztes ein äußerst hilfreiches, nicht sehr voluminöses Buch, das aber aus langjähriger Beschäftigung mit dem Gegenstand hervorgegangen ist und überdies die Akzente richtig setzt, so daß ich ihm manchen Hinweis zu verdanken habe: ich meine den „Pėguy” von Bernard Guyon, Editions Hattier. Pėguy hat aber noch andere Ehrungen erhalten: Einreihung des gesamten dichterischen Werkes und der wichtigsten Prosaschriften in die Plejade- bände, Benennung von Straßen und Schulen nach seinem Namen, Būstė in seinem Geburtsort Orleans, Aufnahme mancher seiner Wendungen in den allgemeinen Zitatenschatz und in die Reden prominenter Politiker, schließlich noch — ein wichtiges Indiz für die Aufnahme in den offiziellen Parnaß: Einreihung seiner „Mystėres” in die Prüfungstexte der Hochschulexamen. Pėguy ein Klassiker?
Er hat ich selbst einmal einen KlAsiker genannt, sogar einen Klassiker der- e steW’;iGfentWatJbij, ’der Generation der Corneille, Moliėre, Pascal, Bossuet (freilich geschah das — der Decor war gewahrt — in einem seinem Freund Lotte diktierten und unter einem Pseudonym veröffentlichten Artikel). Und er hatte wohl sogar recht damit. Trotzdem muß gerade diese Titulierung bei jedem, der sich näher mit Pėguy befaßt hat, eine gewisse Besorgnis erwecken. So hätte ihn also die Muse der Geschichte, der Historie, des Historismus: die alte Klio, mit der er in dem posthum erschienen Werk dieses Namens jenen denkwürdigen Dialog — das Gespräch zwischen der Geschichte und der äme charnelle, der „fleischlichen Seele” geführt hat. Klio hätte also den Dichter der Hoffnung, der Erneuerung, der Inkarnation schließlich doch in den Griff bekommen, ihn klassifiziert, mit einem Etikett versehen und eingesargt?
Nun ist das Werk Pėguys in der Tat in einem gewissen Sinne abseitig: In den knappen siebzehn Jahren, in denen er die Feder führte, hat es einen gewaltigen Umfang erreicht. Auch die drei gewichtigen Plejadebände enthalten es nicht vollständig. Seit 1900 erschien ja die Zeitschrift, der er seine ganze Existenz aufopferte, die er bis in die technischen und kommerziellen Einzelheiten hinein besorgte: die „Cahier de la Quinzaine”. Jahr für Jahr brachte sie mehrere, zum Teil bis zu zwanzig umfangreiche Bände heraus, von denen die meisten von Pėguy selber bestritten wurden. Abgesehen vom Jugendwerk — der ersten Jeanne d’Arę — handelte es sich fast nur um polemische und zeitkritische Schriften, die von irgendeinem damals aktuellen Thema ausgehen und Pėguy zu weitausgreifenden Betrachtungen anregten: zu Auseinandersetzungen mit den politischen, religiösen und sozialen Zeitströmungen. Es fällt nicht ganz leicht, die großen tragenden Themen aus ihrem zeitgebundenen Zusammenhang herauszulösen. Freilich gilt das nicht von der Dichtung, die im wesentlichen erst in den letzten fünf Lebensjahren neben die Prosa tritt. Hier ist es mehr ein formales Element, das den Zugang erschwert. Vielleicht sind die drei großen Mysterien mit ihren ungebundenen Rhythmen noch am eingängigsten, aber die „Tapisseries” und vollends „Eve” mit den Formationen der gebundenen Verse — diese Scharen von Alexandrinern, die Pėguy einmal mit Infanteriekolonnen vergleicht, welche die Strophen in kleinere Truppeneinheiten gliedern, diese „Architektur in Bewegung” verlangt schon, wenn sich ihr Zauber erschließen soll, die Überwindung innerer Hemmungen, die Anpassung an einen Rhythmus, der stark vom gehetzten Stakkato unseres heutigen Lebensstils abweicht.
Trotz solcher Hindernisse hat jedoch Pėguy das Wunder fertiggebracht, zu der nachfolgenden Generation — der Generation der Bernanos, Emanuel Mounier, Albert Bėguin einen unmittelbaren, nicht nur historisch-literarischen Kontakt herzustellen, und es hat den Anschein, daß dieses Fluidum auch heute noch nicht versiegt ist, ja, bei den Grenzen Frankreichs nicht haltmacht. Die von Auguste Martin begründete Amitiė Charles Pėguy hat — nicht nur durch ihre unersetzliche Dokumentation, ihre Bulletins und sonstigen Veröffentlichungen — zu einem Zusammenhalt der alten und neuen Pėguy-Freunde in aller Welt beigetragen, und ist es nicht auch ein erfreuliches Zeichen, daß nun seit 1945 alljährlich die Pariser katholischen Studenten — Franzosen und Nichtfranzosen — im Andenken an Pėguy nach Chartres pilgern; daß sie auch diese Pfingsten wieder zur Kathedrale der Beauce wallfahrten werden — im Andenken und in Nachfolge jenes Pilgerweges, den Pėguy im Juni und im September 1912 gegangen ist und den er dann in einem seiner schönsten Gedichte festgehalten iiat: der Presentation de la Beauce ä Notre-Dame de Chartres, der Darbringung des Landes Beauce an Unsere Liebe Frau von Chratres.
Dem Geheimnis dieses nach dem leiblichen Tode noch fortdauernden Kontaktes ist wohl Bernanos am nächsten gekommen, den mit dem Vorgänger trotz seiner sehr verschieden gearteten künstlerischen Individualität eine Art Wahlverwandtschaft verband. Er schreibt in „Les enfants humilies”:
„Ich halte Pėguy nicht gerade für einen Heiligen, aber er ist ein Mensch, den man noch nach dem Tode mit der Stimme erreichen kann. Mindestens sieht man daraus, daß nicht viel Lüge in ihm steckte: nur eben so viel, als man zum Leben braucht, als man braucht, um unser kümmerliches und doch so geliebtes Hundeleben durchzustehen, nicht mehr, kein Betrug! Wenn man ihn ruft, so antwortet er, und sogar mit leiser Stimme. Ich behaupte nicht,… es sei das ein Zeichen von Heiligkeit, aber immerhin ist es ein recht besonderes Merkmal für die Freundschaft Gottes, und er hat es seinen Heiligen nicht immer gewährt. Es gibt Heilige, die von drüben nur mit Stentorstimme reden können . . . ich vermute, diese Heiligen haben eines Tages einen Teil ihres Ich, den sie nicht für besonders wertvoll hielten, wahrscheinlich für allzu menschlich ansahen, fortgegeben, eine gewisse Einfachheit, eine gewisse Frische, die ihnen ohne Verdienst, rein aus der Gnade verliehen worden war.”
Ja, diese Einfachheit und Frische der Stimme ist etwas, das Pėguy vor fast allen seinen Zeitgenossen auszeichnet, selbst vor anderen Vertretern des „Renouveau Catholique”, trotz so vieler Gemeinsamkeiten — etwa vor einem Leon Bloy, bei dem manchmal das rhetorische Pathos des 19. Jahrhunderts zu spüren ist, sogar vor Claudel mit seinem feierlichen Orgelton.
Wie erklärt sich dieses Merkmal? Ganz offensichtlich hängt es mit seinen Ursprüngen zusammen: mit der Tatsache, daß Charles Pėguy — seit Franęois Villon ist mir kein zweiter solcher Fall bekannt —, daß Pėguy wirklich ein „fils du peuple” gewesen ist, daß er jenen Schichten entstammte, die nicht mit Schreibfeder und Papier, dafür aber umso besser mit Beil, Hacke, Spaten und Winzermesser umzugehen wußten. Denn seine Vorfahren waren Bauern und Winzer der Beauce; er selbst hat einmal gesagt: „Von den Winzern… knotig wie der Weinstock und fein wie die Reben, von jenen Frauen, die am Flußufer die Wäsche wuschen; von der Großmuter, welche die Kühe hütete und weder lesen noch schreiben konnte — von ihnen kommt mir alles, was ich bin.” Orleans war seine Geburtsstadt, dort ist er als Sohn einer früh verwitweten Stuhlflechterin aufgewachsen. Und in dieser Landstadt an der Loire hatte sich in den siebziger und achtziger Jahren — 1873 war sein Geburtsjahr — noch ein Stück altert Frankreichs behaupten können. Die kleinen Handwerker des Milieus seiner Kindheit waren noch unberührt von der Industrialisierung und ihren geistigen Folgen; sie lebten in den natürlichen Anschauungen ihrer bäuerlichen Vorväter. Diese ländlichen Kleinbürger verkörperten ihm „le bon peuple”, dem er sich zugehörig wußte: ein unverbildetes Wissen über die Grundfragen des menschlichen Daseins hat er von ihnen mitbekommen: „Das Volk”, schreibt er als Siebenundzwanzigjähriger in einer Betrachtung „Par moi”, „das Volk kennt Liebe, Geburt, Tod, Krankheit und Gesundheit, Eifersucht und Haß, Elend und Wohlhabenheit, Hitze und Kälte, Äcker und Gewässer, Straßen und Wälder, Tiere und Pflanzen; es nimmt teil am wunderbaren Wachstum der Kinder, am ausgleichenden Hinschwinden des Alten. Ich selbst habe in Orleans auf dem Verdeck der Pferdeomnibusse und in der Dritten Klasse das Beste von allem erfahren, was ich weiß.”
Es wäre nun freilich irrig, wenn man aus dem Ton solcher Rückerinnerungen schließen wollte, Pėguys Jugend sei ein reines Idyll gewesen. Mutter und Großmutter, bei denen er aufwuchs, hatten ein hartes Leben, und nach dem wenigen, was man von der Mutter weiß, ist sie eine strenge Frau ohne besondere Güte gewesen, die für die besondere Berufung ihres einzigen Kindes kein Verständnis gezeigt hat. Als sich der Sohn nach dem Universitätsstudium entschloß, auf eine Karriere zu verzichten, und erst recht, als er mit Hilfe der schmalen Mitgift seiner Frau die „Boutique” aufmachte, wo er seine Cahiers herausgab — damals ist es dann zu regelrechten Zerwürfnissen gekommen. Jedenfalls war also das häusliche Milieu karg und düster: die Schwermut, die bei Pėguy zuweilen durchbricht, mag er sie auch durch seine kräftige Natur immer wieder überwinden — diese nicht wegzudenkende Komponente seines Genies und seiner Dichtung ist also schon in den ersten Kindheitsjahren genährt worden, wenn sie auch nicht darin ihren Ursprung hat.
Einige Verse aus der Presentation de la Beauce deuten darauf hin:
Wir sind vom Saum der Beauce, deinem Lande,
Und haben schon in unsren jüngsten Jahren Von Hof und harter Bauernart erfahren,
Von Dorfzaun, Spaten und vom Grabesrande.
Wir sind am Saum der flachen Beauce geboren Und wußten, seit uns erste Reue quält,
Was an Verzweiflung insgeheim verhehlt Der Sonnenball, in Scharlachglut verloren.
Aus jener Jugendzeit in Orleans hat nun aber Pėguy — und das ist wichtig — zweierlei mitbekommen — gewissermaßen zwei Dominanten seiner geistigen Existenz:
Das eine war sein Patriotismus, der seine besondere Tönung durch die Nachwirkung des Siebziger-Krieges und die schmerzlich empfundene Niederlage erhielt; (wir werden aber noch sehen, daß er trotzdem nicht in Chauvinismus umschlug; daß die Nation trotz aller Vaterlandsliebe nicht den höchsten Rang in seiner Wertskala erhielt.) Die andere Dominante war sein Katholizismus: die religiöse Erziehung, durch die ihm die christlichen Wahrheiten gewissermaßen in Fleisch und Blut übergingen, auch wenn er das eine Zeitlang nicht wahrhaben wollte. Als junger begeisterter Sozialist hat er ja in „Toujours la Grippe” den ominösen Satz niedergeschrieben: „Die dreizehn oder vierzehn Jahrhunderte Christentum, das bei meinen Vorfahren Eingang gefunden hatte, die elf oder zwölf Jahre aufrichtig und getreulich empfangenen katholischen Unterrichts und mitunter auch katholischer Erziehung sind an mir vorübergegangen, ohne Spuren zu hinterlassen.”
Im September 1908 gesteht er seinem treuen Freund Lotte: „Ich habe Dir nicht alles gesagt… Ich habe den Glauben wiedergefunden… Ich bin Katholik!” Man hat die Unumschränkt- heit dieses Bekenntnisses angezweifelt und gemeint, auch den Christen Pėguy als einen halben Rebellen, einen Freischärler an- sehen zu müssen, namentlich unter Betonung des Umstandes, daß er bis an sein Lebensende — vielleicht mit Ausnahme der Messe von Mariä Himmelfahrt im August 1914, wenige Tage vor seinem Tod — den Sakramenten ferngeblieben ist. Aber mögen nun famįliąre Gründe hierfür bestimmend gewesen sein, mag er.wie manche Biographen meinen, aus einem Gefühl der Solidarität mit den Sündern und im Vertrauen auf die göttliche Gnade bfei der Herde der Gefährdeten haben ausharren wollen — keine der Äußerungen seiner letzten Jahre spricht jedenfalls dafür, daß ihm Glaubenserwägungen oder ein laizistisches Ressentiment irgendwelche Reserven auferlegten. Vor allem aber zeugt seine Dichtung für eine vorbehaltslose Glaubensverkündung. Diese Dichtung entsteht nun wie unter einem inneren Auftrag: „Man muß schöpferisch sein, nicht demonstrieren und erklären”, sagt er einmal, „Pascal begründet zuviel, ich erschaffe…” So macht er sich ans Werk wie ein Getriebener, wohl unter dem Druck de Vorgefühls, daß ihm nur noch eine kurze Lebensspanne vergönnt ist: „Die Hand muß unter dem Kopf laufen, die Feder muß unter der Hand laufen, wie das Pferd, das man zu Tode reitet.. . Was er dann hinterläßt, als ihm der Krieg die Feder aus der Hand nimmt, ist leibgewordene, als Bild und Gleichnis ohne Verflachung im irdischen Stoff eingefangene „verdichtete” Theologie. — Selbst Claudel und Bernanos nicht ausgenommen, gibt es in unserer Zeit wohl kein zweites Beispiel für eine so reine Kongruenz zwischen gelebtem Christentum und Dichtung. Jedes die ser Werke schlägt ein großes Glaubensthema an, bis dann das kosmische Heilsepos „Eve” über die einzelnen Pfeiler sein Gewölbe spannt.
A ls erstes nimmt er das Jeanne-d’Arc-Drama wieder auf; so entsteht das „Mysterium der Erbarmung” (der Jeanne d’Arc), das keine dramatischen Geschehnisse mehr kennt, sondern als äußeren Rahmen jenes Gespräch beibehält, das die junge Jeanette mit ihrer Freundin Hauviette und sodann mit der Klosterfrau, Mutter Gervaise, die gewissermaßen die Kirche verkörpert. an einem Sommermorgen des Jahres 1425 in der bur- gundischen Landschaft führt. Es ist das gleiche Gespräch, das schon das Jugenddrama einleitete, das aber nun weitergesponnen wird und durch dichterische Meditationen und Monologe einen ganz anderen Akzent erhalten hat.
Hoffnung ist das große Thema der nun folgenden, ganz in freien Rhythmen geschriebenen Mysterien, „Le Porche du Mystėre de la deuxieme Vertu” — wörtlich: die Vorhalle zum Mysterium der zweiten Tugend, d. h. der zweiten theologischen Tugend: der Hoffnung; wir haben es daher in der deutschen Ausgabe „Das Mysterium der Hoffnung” genannt, und daran anschließend das „Mystėre des Saints Innocents”, das „Mysterium der Unschuldigen Kinder”.
Mutter Gervaise tritt nunmehr als alleinige Sprecherin auf, in Wahrheit ist es aber Pėguy selbst, der sich durch sie zu Wort meldet und mit Gottvater Zwiesprache hält: Diese beiden Mysterien zeichnen sich durch einen noch persönlicheren Ton aus als das erste. Zweifellos hängt das mit der inneren Krise zusammen, die Pėguy in diesen Jahren 1910 und 1912 durchmachte, in der so vieles auf ihn einstürmte: das Zerwürfnis mit nahen Freunden, das Ausbleiben einer Resonanz, wodurch er sich immer einsamer fühlte, finanzielle Nöte, Familiensorgen, Krankheiten der Kinder, vor allem aber ein leidenschaftliches Erlebnis, über das sich die Betreuer seines Nachlasses tunlichst ausgeschwiegen haben, so daß man nur Wenige Einzelheiten kennt.
Pėguy hat früh geheiratet, aber es war weder eine Liebes- noch eine Geldheirat, sondern gewissermaßen — was für ihn sehr bezeichnend ist — ein Akt der Loyalität. Seine Frau war die Schwester eines früh verstorbenen Freundes, Marcel Baudouin, mit dem er in seiner sozialistischen Zeit ein Herz und eine Seele war; gemeinsam mit ihm hatte er die erste Jeanne d’Arc begonnen und sie dann nach dem Tode seines Freundes allein zu Ende geführt. Madame Pėguy entstammte also einem laizistischen, ja ausgesprochen unkirchlichen Milieu; das ging so weit, daß die Kinder nicht getauft wurden. Als sich Pėguy dann wieder der Kirche zuwandte, kam es naturgemäß zu Auseinandersetzungen. Etwa zur gleichen Zeit spann sich eine Freundschaft an zwischen Pėguy und der Schwester eines seiner Mitarbeiter — eine Beziehung, die so intensiv war, daß sie sich nicht auf kleiner Flamme halten ließ. Im Jahre 1910 wurde er sich plötzlich der Gefahr bewußt, die damit drohte; er sorgte daher dafür, daß das Mädchen einen gemeinsamen Freund heiratete. Aber das Drama war damit nicht zu Ende Im Dezember 1911 schreibt er einem Freunde: „Das ganze Terrain, das ich gewonnen zu haben meinte, habe ich wieder verloren! Ich bin in einem Zustand, daß ich die Fäuste zusammenpressen mußte, um nicht einen gewissen Namen in eine Baumrinde einzuritzen. Seit drei Wochen habe icFnlcKFmlETgeBetet. Es” gib’nm”FaTef”Nostfer diesen schreck liehen Satz: ,Dein Wille geschehe!” Den Satz bringe ich nicht über die Lippen . ..”
Mitten in dieser Krise, die ihn bis ins Innerste aufwühlte, arbeitete er an den Mysterien. Er zwang sich also mit ihnen etwas ab, was er selbst noch nicht besaß, worin er sich aber aufzurichten hoffte: gewissermaßen als Seelenarznei. Die Hoffnung, die er beschwor, stellte er nicht nur der schwülen und beklommenen Zeit entgegen, der kaum erträglichen Spannung jener Vorkriegsjahre; sie war zugleich und vor allem sein letztes Aufgebot gegen die „Sünde Verzweiflung”, von der er im Mysterium der Hoffnung spricht. Um so erstaunlicher ist die Frische und Beschwingtheit der „petite fille Espėrance”, des „kleinen Mädchens Hoffnung”, welches die Menschen mit ihrem Spiel auf dem Kreuzweg geleitet, und der die entscheidende Rolle bei der Überwindung einer alternden, erstarrenden Welt zukommt.
An dieser Gestalt zeigt sich besonders deutlich, wie Pėguy — ohne den Boden des christlichen Dogmas zu verlassen — schöpferisch wurde. Seine Hoffnung bleibt die christliche Tugend des Katechismus und ist doch zugleich eine kleine Revolutionärin, die die Bergsonsche Abstammung nicht verleugnet; sie beschränkt sich nicht auf einen abgezirkelten Platz in der Hierarchie der Tugenden, sondern wird zum entscheidenden Lebensgrundgefühl, das alles durchdringt und sogar Gott nicht fremd ist. Man fühlt sich an das Gedankengut deutscher Mystiker, an einen Angelus Silesius erinnert, w’enn der Dichter auf die Abhängigkeit zu sprechen kommt, in die sich Gott begeben hat: wie jeder Liebende ist ja auch er an das geliebte Wesen gebunden und aus dieser liebenden Abhängigkeit erwächst seine Hoffnung, die selbst den ärgsten und niedrigsten Sünder mitumfaßt: in dessen Hand ist es somit gelegt, eine Hoffnung Gottes zu erfüllen oder zu Schanden zu machen.
Man schließt jedoch nicht aus dieser Exegese — wie sie Pėguy selber in seiner letzten, der Verteidigung Bergsons gewidmeten Schrift „Note Conjointe” vorgenommen hat —, es handle sich bei diesen Mysterien um verkappte philosophische Traktate. Sie sind eben deshalb echte Dichtung, weil es ihr Schöpfer vermochte, seine Bilder und Gleichnisse zu weit mehr als zu einer dürren Allegorie zu machen, ihnen die Züge der höheren Wirklichkeit zu verleihen, wie sie das Symbol kennzeichnet. Vor allem eignet ihnen jene Quellfrische, jene „Einfalt”, die Pėguy von seinem Ursprung, seinen Jugendjahren her ungebrochen bewahrte. So geht die junge Hoffnung zwischen Glaube und Liebe, ihren großen Schwestern, in der Fronleichnamsprozession, wie sie der Knabe in Orleans erlebte; so halten Holzfäller, Gärtner und Winzer mit Gottvater vertraute Zwiesprache. Der Dichter vermag aber auch mächtige Akkorde anzuschlagen. Etwa in jenem Lobgesang auf die Nacht, die Christi Leichnam umhüllt, mit dem das „Mysterium der Hoffnung” schließt, oder in den Meditationen über die von Christus geführten und Gott entgegenstrebenden Flotten der Gebete im „Mysterium der Unschuldigen Kinder”.
In seiner harten Arbeit”, sagt Pėguy einmal, „hat der Schreibende teil an der Schöpfungsordnung… seine Sendung besteht darin, die gesamte lebendige Wirklichkeit auszudrücken; durch ihn wird der Geist im Zeitlichen eingezeichnet. Das zeigt schon die Prosa, zeigen dann die freien Rhythmen, die der Wirklichkeit noch näher kommen und den Leser durch unerwartete Pausen zum Nachdenken zwingen sollen — Pausen, wie sie Peguy, der sich ja um alle Einzelheiten der _ Drucklegung kümmerte, durch reichliche „Blancs”, leere Zwischenräume auf den Seiten seiner Cahiers, anzudeuten pflegte. Unversehens beginnen dann diese Rhythmen zu „singen”. Immer aber ist es ein großes Wogen: Wir sehen ein Motiv, schon wird es von der nächsten Welle aufgenommen, sodann — immer ein wenig verwandelt — von der nächsten und so fort, zuweilen in endlos scheinender Reihe: dabei taucht ein neues Schlüsselwort auf, das ein neues Thema ankündigt; doch dieses verschwindet wieder, zeigt sich erst abermals nach mehreren Wellenschlägen, um sich später — lange nach der eigentlichen thematischen Durchführung — noch einmal wie eine kurze Erinnerung zu melden. So entsteht ein Ineinanderspiel, eine kontrapunktische Stimmführung, die an große Fugen denken läßt. Dabei hat dieser eigenartige Rhythmus nichts Künstliches, er ist wie eine Naturkraft.
Jenes leidenschaftliche Liebeserlebnis, der Kampf zwischen Verlangen und Gewissensqual, übermächtigem Gefühl und dem, was Peguy „Ehre” nennt —, alles das steht zwar im Hintergrund der Mysterien, wird aber in ihnen niemals direkt ausgesprochen. Nach der Beschwörung der Hoffnung, die er noch nicht besaß, aber herbeisehnte, bedurfte Peguy daher eines unmittelbaren Ventils; zugleich wollte er durch eine Art Gewissenserforschung zu innerer Klarheit gelangen und metaphorisch, unter dem selbstgewählten Zwang einer strengen und disziplinierten äußeren Form, das ausdrücken, was er als Geheimnis mit sich umhertrug. So entsteht die Folge der „Quatrains”, der kurzen Vierzeiler mit abwechselnd vier- und sechssilbigen Versen und in der Regel gekreuzten Reimen, insgesamt 1104 Strophen, die in immer neuen Abwandlungen das Martyrium seines Herzens besingen. Friedhelm Kemp hat eine Auswahl kongenial übersetzt, die in unseren zur Zeit vorbereiteten Pėguy-Band aufgenommen werden wird.
„Herz, das soviel geschlagen,
Innen in Dir,
Laß dich nun fragen,
Sag mir, wofür?”
Damit kündigt sich bereits das seelische Klima der „Tapisseries” an, die ebenfalls dem Ton der Litanei angeglichen sind, wenn auch die Form noch klassischer und rigoroser ist, jedenfalls im ersten Teil, der aus Sonetten in Alexandrinern mit einer auf nur zwei Endungen „ine” und „ort” reduzierten Reimfolge besteht. Die Thematik hat zunächst einen objektiveren Inhalt: Sie kreist um Sainte Genevieve, die Schutzheilige von Paris, und um Jeanne d’Arc, sodann um die Darbringung der Stadt Paris an Notre Dame. Es folgt jenes Meisterstück „Die Darbringung des Landes Beauce an Unsere Frau von Chartres”, in dem Peguy, ohne ins Anekdotische zu verfallen, aber nun auch in der Form gelöster, seinen Pilgergang nach Chartres wiedergibt: Die Alexandriner, die leider im Deutschen steif und unnatürlich wirken, weshalb ich für die Übersetzung das uns vertrautere Versmaß der fünffüßigen Jamben gewählt habe —, diese jedoch dem Französischen so homogenen Alexandriner skandieren gewissermaßen den ausgewogenen und gleichmäßigen Pilgerschritt. Die Wirklichkeit ist nicht vergessen: die Straße, das Freundeshaus, in dem die Pilger rasten, die flache Ebene, aus der auf einmal „la flėche”, der Turm der Kathedrale aufsteigt, schließlich dann die Betrachtung des Domes aus dem Wirtshausfenster am Abend. Aber diese Wirklichkeit ist übertönt durch die Meditationen, die nicht mehr das Gejagte der Quatrains haben, sondern Ruhe und Sammlung ausdrücken. Und nach dem Bittgebet für einen jungen Verstorbenen folgen dann jene Schlußstrophen über die Sterbe-
stunde, aus denen zwar Trauer, aber eine Trauer voller Ergebung und Hoffnung spricht:
„Wenn sie uns betteten im Grabesschoße,
Wenn nach der Messe unser Sarg sich senkte,
Denk, Königin, die uns Verheißung schenkte,
Der langen Wanderschaft im Lande Beauce.
Wenn Strick wir abgestreift und Pilgerkleid,
Wenn uns das letzte Zittern übermannte.
Wenn unser Mund den letzten Seufzer sandte,
Gedenke unser in Barmherzigkeit.
Zuflucht der Sünder, nur um eins wir flehen:
Wollst uns den letzten Platz der Büßer schenken,
Daß wir in Tränen unser Los bedenken Und deinen jungen Glanz von ferne sehen.”
Die „Eve”, dieses gewaltige Epos der Heilsgeschichte der Menschheit, in der der Dichter in einer durchlaufenden Folge von 1911 vierzeiligen Alexandrinern Jesus zu Eva, der Urmutter der Menschheit, sprechen läßt — dieser fugenlose Block, „ein mächtiger Tetraeder” nach dem Worte Romain Rollands, ist gewiß keine leichte Kost für den Leser Dies um so mehr, als der Dichter auf jede romantische Abschweifung, auf alles anekdotische Beiwerk und historische Kolorit verzichtet hat —, verzichtet hat zugunsten einer ununterbrochenen Kontemplation, die freilich in ihren Höhepunkten von größter Bildhaftigkeit, ja visionärer Gewalt ist. Diese „austeritė” und zugleich die Klarheit und Strenge der dichterischen Diktion — von der er selbst gesagt hat, zwanzig Jahre redlicher Prosa seien hierfür seine Schule gewesen —, das Verschmähen aller verschwommenen Clair-Obscur-Effekte, allen rhetorischen Bombastes unterscheidet ihn von Viktor Hugo, dem einzigen, der in der französischen Literatur — namentlich in der Legende des Sciėcles — entfernt Vergleichbares versucht hat.
Pėguy verfügt ja über eine seltene Doppelbegabung: Er ist Dichter, und als solcher eignen ihm Intuition und Phantasie sowie Sinn für die konkrete Realität — das ist der Aspekt, den wir vor allem betrachtet haben; zugleich aber besitzt er Abstraktionsvermögen, ist ein kritischer und analytischer Geist mit der ganz ungewöhnlichen Fähigkeit, daß er diese Gabe auf sein eigenes Werk anwenden kann. So hat er seine „Eve” selbst interpretiert in jenem eingangs erwähnten Artikel, in dem er sich selbst einen Klassiker nennt: sein Freund Lotte veröffentlichte ihn dann unter dem Pseudonym Durei. Erstaunlicherweise haben alle späteren Exegesen der „Eve” diese Eigendeutung zwar detaillieren, aber nicht eigentlich erweitern können. Pėguy-Durel bemerkt unter anderem, vor allem gehe es dem Dichter der „Eve” — statt um spektakuläre Moritaten, romantische Effekte und Literatur — um das eigentliche Leben, um den grauen Alltag, um „dich und mich”. Und Eva sei für ihn eine alte Frau, „die viele ihrer Kinder begraben hat. Und die Feuer machen muß, wenn es kalt ist”‘.1 Was’tfber !dėn Atttor. „Denn die Sünder, das ist er. In dieser unendlichen Schar ist er mitten darin. Nicht daneben. Das ganze Werk ist sozusagen auf den Menschen ausgerichtet und vollzieht sich im Angesichte des Jüngsten Gerichtes.”
T’Vamit sind nur die Umrisse des Werkes angedeutet. Sie aus- zufüllen, ist im Rahmen dieser Betrachtung nicht möglich. Nur einen Punkt muß ich noch’herausgreifen: das Verhältnis des Dichters zu seiner Nation. Ich deutete eingangs an, daß Pėguys Patriotismus ihm von Jugend auf mitgegeben war. Sein Nationalgefühl, das ja auch in der Jeanne d’Arc, in den Mysterien immer wieder durchklingt, hatte jedoch etwas Naives oder, besser gesagt, Unschuldiges; es fehlte ihm jedenfalls jene Schärfe, von der der blutrünstige Preußenhasser Leon Bloy nicht ganz freizusprechen ist. Und in der „Eve” wird dann ganz deutlich, daß Pėguy auch die Nation dem göttlichen Heilsplan ein- und untergeordnet sieht, daß sie ihm nur Leib und Gleichnis des Ewigen darstellt. Etwa in der Mitte des Epos stehen — durch Gedankenstriche hervorgehoben — die berühmten und vielzitierten Seligpreisungen der für ihr Land Gefallenen. Es findet sich jedoch darin die Einschränkung des „bellum justum” — „sofern sie im gerechten Krieg gefallen”. „Pourvu que ce fut dans une juste guerre.” Und es heißt auch: „Selig, die so für ihre Stadt gelitten. Sie haben teil an Gottes Stadt und Stamme”, und „Denn jene sind der Anfang, sind das Bild von Gottes Haus, der Leib und Konturen. ..” Schon damit erhält Pėguys Patriotismus den ihm gebührenden Platz. „Eve” enthält aber noch andere, weniger bekannte, aber ebenso maßgebliche Verse, in denen der Zweifel zum Ausdruck kommt, ob man sich denn in alle Ewigkeit für einen Zipfel Erde schlagen solle, ja etwas ausgesprochen wird, das wir nach 1945 mit weit größerem Verständnis aufneh- men oder aufnehmen sollten als Pėguys Zeitgenossen. — Ich glaube, man muß sich dieses ganze dichterische Vermächtnis vor Augen halten, um Pėguys Auszug ins Feld, den er dann mit seinem Soldatentod besiegelte, im rechten Licht zu sehen.
Zum Schluß noch ein kurzes Wort zur dichterischen Potenz der „Eve”. Sie ist — das sollte man offen zugeben — nicht gleichmäßig. Bei manchen Passagen hat man fast den Eindruck, daß das Reimlexikon, das Pėguy als Hilfsmittel verwandte, hier mehr dominiert als seine Gestaltungskraft. An anderen Stellen ist indessen die dichterische Substanz unverkennbar. Vielleicht sind es die reinsten und zartesten Verse, die er geschrieben hat, in denen er schildert, wie er mit Ochs und Esel vor dem schlafenden Kinde steht und im Bilde des kindlichen Blutes, das unter der frischen und durchsichtigen Haut pocht, die Jugend des Erlösers und durch Ihn der ganzen Schöpfung erfährt. Und vpr allem in den Versen über die Auferstehung der Toten scheinen mir Pėguys dichterische Gaben einen besonderen Ausdruck zu finden: seine visionäre Gewalt, zugleich aber auch seine Frische und Einfalt, ja sein Humor, von dem Pėguy-Durel sagt, er hebe sich vom Grunde einer unbesieglichen Schwermut ab.
Aus einem Vortrag, den der Autor auf Einladung des Wiener Französischen Kulturinstitutes im Palais Lobkowitz gehalten h t.




































































































