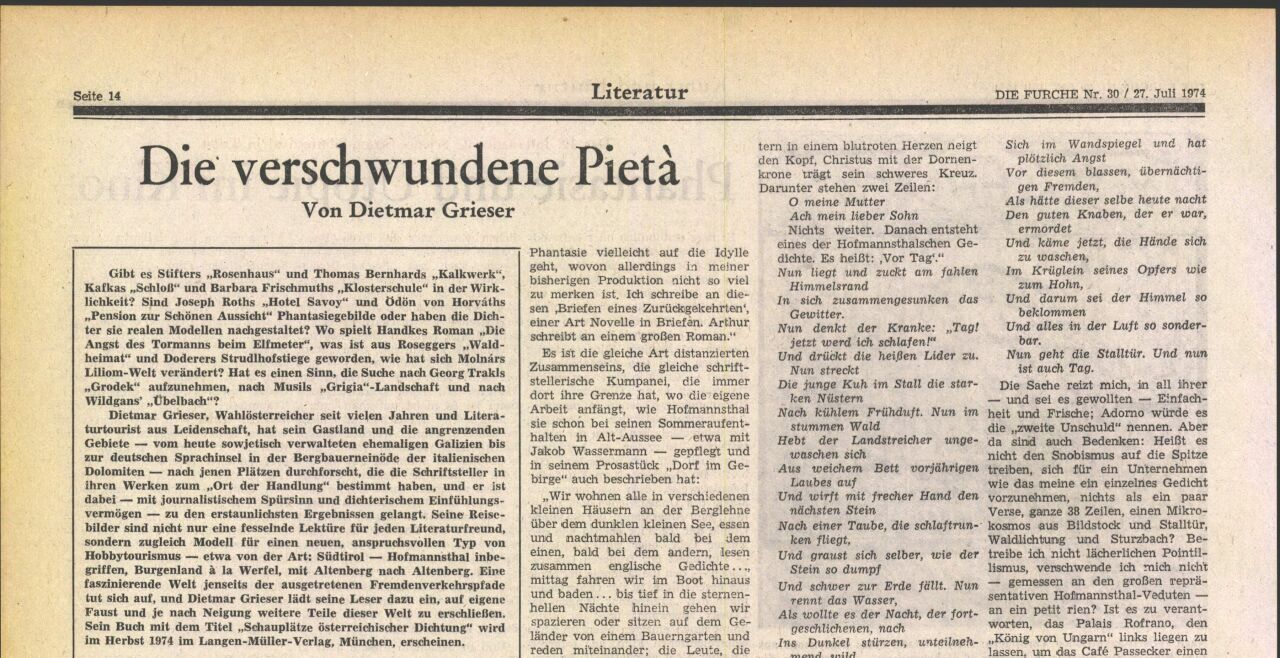
Die verschwundene Pieta
Gibt es Stifters „Rosenhaus“ und Thomas Bernhards „Kalkwerk“, Kafkas „Schloß“ und Barbara Frischmuths „Klosterschulc“ in der Wirklichkeit? Sind Joseph Roths „Hotel Savoy“ und ödön von Horväths „Pension zur Schönen Aussicht“ Phantasiegebilde oder haben die Dichter sie realen Modellen nachgestaltet? Wo spielt Handkes Roman „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“, was ist aus Roseggers ..Wahlheimat“ und Doderers Strudlhofstiege geworden, wie hat sich Molnärs Liliom-Welt verändert? Hat es einen Sinn, die Suche nach Georg Trakts „Grodek“ aufzunehmen, nach Musils „Grigia“-Landschaft und nach Wildgans' „Übelbach“? Dietmar Grieser, Wahlösterreicher seit vielen Jahren und Literaturtourist aus Leidenschaft, hat sein Gastland und die angrenzenden Gebiete — vom heute sowjetisch verwalteten ehemaligen Galizien bis zur deutschen Sprachinsel in der Bergbauerneinöde der italienischen Dolomiten — nach jenen Plätzen durchforscht, die die Schriftsteller in ihren Werken zum „Ort der Handlung“ bestimmt haben, und er ist dabei — mit journalistischem Spürsinn und dichterischem Einfühlungsvermögen — zu den erstaunlichsten Ergebnissen gelangt. Seine Reisebilder sind nicht nur eine fesselnde Lektüre für jeden Literaturfreund, sondern zugleich Modell für einen neuen, anspruchsvollen Typ von Hobbytourismus — etwa von der Art: Südtirol — Hofmannsthal inbegriffen, Burgenland ä la Werfel, mit Altenberg nach Altenberg. Eine faszinierende Welt jenseits der ausgetretenen Fremdenverkehrspfade tut sich auf, und Dietmar Grieser lädt seine Leser dazu ein, auf eigene Faust und je nach Neigung weitere Teile dieser Welt zu erschließen. Sein Buch mit dem Titel „Schauplätze österreichischer Dichtung“ wird im Herbst 1974 im Langen-Müller-Verlag, München, erscheinen.
Gibt es Stifters „Rosenhaus“ und Thomas Bernhards „Kalkwerk“, Kafkas „Schloß“ und Barbara Frischmuths „Klosterschulc“ in der Wirklichkeit? Sind Joseph Roths „Hotel Savoy“ und ödön von Horväths „Pension zur Schönen Aussicht“ Phantasiegebilde oder haben die Dichter sie realen Modellen nachgestaltet? Wo spielt Handkes Roman „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“, was ist aus Roseggers ..Wahlheimat“ und Doderers Strudlhofstiege geworden, wie hat sich Molnärs Liliom-Welt verändert? Hat es einen Sinn, die Suche nach Georg Trakts „Grodek“ aufzunehmen, nach Musils „Grigia“-Landschaft und nach Wildgans' „Übelbach“? Dietmar Grieser, Wahlösterreicher seit vielen Jahren und Literaturtourist aus Leidenschaft, hat sein Gastland und die angrenzenden Gebiete — vom heute sowjetisch verwalteten ehemaligen Galizien bis zur deutschen Sprachinsel in der Bergbauerneinöde der italienischen Dolomiten — nach jenen Plätzen durchforscht, die die Schriftsteller in ihren Werken zum „Ort der Handlung“ bestimmt haben, und er ist dabei — mit journalistischem Spürsinn und dichterischem Einfühlungsvermögen — zu den erstaunlichsten Ergebnissen gelangt. Seine Reisebilder sind nicht nur eine fesselnde Lektüre für jeden Literaturfreund, sondern zugleich Modell für einen neuen, anspruchsvollen Typ von Hobbytourismus — etwa von der Art: Südtirol — Hofmannsthal inbegriffen, Burgenland ä la Werfel, mit Altenberg nach Altenberg. Eine faszinierende Welt jenseits der ausgetretenen Fremdenverkehrspfade tut sich auf, und Dietmar Grieser lädt seine Leser dazu ein, auf eigene Faust und je nach Neigung weitere Teile dieser Welt zu erschließen. Sein Buch mit dem Titel „Schauplätze österreichischer Dichtung“ wird im Herbst 1974 im Langen-Müller-Verlag, München, erscheinen.
Wien 1907. Sechs Jahre sind sie miteinander verheiratet: Hugo von Hofmannsthal und die Bankierstochter Gerty Schlesinger; drei Kinder sind da. Im Fuchsschlößl zu Rodaun geben sich die illustren Kollegen die Türklinke in die Hand: Rudolf Borchardt, Rudolf Alexander Schröder, Rudolf Kassner, Harry Graf Keßler, Gerhart Hauptmann; bald wird auch Rilke seine Aufwartung machen. Schnitzler, zwölf Jahre älter als der Hausherr, zählt zum täglichen Umgang. Um die Mitte des Jahres kommt man überein, einander in der Sommerfrische zu treffen. Die Hofmannsthals fahren zunächst für zwei Wochen an den Lido, anschließend nach Cortina. Arthur Schnitzler und Frau Olga, weniger mondän, nähern sich ihrem Ferien-' domizil von Kärnten her. Man hat sich noch nicht entschieden:
„Morgen fahren wir nach Villach; von dort aus wollen wir uns umsehen, ob wir irgendwas (Veldes, Wochein? oder sonstwo), wenn's gut geht, zu längerem Aufenthalt finden. Den Buben lassen wir erst nachkommen, wenn wir wissen, wo unseres Bleibens. Der Roman, den ich nun tüchtig durchfeile, zum großen Teil natürlich neu schreibe, zieht mit.“
Man landet schließlich in Welsberg, im oberen Pustertal. Seitdem der propere Garnisonsort an der Strecke Marburg—Franzensfeste Schnellzugstation der k. k. privilegierten Südbahn ist und das Badhotel Waldbrunn, gleich überm Bahnhof, die besten Familien aus Bozen und Brixen, ja sogar Mitglieder das Kaiserhauses zu Gast hat, gilt Welsberg als chic. Der vom Verschönerungsverein herausgegebene Ortsführer kann ale Trümpfe ausspielen, die den bäuerlichen Marktflecken zur komfortablen Sommerfrische erheben: Fremdenwohnungen mit Magdkammer, Glasveranden mit Dolomitenblick, .Hochdruckwasserleitung von besonderer Güte' und, davon profitierend, .englisches Klosett'. Das 1906 in Betrieb genommene Elektrizitätswerk L. Patz & Co. versorgt die Straßen und Plätze mit Licht, welches auch in allen Gasthöfen und in den meisten Sommerwohnungen eingeführt ist.“
Arthur und Olga Schnitzler nehmen für sieben Wochen in Welsberg Quartier; Hofmannsthal, der kurz vor der Abreise in die Ferien noch an den Freund geschrieben hat, er empfinde es „sehr schmerzlich, wie selten man sich sieht“, stößt für zehn Tage dazu. Eigentlich ist bloß daran gedacht, auf der Rückreise nach Wien in Welsberg zu nächtigen, aber die Schönheit des Ortes und eine plötzlich ausbrechende „wahre fieberhafte Heftigkeit des Arbeitenmüssens, eine fast quälende Lust, sowohl zu schreiben als Künftiges zu notieren — eine von den jähen, doch sehr schönen Zeiten, die alle paar Jahre einmal kommen“, halten den Dichter „von Tag zu Tag weiter“ in Südtirol fest. In Briefen an den Vater drückt sich aus, wie gut dem Dreiunddreißigjälirigen dieses Welsberg bekommt:
„Liebster Papa, heute wieder strahlender Tag. Bin überschwemmt von Einfällen ... sehr glücklich und zufrieden, Gerty ebenso. 5 bis 8 machen wir immer schöne Spaziergänge, auch kleine Ausflüge mit der Eisenbahn. Gestern Bruneck.“
Oder, am 17. Juli:
„Liebster Papa, über die hiesige improvisierte Verlängerung unseres Aufenthaltes wundere ich mich mich selbst, aber ich freue mich darüber, denn so schön und inhaltsreich mein Leben ja ist, so ist es vielleicht im allgemeinen etwas zu sehr geordnet und vorausbestimmt und zu wenig improvisiert. Auch Gerty ist, seit sie daraufgekommen ist, Kapellen, Bauernhäuser usw. in Aquarell zu malen (früher fehlte ihr die Technik für kleine Bilder) ganz versessen darauf und infolgedessen nicht allzu ungeduldig, zu den Kindern zurückzukommen ... Für mich ist die Landschaft mit Dörfern etwas unerschöpflich Reizendes, wie ja überhaupt die stärkere Hälfte meiner Phantasie vielleicht auf die Idylle geht, wovon allerdings in meiner bisherigen Produktion nicht so viel zu merken ist. Ich schreibe an diesen .Briefen eines Zurückgekehrten', einer Art Novelle in Briefen. Arthur schreibt an einem großen Roman.“
Es ist die gleiche Art distanzierten Zusammenseins, die gleiche schriftstellerische Kumpanei, die immer dort ihre Grenze hat, wo die eigene Arbeit anfängt, wie Hofmannsthal sie schon bei seinen Sommeraufenthalten in Alt-Aussee — etwa mit Jakob Wassermann — gepflegt und in seinem Prosastück „Dorf im Gebirge“ auch beschrieben hat:
„Wir wohnen alle in verschiedenen kleinen Häusern an der Berglehne über dem dunklen kleinen See, essen und nachtmahlen bald bei dem einen, bald bei dem andern, lesen zusammen englische Gedichte ..., mittag fahren wir im Boot hinaus und baden ... bis tief in die sternenhellen Nächte hinein gehen wir spazieren oder sitzen auf dem Geländer von einem Bauerngarten und reden miteinander; die Leute, die wir begegnen, kennen uns und sind alle in einer gewissen Weise hier zu Hause, einmal ist es der Reichskanzler Hohenlohe und einmal eine alte, ganz runzelige Bauernfrau mit einem Eimer Milch.“
In jenem Welsberger Sommer des Jahres 1907 ist man allerdings stärker an den Schreibtisch gefesselt. Ais Hofmannsthal seinen Besuch ankündigt, kann er Schnitzler, den es zwecks schöpferischer Ruhe „ins Einsamere“ gezogen hat, beruhigen:„Natürlich ohne Störung Ihrer Arbeitsstunden, ich arbeite auch ...“ So zieht sich denn jeder der Freunde früh morgens in eine andere Richtung des Waldes zurück, und erst am späten Nachmittag tut man sich zu gemeinsamem Wandern zusammen. Auf einer dieser Touren, talwärts gegen das Dörfchen Olang zu, kommt es zu einem Landschaftserlebnis, das kurz darauf Versgestalt annimmt; Olga. Schnitzler berichtet darüber in ihren Erinnerungen:
„Mit einemmal, vor einer kleinen Brücke über einen reißenden Bach, stehen wir vor einem Marterl, einem bunt gemalten Heiligenbild: Die Muttergottes mit den sieben Schwertern in einem blutroten Herzen neigt den Kopf, Christus mit der Dornenkrone trägt sein schweres Kreuz. Darunter stehen zwei Zeilen: O meine Mutter Ach mein lieber Sohn Nichts weiter. Danach entsteht
eines der Hofmannsthalschen Gedichte. Es heißt: ,Vor Tag'.“
Nun liegt und zuckt am fahlen Himmelsrand
In sich zusammengesunken das Gewitter.
Nun denkt der Kranke: „Tag! jetzt werd ich schlafen!“
Und druckt die heißen Lider zu. Nun streckt
Die junge Kuh im Stall die starken Nüstern
Nach kühlem Frühduft. Nun im stummen Wald
Hebt der Landstreicher ungewaschen sich
Aus weichem Bett vorjährigen Laubes auf
Und wirft mit frecher Hand den nächsten Stein
Nach einer Taube, die schlaftrunken fliegt,
Und graust sich selber, wie der Stein so dumpf
Und schwer zur Erde fällt. Nun rennt das Wasser,
Als wollte es der Nacht, der fortgeschlichenen, nach
Ins Dunkel stürzen, unteilnehmend, wild
Und kalten Hauches hin, indessen droben
Der Heiland und die Mutter leise, leise
Sich unterreden auf dem Brücklein: leise,
Und doch ist ihre kleine Rede ewig
Und unzerstörbar wie die Sterne droben.
Er trägt sein Kreuz and sagt nur „Meine Mutter!“
Und sieht sie an, und: „Ach, mein lieber Sohn!“
Sagt sie. — Nun hat der Himmel mit der Erde
Ein stumm beklemmend Zwiegespräch. Dann geht
Ein Schauer durch den schweren, alten Leib:
Sie rüstet sich, den neuen Tag zu leben.
Nun steigt das geisterhafte Frühlicht. Nun
Schleicht einer ohne Schuh von einem Frauenbett,
Läuft wie ein Schatten, klettert wie ein Dieb
Durchs Fenster in sein eigenes Zimmer, sieht
Sich, im Wandspiegel und hat plötzlich Angst
Vor diesem blassen, übernächtigen Fremden,
Als hätte dieser selbe heute nacht
Den guten Knaben, der er war, ermordet
Und käme jetzt, die Hände sich zu waschen,
Im Krüglein seines Opfers wie zum Hohn,
Und darum sei der Himmel so beklommen
Und alles in der Luft so sonderbar.
Nun geht die Stalltür. Und nun ist auch Tag. Die Sache reizt mich, in all ihrer
— und sei es gewollten — Einfachheit und Frische; Adorno würde es die „zweite Unschuld“ nennen. Aber da sind auch Bedenken: Heißt es nicht den Snobismus auf die Spitze treiben, sich für ein Unternehmen wie das meine ein einzelnes Gedicht vorzunehmen, nichts als ein paar Verse, ganze 38 Zeilen, einen Mikrokosmos aus Bildstock und Stalltür, Waldlichtung und Sturzbach? Betreibe ich nicht lächerlichen Pointil-lismus, verschwende ich mich nicht
— gemessen an den großen repräsentativen Hofmannsthal-Veduten — an ein petit rien? Ist es zu verantworten, das Palais Rofrano, den „König von Ungarn“ links liegen zu lassen, um das Cafe Passecker einen Bogen zu machen, die Spuren, die ins Finazzertal führen, zu vernachlässigen, Falun, Venedig, das alte Mailand — das alles sollte für ein bißchen Morgendämmerung im Pustertal zu opfern sein?
Hofmannsthal selber redet mir zu; im „Gespräch über Gedichte“ sagt er: „Sind nicht die Gefühle, die Halbgefühle, alle die geheimsten und tiefsten Zustände unseres Inneren in der seltsamsten Weise mit einer Landschaft verflochten, mit einer Jahreszeit, mit einer Beschaffenheit der Luft?“
Und übrigens kann ich mir ja den Rückzug offenlassen. Ja, das ist wohl die Lösung: Ich fahre nach Welsberg — auf eigenes Risiko, auf Verdacht. Läßt es mich unbefriedigt, hänge ich Venedig oder Mailand an. Auch die Romana-Landschaft mit dem Kastell Finazzer und dem Fingerglied der heiligen Radegundis in der Dorfkirche liegt am Weg. Ich kann also noch immer, wenn es nottut, auf die Reitergeschichte ausweichen, auf den Andreas oder, wieder in Wien, auf den Rosenkavalier, den Schwierigen, die Arabella. Umgekehrt: Hält mich tatsächlich Südtirol fest, darf ich da-
mit rechnen, vom Aroma der Gründerjahre des Tourismus zu kosten — jener Frühzeit des Reisens, die gerade im Land an Eisack und Etsch von so vielen großen Dichtemamen begleitet ist: Ibsen, der sieben Sommer in Gossensaß zubrachte, Kafka, der in Meran Heilung suchte, Herz-manovky-Orlando, der in gleicher Absicht herkam und gleich hierblieb, Musil und Morgenstern, nicht zu vergessen Ezra Pound, der auf der Brunnenburg unterhalb Schloß Tirol eine zweite Heimat fand und den Bauern der Gegend zuredete, sie sollten doch den Weinbau bleibenlassen und stattdessen Sojabohnen und Zuckerahorn anpflanzen.
Mit den Sojabohnen und dem Zuckerahorn ist es noch immer nichts, dafür fließt der hellrote Rote in Strömen, und er schmeckt zu alledem so vorzüglich, daß ich keinen Anlaß sehe, den dickschädeligen Südtiroler Weinbauern einen Vorwurf daraus zu machen, daß sie die agrarischen Ratschläge des Barden aus Idaho so gänzlich in den Wind geschlagen haben.
Auch mit meiner Frohbotschaft, die zu verkünden ich gekommen bin, mache ich übrigens wenig Eindruck: mit der den Welsbergern unbekannten Tatsache, daß vor Jahrzehnten zwei der bedeutendsten österreichischen Dichter bei ihnen zu Gast gewesen sind und einer der beiden sogar ihre kleine Welt in einem seiner Werke verewigt hat. Es besteht also wenig Aussicht, daß der Fremdenverkehrsausschuß bei .seiner nächsten Sitzung den Beschluß fassen wird, der Text des Ortsprospekts sei schleunigst mit den beiden prominenten Namen anzureichern — die Faszination von Bocciabahn und Skilift hat ihnen den Blick fürs Poetische versteilt. Aber war das eigentlich je viel anders? In einem Sitzungsprotokoll des Verschönerungsvereins aus dem Jahr 1913, m dem man mich bereitwillig schmökern läßt, finde ich die Anmerkung: „Auch soll die Anwesenheit eines Friseurs im Prospekt erwähnt werden.“ Na, also.
Als Paul Troger, der große Barockmaler (sein Geburtshaus steht hinter dem Pfarrplätz), sieh erbötig machte, seinem Heimatdorf unentgeltlich die Kirche auszumalen, man solle ihm lediglich das dafür nötige Gerüst bereitstellen, lehnten die Gemeindeväter ab. So blieb es also bei einigen wenigen Tafelbildern. Später, als der Mesnersohn aus Welsberg in Wien zum Hof- und Kammermaler aufgestiegen war und die großen Klöster im Donauraum der Reihe nach mit seinen Fresken schmückte, hätte man den kurzsichtigen Entschluß nur zu gern rückgängig gemacht. Dafür gab's dann zum 200. Todestag die obligate Denk-malsen'thüllung und das obligate Festspiel — so ist das halt auf der Welt. Hofmannsthal muß sich also noch ein wenig gedulden.
Gerechterweise habe ich aber auch von eindrucksvollen Bekundungen guten Willens zu berichten. Einer meiner ersten Wege in Welsberg (oder Monguelfo — wie die Italiener sagen) führt mich zu dem Mittelschullehrer Josef Sulzenbacher; er wird mir als der berufene Gewährsmann für alle Auskünfte heimatkundlicher Natur genannt, und er ist auch einer der wenigen, denen man glauben kann, wenn sie die Kenntnis des Namens Hugo von Hofmannsthal beteuern. Ihm gefällt, was ich erzähle, er erbittet sich sogleich eine Abschrift des fraglichen Gedichts, und ich könnte mir gut denken, daß er es bei passender Gelegenheit, nun, da er die Zusammenhänge kennt, auch in seinen Literaturunterricht einbaut. Vor allem aber ist ihm anzusehen, wie sehr ihm daran gelegen wäre, dem Besucher die Gewißheit zu geben, auch im kleinen Welsberg wisse man sehr wohl, was es mit einem Mann wie Hofmannsthal auf sich habe. Zum Beweise dessen türmt er die Lesebücher der Region vor mir auf. Und wahrhaftig: In einem Band mit dem bemerkenswerten Titel „Merk und nütz es!“, 1959 in Bozen erschienen, findet er endlich, wonach er sucht. Stolz schlägt er die betreffende Seite auf, sein Finger deutet triumphierend auf das Gewünschte, seine Stimme füllt sich mit Pathos, die meine mit Anerkennung, im Chor lesen wir den Namen des Autors ab: Hans von — Hoffensthal.
Hoffensthal?
Ich beeile mich, das peinliche Schweigen, das der irritierenden Entdeckung folgt, zu brechen, und räume ein, daß gewiß auch dieser Hoffensthal, wiewohl von nur lokaler Berühmtheit, ein erstklassiger Mann sei, das Unverzeihliche sei ja gerade, daß ich nicht von ihm wüßte, — Hofmannsthal, du lieber Himmel, sei schließlich nicht alles.
Doch Josef Sulzenbacher gibt nicht auf. Er weiß, worum es in dieser Sekunde geht: Es geht darum, die Ehre Welsbergs zu retten. Und Josef Sulzenbacher schlägt sich gut. Er erinnert sich im richtigen Moment, daß er, der Volksschullehrer auf dem Sprung zum Mittelschullehrer, vergangenes Jahr in Brixen an einem Kurs teilgenommen hat („berufsbegleitende Lehrerfortbildung“ heißt so etwas), und dort hat ein Innsbrucker Germanist über die „Wiener Impressionisten“ referiert. Sulzenbachers Beweis gelingt lückenlos: Er kramt sein Kollegbuch hervor, blättert darin eine Weile und findet am Ende tatsächlich die gesuchte Eintragung: „Die Lyrik Hugo von Hof mannsthals“. Ja, hätte er damals schon gewußt, was er erst jetzt aus meinem Mund vernommen — wie hätte er da vor den Kollegen brillieren können! „Meine Herren!“ so hätte er aufstehen und einem atemlos lauschenden Auditorium hinschmettern können, „Sie alle kennen das Gedicht ,Vor Tag'. Es zählt zu den besten Arbeiten des mittleren Hofmannsthal. Es ist mir daher eine besondere Freude, Ihnen mitteilen zu können, daß dieses Gedicht in meinem Heimatort angeregt worden ist, ja mehr als das: in meinem Heimatort spielt. Ich lade Sie hiermit zu einer literatischen Exkursion nach Welsberg ein. Ich danke Ihnen.“ Prasselnder Beifall.
Je länger ich in Welsberg verweile, desto mehr werde ich dem unschuldigen Ort zur Last. An einem der letzten Abende muß ich mein Hotel davon in Kenntnis setzen, daß ich anderntags den Plan habe, gegen 5 Uhr früh das Haus zu verlassen. Ich bin mir darüber im klaren, daß nicht daran zu denken ist, ich könnte den Leuten den wahren Grund meines Unternehmens begreiflich machen. Alles würden sie verstehen: daß ich auf die Jagd ginge, daß ich dem Morgenruf der Lerche lauschen wolle, vielleicht sogar, daß ich mondsüchtig sei. Aber daß es einen Menschen in die Morgendämmerung hinaustreibt, bloß um die Stimmung eines Gedichts — und dazu eines, das sich nicht einmal reimt — nachzuempfinden, das kann nur eine — noch dazu törichte — Ausrede sein, dazu bestimmt, sehr viel schlimmere Umtriebe zu verschleiern.
Ich stelle es der Hotelleitung an-heim, entweder selber zur angegebe-nene Stunde das Haustor aufzusperren oder aber am Abend davor mir den Schlüssel anzuvertrauen. Den entsetzten Gesichtern sehe ich an, daß an letzeres nicht im Traum zu denken ist. Wenn einer schon solch dunkle Dinge im Sinn führt, dann will man sie wenigstens, so gut es geht, unter Kantrolle haben. Nein, nein, man werde für mich um 5 Uhr aufsperren, ich könne mich darauf verlassen.
Als ich anderntags aufbreche, finde ich alles wie vereinbart vor. Ob man mich wohl von einem Detektiv beschatten läßt? Ich würde es dem Ärmsten nicht wünschen: Meine Morgenwanderung auf Hofmannsthals Spuren ist umständlich, beschwerlich und für einen Menschen ohne meine Absichten durch und durch unsinnig.
Ich überquere den Bahndamm und erklimme die steil ansteigenden Serpentinen zu den grün-braunen Holzveranden von Waldbrunn: Das alte Badhotel von der Jahrhundertwende liegt verlassen da, die Kinder der italienischen Luftwaffenve-teranen, denen der tannenumschattete „Soggiorno montano“ seit dem Zweiten Weltkrieg gewidmet ist, kehren erst im nächsten Sommer wieder. „Eintrit verboten“ lese ich auf einer Tafel: Daß die neuen Herren des Landes nach so vielen Jahren noch immer nicht mit der deutschen Sprache zurande kommen ... Rechterhand weiter über die Lettnerwiese durch den Weiler Ried: Der Bach „wild und kalten Hauches“, ist nach wie vor da, wenn auch kaum noch wild zu nennen, die kleinen Bauernmühlen, die er früher einmal betrieben hat, dienen als Geräteschuppen, das Brücklein, früher hölzern, besteht heute aus Beton, das Marterl, das bewußte, ist lange schon, ein paar Schritte seitab, durch ein frisches ersetzt: ohne Gottesmutter, nur Jesus am Kreuz, der Gekreuzigte ganz allein. Zu dieser frühen Stunde, da alles ringsum noch in tiefem Schlummer liegt, doppelt allein. Die Pietä, O meine Mutter/ Ach mein lieber Sohn — was mag aus ihr geworden sein?
Unten im Ort setzt unterdessen das 6-Uhr-Läuten ein, wie zur Schonung der Schlafenden in mehrere kleine Portionen aufgeteilt. Im Bahnhof fährt der österreichische Korridorzug durch. Aus den ersten Häusern steigt dünner Rauch auf, hinter ihren kleinen Fenstern wird's licht. Ein Jäger, das Gewehr über den Rucksack geschnallt, fährt auf seinem Moped an mir vorbei. Dann ein Frühschichtler im blauen Drillich. Und schließlich der Bäcker mit seinem Lieferwagen. Was, geht es mir durch den Kopf, müssen sie alle, die schließlich durchwegs einen vernünftigen Grund für ihr frühes Unterwegssein angeben können, von mir denken? Wie stellt ein Mensch wie ich es zu dieser Stunde an, möglichst harmlos auszusehen? Walter Foitzick hat sich einmal, angesichts einer nächtlichen Begegnung mit einer Dame im Nymphenburger Park, mit diesem typischen Neuroti-kerproblem herumgeschlagen, und er kam zu dem Ergebnis: Ich hätte nie gedacht, wie schwer es ist, den Eindruck eines Nichträubers hervorzurufen.
Anderntags setze ich die Suche nach der Bauernpietä aus Hofmannsthals Gedicht „Vor Tag“ fort. Ich steige auf die Waide-Alm, wo die Hüttenwirtin einen Baum zu wissen glaubt, an dem der älteste Bildstock der Gegend hänge; ich frage den alten Holzer Konrad, den Krippenbauer, dem sie die beschädigten Feldkreuze zum Ausbessern bringen, und den Tischlermeister Schenk, dem sie vor der Nase den Florian von seinem Brunnen gestohlen haben; ich lasse mir vom Ortspfarrer die Dolorosa zeigen, die er in der Sakristei unter Verschluß hält („Wegen der Kirchendiebe stellen wir sie schon nicht mehr hinter dem Original, sondern nur noch hinter dem bloßen Motiv her“) — zwei Dörfer weiter zum Gnadenbild von Aufkirchen, dessen Schmerzensmutter den Bäuerinnen, denen ich unterwegs auf den Feldern begegne, wie aus dem Gesicht geschnitten scheint.
Aber längst ist mir klar: Ich habe es von allem Anfang an falsch angestellt. So komme ich nicht weiter, so nicht. Mein Revier — zu finden, was ich suche — läge ganz woanders. Doch es ist ein unzugängliches, ein unermeßlich weites Revier, das zudem Tag für Tag noch weiter wird: die Hausbars und Kaminecken der Neureichen, die Läden und Magazine der Antiquitätenhändler. Kein noch so fromm geschmückter Feldweg kann mir bieten, was mich dort erwartet.
Mir bleibt, so sehe ich, nur eine Hoffnung: die Hoffnung, daß wenigstens „des Heilands und der Mutter kleine Rede“ sich dem Zugriff der Trödler hat entziehen können und weiter hier vonstatten geht: am Wasser, beim Brücklein, hier, wo bäuerliche Frömmigkeit sie vorzeiten gestiftet und dichterische Ergriffenheit sie für alle Zukunft bewahrt hat:
Und doch ist ihre kleine Rede ewig Und unzerstörbar wie die Sterne droben.




































































































