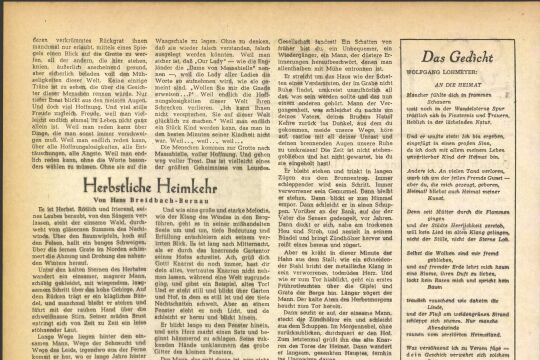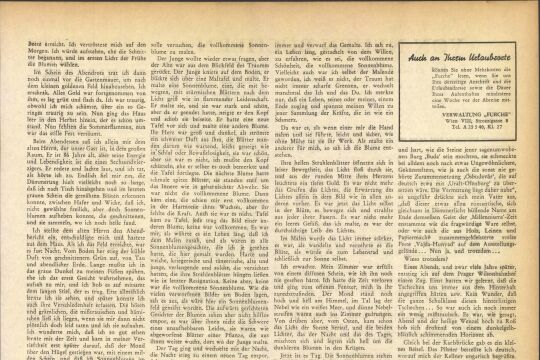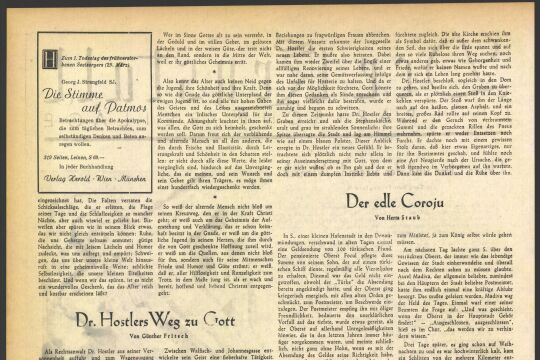Schlag 9 Uhr 17 war es. An diesem glasklaren Frühlingstag, da alles Ferne so nah und alles Nahe farbenstark war, als sei die ganze Welt, eben erst frisch gestrichen worden, passierte, der, Oberst^ der |Zwahrerc.Qbers£“ .wie; SSJi'Jflie ' Leute ria^lnfen, 3|s- Hietzinper' Tor vöh- ScfHSnbrunn, was den Parkwächter erstaunen' mächte, da jener'sonst'stets um 9 Uhr 15 eintraf. Aber auch diesmal trug der Oberst das Triederetui an der linken Schulter; er trug es selbst dann, wenn der ganze Park eine einzige Milchsuppe war, die man hätte schneiden können, so dick konnte die sein, wenn die Wien ihre Nebelschwaden hier hereinschickte.
In gemäßigt schnellem militärischem Schritt, wenngleich mit dem linken Fuß leicht hinkend, marschierte der Oberst die Hauptallee weiter. Mitunter bekam er so ein gewisses verdächtiges Brennen aus der Herzgegend, das sich bis in die linke Achselhöhle zog, darum trug er stets in der Trieder-tasche eine Rolle Myocardon mit sich; sie lag neben dem Taschenmesseretui und dem Rehleder für das Glas. Aber Glas war seit Jahren keines mehr darinnen. Ansonsten war das Futteral leer — diese drei Dinge ausgenommen. Und da er es immer und jedenorts mithatte, so war er sonach gegen Herzanfälle geschützt. Nur sonntags ließ er es zu Hause, wenn er zur 11-Uhr-Messe ging, denn er fand es lästerlich, zum lieben Gott mit einer Rolle Myocardon zu kommen.
Nach dem Ende der Hauptallee querte er das Parterre und bog gleich hinterm Neptunbrunnen die Zickzackwege zur Gloriette hinan. Bei jeder zweiten Kehre blieb er stehen, griff halblinks nach rückwärts zur Triedertasche, zog die Hand aber jedesmal mit einer belästigt-enttäuschten Bewegung wieder zurück und betrachtete das Panorama — ob nun eines da war oder nicht. So tat er es, Tag um Tag, ob Regen, ob Sonnenschein, um Punkt 9 Uhr 25.
„Heut' zahlt sich's aber aus“, sagte der Fünfundsiebzig-jährige genußvoll. Da die Sonne noch im Südosten stand, schirmte er die Rechte über seine weitsichtigen Augen. Endlich landete er oben auf dem Plateau vor der Gloriette. Da fiel ihm — so klar hatte er schon seit langem keinen Herbsttag mehr erlebt — ein weißer Fleck auf, gleich halblinks von der Rudolfskirche am Kardinal-Rauscher-Platz, welche die höchstgelegene von Wien sein soll. Das mußte wohl ein Neubau sein? Und wieder griff er nach der leeren Tasche.
Da bemerkte er einen anderen alten Herrn, der mit einer Dame dazupassenden Alters gleich neben dem großen Teich stand, und derieü^llenljjiees(F£rjyüa|J'or die iAMJ^.bi||lt| Dann starrte der' Ober! wieder und starrte, aber er konnte H sich1''diesen neue! weißen) Hätisorfiecie nicht erkläBenväoiEHi 'neuer Gemeindebau?“ fragte'd-laut'sffri Selbst. “Def Jffemae“““ Herr sah herüber. Mit einem Ruck richtete sich der Oberst gerade, ging liebenswürdig-steifen Schrittes auf das fremde Paar zu und sagte:
„Oberst Himmelbaum, wenn Sie gestatten.“ Dabei verbeugte er sich leicht auch gegen die alte Dame hin. „Ich... ich habe vergessen, mein Glas einzustecken... würden Sie, bitte, die besondere Liebenswürdigkeit haben, mir das Ihre für einen Augenblick zu borgen ... ich hab' da nämlich etwas entdeckt... ich weiß nicht...“ Ratlos-abweisend sah ihn der andere an.
„Ton binocle“, sagte die Dame zu ihrem Gemahl.
„Eh... Monsieur, mais je ne vous connais pas“, raffte sich der Herr endlich erstaunt zusammen.
„Oh, bitte tausendmal um Vergebung, excusez, Madame, leg mich zu Füßen, meine Gnädige“, sagte der Oberst verwirrt und errötend, dann machte er noch eine Verbeugung. Es war die letzte seines langen Lebens, denn eben als er daran war, sich wegzudrehen, schrie sein Herz auf, das bezauberndste Panorama der Welt schwärzte sich, und dann hatte er noch das Gefühl, daß seine Nase bluten müßte, weil der Kies so scharf war. Weiteres entschwand ihm.
Da oben, wo es so leer und so weit ist, ist auch jedes Telephon weit, und weit und breit nichts Uniformiertes. Darum dauerte es eine recht hübsche Weile, ehe der grüne Wagen sich über verschlungene Parkwege hier heraufgearbeitet hatte und den alten Herrn ins Spital mitnahm.
Dort oben, wo es so weit und so breit und so einsam war, genau an diesem Ort seines alltäglichen Genusses, war auch der Ort seiner tiefsten Erniedrigung gewesen. Dies fiel dem Oberst ein, als er in seinem Bett Nr. 23 des großen Krankensaales lag und ihm die Schwester schon wieder hatte Nitroglyzerin auf die Zunge träufeln müssen; dann hatte der neuerliche Anfall sofort aufgehört. Abgesehen von den leichten Gesichtskontusionen vom Auffallen auf den rauhen Kies, fühlte er sich nun wieder ein wenig neugeboren. Darum fiel sein Blick auf das dunkle Etwas, das auf dem Unterfach seines blechernen Nachtkästchens lag. Es konnte nur das Triederfutteral sein; seine Wäsche und seine Kleider hingegen schienen spurlos verschwunden. Und da es späte Nacht war — seine leuchtende Präzisionsuhr mit Datumzeiger wies auf 2 Uhr 11 —, so vertagte er die Frage nach seinen persönlichen Effekten auf den kommenden Morgen.
„Ja also, dieses Glas erinnert mich daran, daß sie auch einmal meinen Säbel, die Feldbinde und den Tschako auf meinen Sarg legen werden — das muß alles bereitgestellt werden“, dachte er laut, aber doch leise genug, um die vielen Schläfer reihauf, reihab nicht zu wecken. „Dieses Glas, gewiß, es ist ein normales Ausrüstungsstück für einen Offizier — was hat das aber mit Säbel, Feldbinde und Tschako zu tun?“ sinnierte er weiter — aber da er hier sichtlich auf ein ihm fremdes Gebiet der Philosophie oder Psychologie abkam, so schloß er mit dem im Befehlston vorgebrachten Wunsch: „Morgen muß der Andreas zwei her!“ Unter Andreas II. war sein Sohn gleichen Vornamens zu verstehen. Er hatte ihn schon seit jeher so genannt, und Gabriella hatte auch das noch akzeptiert. Hatte sie jemals widersprochen? Nie hatte sie das getan! Sie war eine gute Frau gewesen, bei Gott, das war sie!
„Ja also, dieser Andreas, dieser schrecklich gelehrte Kerl, man weiß nie recht, was man mit ihm reden soll; ich bin nicht so gemein, zu behaupten, daß der Doktor Andreas Himmelbaum ein unwissender Mensch ist, schließlich bin ich ja sein Vater. Jetzt ist er wieder bei irgend so einer Biennale oder sonst was Internationalem in Venedig; natürlich wird er wieder hingefahren sein wie ein Postpackl, gar nichts wird er zum Erzählen haben, und die Markuskirche und den Dogenpalast, vor denen hat er wahrscheinlich verachtungsvoll weggeschaut, weil sie nicht von Le Corbusier sind oder wie dieser berühmte Architekt schon heißt. Wenn die Emma dem Andi telephoniert, hoffentlich erschrickt er nicht; bei seiner Tuberkulose könnt' ihm das schaden. Aber 's hat sein müssen, daß die Schwester meine Schwiegertochter anruft.“
„Wie soll ich ihm das mit dem Etui begreiflich machen, diesem verdammten, leeren Etui, denn schließlich ist er ja mein Erbe, nicht wahr? Und eigentlich bin ich ihm doch Rechenschaft schuldig, wo es ja seine Mutter mir gegeben hat, nicht wahr?“
Ihm, gerade ihm hatte so etwas passieren müssen, und genau dort, auf dieser herrlichsten aller wienerischen Höhen. Den Brand von St. Stephan hatte er von dort aus gesehen und war tags darauf mehr zu Fuß als fahrend hingeeilt, um Mauertrümmer wegzuräumen, ja sogar Glutnester zu beseitigen hatte er einem jungen Kaplan geholfen... oh, wie hatte Wien damals von oben ausgesehen, das Nationalheiligtum ohne Dach... es war zum Weinen gewesen. Jetzt aber hatte der Dom, Gott sei's gedankt, wieder eines.
Und gerade damals war ihrer beider silberne Hochzeit gewesen (die sie eigentlich in Mariazell hatten feiern wollen, wie's schon seit Jahren besprochen war). Und weil er sich schon immer ein Glas gewünscht hatte, so war Gabriella, frauenhaft schlau, dennoch imstande gewesen, durch einen weitschichtigen Verwandten, der in Jugoslawien wohnte, wo man deutsche Waren bekam, so viel man nur wollte und bezahlen konnte, ein solches Prachtstück, echt Zeiß, zu beschaffen. 1944 war das gewesen.
Was hätte hingegen er ihr schenken sollen Also hob sie das Glas auf, obwohl ihr jemand einmal dafür sogar eine fette ganze Gans geboten hatte ... Sie wollte es ihm erst in fünf Jahren zu seinem siebzigsten Geburtstag schenken, denn vielleicht wäre ihr Gatte sogar erzürnt gewesen über dieses Geschenk in diesen Tagen; sie hätten sich beide geschämt, da noch irgend etwas zu feiern. Statt dessen hatten sie einander nur je einen Brief geschrieben und diesen hernach je unters Polster des andern gesteckt. In der darauffolgenden Frühe lasen sie dann ihre gegenseitigen Wünsche und Beteuerungen. So war das zeit ihrer Ehe Sitte gewesen. Man hatte nicht immer etwas zu schenken, wollte man nicht in Schulden geraten. Er hatte das so eingeführt, und sie hatte sich gefügt. Wie immer.
Zu seinem Siebzigsten aber hatte er das Glas nicht mehr aus ihrer Hand erhalten können. Zwei Tage zuvor war sie unter die Stadtbahn geraten — iue noch hatte er einen der- j maßen übel zugerichteteniMw^.Qhenkörpet-gjeBffherti^auch -im ersten Weltkrieg nicht) wie diesen jahrzehntelang so sehr geliebten. Und als er ihren Kleiderschrank öffnete, das schwarze Seidenkleid herauszunehmen als letzte Bekleidung für die Ewigkeit, da war ihm ein blauer Karton aufgefallen, den er zuvor nie noch gesehen hatte: der Trieder!
Zum Begräbnis trug er die braune Tasche bereits. Zwar paßte sie zum schwarzen Anzug nicht recht, und ein paar Bekannte wunderten sich auch, sagten aber nichts. Ausgenommen sein Freund, der General von Lampach;
„Was hast denn da drinnen? An Feldstecher gar? Damit wirst sie da oben auch net sehn“, sagte er, als sie allein zwischen den Gräbern dahinschritten, die leer waren für sie beide.
„Das hat sie mir zum Siebzigsten geschenkt, heut is er“, sagte der Oberst. Denn neben dem neuen Glas, das nun schon seit sechs Jahren in ihrem Kleiderschrank geruht, hatte er auch eine Rechnung von damals gefunden, aus Agram, in Kuna ausgestellt, die zwar für seine Augen nicht bestimmt war, wohl aber ein kurzes Briefchen diesen Inhalts: „Auf daß Du klarer in Deine reiche Vergangenheit und in eine bessere, hoffentlich noch recht lange Zukunft sehen mögest“, stand darin zu lesen. Datum von heute. Unterschrieben: „Dies wünscht Dir Deine auch schon recht bejahrte Yella, die Dich nicht überleben möchte.“
„Ah, da schaust her“, sagte der General. „Komm, alter Andi, ich weiß wo was Anständigs zu trinken, daß d' net heulst; ghört si für an alten Soldaten net. Erinnerst di noch wie mer bei der Felddienstübung dem Hauptmann Sturmbusch mit Platzpatronen aufn Hintern gschossen ham, weil der doch der ärgste Schleifer war von der ganzen Theresianischen. Was habn mer da glacht, wie s' hernach die Falschen eigsperrt habn ... !“
Und dann passierte jene merkwürdige Geschichte, in der sein Leben zusammengefallen war in nichts. Und auch das war oben auf der Gloriette geschehen. Dies war die Folge dessen, daß er, der „Zuwlzahrer-Oberst“, so nach und nach zu einem Amateurfremdenführer geworden war, der allerlei Leuten, gebeten und ungebeten, das Wiener Panorama zu erklären die Gewohnheit angenommen hatte. Jeder mußte dabei durch seinen „neuen“ Trieder schauen, Einheimische, Fremde, Ausländer. Ein amerikanischer Student hatte ihn einmal zu ein paar mörderisch scharfen Drinks in den „Hübner“ da unten eingeladen, und ein pensionierter Mittelschulprofessor aus der Provinz hatte ihm einmal verlegen zwanzig Schilling zugesteckt, die der Oberst vergnügt entgegennahm, um den Spender hernach seinerseits ins „Kaiserstöckl“ einzuladen, was genau das Doppelte der Spende gekostet hatte. Raffinierterweise stellte er sich erst ganz zum Schluß vor, als sie voneinander schieden: „Oberst Himmelbaum, mein Name, wenn Sie gestatten, Herr Doktor.“
Dann aber kam das Malheur, und es kam in Gestalt dreier junger Taugenichtse, die (wie der Oberst annahm) sicherlich noch nicht beim Militär gedient hatten. Er hatte sich sein Kindergemüt bewahrt.
„Sehen Sie, meine jungen Herren“, hatte der alte Oberst zu den drei jungen Burschen gesagt, die seinem Treiben vor der Gloriette scheinbar interessiert zugesehen hatten.
„Die jeweilige Atmosphäre, aber auch die Tatsache, daß Wien zentral um den Stephansturm herum gebaut ist, verzerrt meist die Perspektive. Wenn Sie hier zum Beispiel den Rathausturm sehen — er ist heute überaus klar erkennbar —, so erscheinen die Doppeltürme der Votivkirche daneben viel zu weit entfernt. In Wirklichkeit sind es keine fünf Minuten zu gehen, nicht wahr? Wohingegen St. Stephan vom Betonklotz des Esterhäzy-Bunkers kaum weiter gelegen zu sein scheint, als der Rathausturm von der Votivkirche. In Wahrheit ist es die gut fünffache Strecke, nicht?“ dozierte er ganz im Tonfall eines Offiziers, der Kadettenschülern Geländekunde beibringt.
„Und sagen S', Herr, was is denn das nachher für a Turm, wissen S', ich seh schlecht“, sagte der eine, der mit den schwarzen Haaren und dem blitzblauen Hemd zu lichtgrünen Hosen. „Welcher, bitte?“ „Der, was dort herschaut.“
„Ja — also den seh ich allerdings auch nicht; ich weiß nicht recht, was Sie meinen. Wollen Sie vielleicht mein Glas nehmen, damit Sie ihn besser sehen, ja so, hängen Sie sich's nur um, aber Sie müssen zuvor einstellen auf Ihre Augen; ich hab' ja andere als Sie, nicht wahr?“ Damit hing er dem jungen Mann sorgfältig seinen Trieder um. Der drehte ein paarmal herum, während die beiden andern in einer merkwürdig abwartenden Stellung, die Hände tief in die Hosensäcke vergraben, dabeistanden. Aber der Oberst bemerkte nicht das mindeste. Er war jetzt ganz Turm.
„Jetztn seh ich richtig“, sagte der junge Mann. „Und dank Ihna scheen...“ Damit setzte er sich auch schon in Bewegung. Die beiden andern auch.
„Aber mein Glas!“ schrie der Oberst entsetzt auf. Hilflos starrte der alte Mann hinter den drei flüchtenden jungen Gangstern her. Ja, ja, sehr einsam ist es da oben, sehr weit die Sicht, aber leider weit und breit nichts Uniformiertes, und auch kein Fernsprecher. Überdies hinkte der alte Herr.
Daß er nach wie vor mit der leeren Tasche ausging, wußte nicht einmal sein Sohn. Andreas II. hatte keinen Sinn für „Triider“, wie er dieses Glas das erstemal genannt, als ihm sein Vater davon geschrieben hatte. Hinfort hatte er diesen immer wieder damit geärgert, so er es wollte, indem er dieses Wort so aussprach. Brillanter Schauspieler in allen Lebenslagen, war für ihn die Natur nichts als eine längs Betonpisten begrünte „Einheit“; hinderlicherweise gab es mitunter sogar auch Berge mittendrin. Dabei sah man diesem herkulischen, nicht großen Menschen seine hoffnungslose Knochentuberkulose eigentlich nicht an. Diese durchsetzte seine ganze Seele so enzyklopädisch wie seine totale Unwissenheit, da er es zeitschulisch bis zum Doktorat gut verstanden hatte, alles papageienhaft herzuplappern, um es Minuten darnach zu vergessen. Daher verteidigte Andreas II. irgendwo einen Kulturschreibtisch und war nichts als ein Snob, der andächtige Augen machte, sowie er mit einem Höheren sprach, wohingegen er eine gewisse herablassend-mitleidige, ohrfeigenreizende Art hatte, mit Leuten zu reden, die, kulturbefangen, irgend etwas malten, schrieben oder in Noten 15 setzten, das. nicht allerletztester Schrei war. Hierfür hatte-r er Mausohren. Nur, seine. 7-DioptriehrBriJlen .waren seine i JHerrfin.derm, sowier sie abnahm,-war er.ein Krüppel. An*., sonsten hatte er einen Sohn, Andreas Pablo Michelangelo Himmelbaum mit Namen.
Des nächsten Vormittags kam die erste Visite. „Jetzt haben Sie auch mich einmal in Reparatur, Herr Professor“, sagte der Oberst, nachdem jener, wie ein General, der die Front abgeht, an der Spitze seiner endlosen Cortege, ihn untersucht hatte. Währenddessen standen die Ärzte und Schwestern im Kreis rundum und lauschten angespannt den Worten des Meisters. Und eigentlich sah das Ganze aus, wie eine Beerdigung in Weiß.
Aber der Professor gab keine Antwort, weil er sofort gesehen hatte, daß es hier nichts mehr zu reparieren gab. Das EKG, das sein Sklave, der Dr. K., aufgenommen hatte, also das war jedenfalls negativer als negativ!
Der Oberst hatte das so gesagt, weil er den Professor von früher her flüchtig kannte und er starke Worte so sehr liebte, wie er einstmals starke Schnäpse geliebt hatte, da ein empfindliches Gemüt einem alten Soldaten schlecht ansteht.
„Wie sag ich's dem Andreas, wo der Trieder geblieben ist?“ zerbrach sich der Kranke den ganzen Vormittag über den Kopf. Erst als ihm seine Rede an den Professor einfiel, da wußte er es, und als Andreas II. gleich am zeitigen Nachmittag erschien, abgehetzt, blöde und verärgert, daß sich sein Vater ausgerechnet gestern hatte einen Herzinfarkt holen müssen, wo eine so interessante informelle Ausstellung zu besuchen gewesen wäre (mit einem geradezu „richtungweisenden“ Bild: Drei blaue Knöpfe unten, zwei rote oben, darüber ein irisgrüner Bogen und zwei Stiche in die Leinwand, auf die dies alles aufmontiert war, überschrieben: „Porträt eines Fräuleins“), da sagte der Oberst Himmelbaum zu seinem Sohn:
„Mein Testament findest du in der rechten Schreibtischlade, die grüne Preßspanmappe. Es ist gesiegelt. Du kannst es öffnen. Sparbuch und Lebensversicherung liegen dabei. G'hört ohnehin alles dir. Diese Uhr hier hat einmal dein Sohn zu bekommen. Gilt als mündliches Kodizill. Verstanden?“
„Ja“, sagte Dr. Himmelbaum betreten, denn nun sah er, daß der Tod kein Snob ist. Und überdies weitaus populärer. Wie wichtig! Dazu machte er ein ergebenes Gesicht, denn hier ging es denn doch um einiges Geld. „Wiederholen!“ Er wiederholte.
„Übrigens, wenn du weggehst, machst zum Kaplan an Sprung, ja? Wünsche, versehen zu werden, verstanden? Wiederholen! — Noch was, das Futteral von mein' Trieder, den mir die Mutter damals zum Siebzigsten gschenkt hat, ist leer. Er ist in Reparatur. Der Zettel vom Optiker liegt schon irgendwo.“
Nach dem Begräbnis des Obersten Andreas Himmelbaum, Ritter der Eisernen Krone Dritter Klasse, nahm sein Sohn den Nachlaß auf. Alles war geordnet, fertig zur Übergabe. Nur der Reparaturzettel des Trieders, den konnte er nirgends finden. Eine Zeitlang dachte er schon daran, einen diesbezüglichen Aufruf in die Presse einschalten zu lassen, auf daß sich der betreffende Meister melde, gab dieses Verfahren als wahrscheinlich nicht kostendeckend dann aber wieder auf.