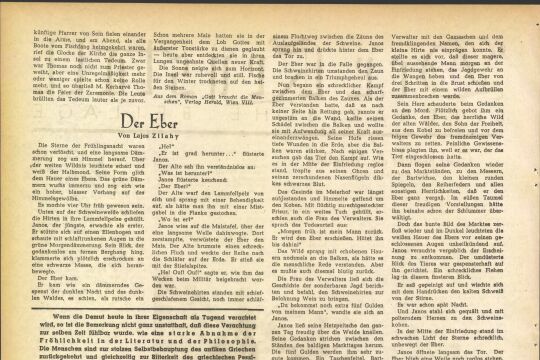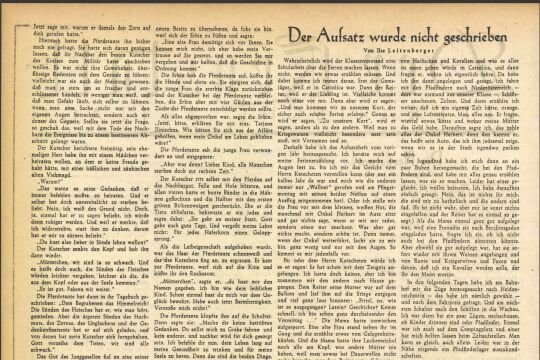Im Jänner 1934 starb mein Schulbanknachbar Kratochwil. Er hatte die Schwindsucht gehabt. Er und seine Zwillingsschwester, die in dieselbe Klasse ging, hatten einen seltsamen Geruch. Armeleutegeruch nannte man es bei mir zu Hause, so wie wir auch von Armeleutehaaren sprachen, die fahl und flachsig und damals wohl eine Art von Statussymbol waren — obwohl dieses Wort zu jener Zeit wahrscheinlich noch nicht existierte.
Mein Mitschüler Kratochwil hatte von der ersten Volksschulklasse an ein spitziges Mausgesitiht mit riesengroßen schwarzen Augen und einer gläsernen Haut. Die Kratochwils hatten sechs oder sieben Kinder, aber der Vater war arbeitslos. Einmal war ich bei ihnen, mit meinem Kinderfräulein, um ein vertauschtes Schulheft zu holen: sie wohnten in anderthalb feuchten Zimmern und schon auf dem Gang hing der Armeleutegeruch in der Luft.
Als die eine meiner Großmütter, die sehr verwöhnt und ängstlich war, von Kratochwils Tod erfuhr, hielt sie mir eine Predigt über Bazillen. Wenn ich an Bettlern oder anderen armen Leuten vorbeiginge, müsse ich den Atem anhalten und dürfe erst dann wieder aus- und einatmen, wenn ich fünf Schritte gemacht hätte, denn die armen Leute seien alle krank und ansteckend. Wenn viele Menschen auf der Straße waren, war das manchmal nicht ganz leicht durchzuhalten, aber immerhin schärfte es das Auge für Leute, die arm waren.
Ein paar Wochen nach Kratochwils Tod kam ein Gendarm zu uns, Bei einem gewissen Zitnik, einem Arbeitslosen aus Floridsdorf, hatte man im Zuge einer „Haus“-Durch-suchung (er wohnte im Bretteldorf) ein blaues Kinderauto gefunden. Und dieser Zitnik hatte angegeben, dieses Auto aus unserer Rollkammer — die schon längst nicht mehr zum Rollen der Bettwäsche verwendet wurde — gestohlen zu haben. Herr Zitnik kam von März bis Oktober einmal die Woche, um unseren Garten zu besorgen; nie habe ich jemanden so schnell und so ausdauernd umstechen gesehen und einmal kam er sogar zu Fuß von Floridsdorf zu uns nach Mödling heraus, um vor Sonnenaufgang Maulwürfe fangen zu können. Wir waren die einzigen, die ihm — von März bis Oktober — Arbeit gaben, sonst hatte er nichts, er war „ausgesteuert“.
Als er das erste Mal zu uns kam und um Arbeit bat — das muß 1932 gewesen sein — war ich gerade im Garten. Mein Vater sagte zu ihm: „Wenn Sie eine Sichel haben, können Sie bei uns die Raseneinfassungen schneiden.“ Nach einer halben Stunde kam Herr Zitnik mit Sichel und Schleifstein wieder. Beim Abendessen fragte meine Mutter, wo er denn das Gartenwerkzeug hergeholt habe. „Wahrscheinlich hat er's irgendwo gestohlen“, antwortete mein Vater.
Jetzt hatte dieser Zitnik wieder gestohlen, ein Kinderauto, aus dem mein Bruder und Ich schon herausgewachsen waren, das seit Monaten unbenutzt in der Rollkammer stand und das man ihm sicherlich geschenkt hätte, hätte er darum gebeten. „Hat er's denn verkaufen wollen?“ fragte meine Mutter den Gendarmen. „Wahrscheinlich. Aber bis jetzt leugnet er noch und sagt, er hat's seinen kleinen Kindern zu Weihnachten geschenkt.“
Herr Zitnik war ein „Sozi“. Das wußte ich aus Dienstbotengesprächen. („Botten“ wurden sie bei uns zu Hause genannt, und wenn man von ihnen sprach, erwähnte man nie ihre Vornamen, sondern redete nur von den „Botten“). Als Kind habe ich oft Erwachsenengespräche gehört, in denen von „Sozis“ und „Nazis“ die Rede war. Was Nazis waren, erfuhr ich zum erstenmal, als mein Vater vom Bridgeklub nach Hause kam und erzählte, ein Ingenieur Klech, ein enragierter Nazi, habe über eine bestimmte Dame die Bemerkung gemacht, bei dieser Saujüdin drehe es ihm den Magen um. Der „Onkel Pips“, Böck-Greissau, habe ihn mit den Worten zurechtgewiesen: „Vergessen Sie bitte nicht, daß die Muttergottes ebenfalls Jüdin war.“ „Er ist eben in jeder Situation ein Herr“, sagte mein Vater, „ein wirklich feiner Mensch.“
Die „Sozis“ wurden mir erst später bewußt, durch ein Kinderbuch, das mir mein Onkel Robert — ein eigentlich unguter Mensch, aber mich hatte er gern — zu Weihnachten schenkte. Es handelte von einem braven Hausmeisterkind, das ein Bärli war und, obwohl es nichts hatte und immer seiner Mutter beim Wäschewaschen helfen mußte, viel glücklicher war als die verwöhnten, schlimmen Kinder des reichen Villenbesitzers. Als meine Eltern den Inhalt dieses Buches entdeckten, nahm man mir's weg und das Fräulein sagte, der Herr Onkel wolle wahrscheinlich einen „Sozi“ aus mir machen. Man las diesem Onkel, der immer nur sonntags zu uns kam, die Leviten und bald darauf war er bei der Heimwehr.
In diesen unfreundlichen Wintertagen wurde bei uns in Mödling viel marschiert. Die Heimwehr war jedes Wochenende unterwegs und ich beneidete sie um ihre Hahnenschwänze, die viel größer waren als der, den ich auf meinem Schiffer! vom Christüch-Deutschen Turnverein trug. (Meine Mutter hielt viel auf Bewegung.) Früher waren auch Schutzibundleute marschiert, in Windjacken, die bis zum Oberschenkel reichten, aber ich hatte die Heimwehrler lieber, weil sie auch beim Umgang mitgingen. Die Umgänge zu Fronleichnam in Mödling, in Perchtoldsdorf und in der Hinterbrühl waren für mich die höchsten Feste des Jahres; der Pfarrer bekam aus unserem Garten Riesenbuschen von Jasmin, und als ich als christlich-deutscher Turner das erste Mal mitgehen durfte, träumte ich davon, wie ich als Erwachsener einmal im Heimwehrstahlhelm gleich hinterm Himmel dahermarschieren würde. *
Dann kam der Februar 1934. Ich erinnere mich, wie alles furchtbar aufgeregt war und man den ganzen Tag über bis nach Mödling hinaus Kanonendonner hörte. Das Fräulein war um ihre Mutter besorgt und ging, bevor es finster wurde, zu ihr, und mein Onkel Felix kam aus dem Nachbarhaus mit einem Revolver zu uns schlafen, damit ein Mann im Haus sei. Mein Vater war nämlich schon gestorben und der Botte Adelheid zu einfältig, um meiner Mutter in irgendeiner Gefahr beistehen zu können. Und In meiner Familie war man davon überzeugt, daß in der Nacht die Sozis plündern würden. Sie plünderten aber nicht, es gab nur zwei Tage schulfrei und als die Schule wieder begann, sprach der Pfarrer Rogner viel von Sünde, denn wir standen ja vor der Ersten Kommunion und der Oberlehrer Schillinger erzählte, wie aus dem blutgetränkten Hemd Herzog Leopolds des Heiligen die österreichische Staatsfahne wurde. Und auch im christlich-deutschen Turnverein waren wir sehr patriotisch und änderten den Namen unserer Riege, die bisher „Liechtenstein“ geheißen hatte, weil der Turnsaal in der Nähe des Liechtensteins war, entschlossen in „Prinz Eugen“.
Gleichzeitig mit dem Patriotismus schien aber auch die Zahl der Arbeitslosen zu wachsen. Immer weniger meiner Mitschüler bekamen ein Gabelfrühstück mit, der Oberlehrer Schillinger appellierte an die wohlhabenderen Eltern, für die Kinder der Armen die Schulmilch zu bezahlen, und überall in den Straßen sah man Plakate mit der Aufschrift „Nehmt hungernde Kinder zum Mittagstisch“. (Mein neuer Banknachbar Capek erzählte der Klasse, der Starhemberg werde jetzt Plakate drucken lassen mit „Nehmt frierende Mädchen ins Bett“, aber die meisten von uns verstanden das damals noch nicht.) Wir nahmen zwei in die Ausspeisung, wie man das nannte: Da wir mittags immer äußerst bescheiden aßen, blieben sie bis über die Jause und gingen dann beladen mit Broten, Obst, Marmelade- und Kompottgläsern wieder nach Hause. Einmal fragte ich das Fräulein, warum es an den Tagen, an denen die zwei da waren, entweder nur Butterbrote oder Brote mit nur Marmelade gab, worauf das Kinderfräulein sagte: „Deine Mutter will nicht, daß sie sehen, daß es Leute gibt, die sich Brote mit Butter und Marmelade leisten können.“ Ganz verstand ich das erst, als der Ehn einmal erzählte, bei ihnen bekäme am Sonntag jeder eine Knackwurst; der Obernhuber wollte das nicht glauben — bei ihnen bekam am Sonntag nur der Vater ein Stück Wurst, und daß es Leute gab, die auch an Wochentagen Fleisch aßen, kam ihnen überhaupt nicht in den Sinn.
Ich fand es damals ganz normal, daß es Leute gab, denen es schlecht, und solche, denen es gut ging, denn bei uns waren immer schon Hausgäste gewesen, vor allem Künstler, die in irgendwelchen, meist finanziellen Schwierigkeiten waren. An zwei von ihnen kann ich mich noch deutlich erinnern, an den Bildhauer Fritz Wotruba und an den Architekten Zeno Kosak, der oft von Freitag bis Montag im Gästezimmer wohnte. Meine Mutter behauptete zwar, er wohne bei uns, um den Garten zu genießen und den Rasen zu schneiden, aber ich wußte genau, daß er eingeladen war, um sich sattessen zu können. Zeno Kosak, der es bis zum Rektor der Akademie für angewandte Kunst bringen sollte, muß besonders arm gewesen sein, denn er besaß nicht einmal ein Pyjama, was die dumme Adelheid jedermann im Haus erzählte.
Als es wärmer wurde und die Kinder bloßfüßig zu gehen begannen, waren es mehr als früher, die keine Schuhe hatten: ich glaube, mehr als zwei Drittel der Klasse. Von dreien weiß ich genau, daß sie auch keine Hemden hatten, sondern das ganze Jahr über verwaschene, blaue Ruderleibchen trugen: es waren der Moser, der Pichl und der Sams. Mit diesen dreien war ich ganz gut, weil ich zu Weihnachten ein kleines Fahrrad bekommen hatte, mit dem ioh, trotz der Proteste des Kinderfräuleins, bis zum Südbahnschranken fahren durfte. Dort trafen wir uns, und während ich den Zügen zuschaute, ließ ich die drei radifahren, was mir ihre zeitweise Freundschaft einbrachte.
Beim Bahnschranken traf ich auch öfter einen Herrn, dessen Hobby es war, die Fahrpläne der österreichischen Bundesbahnen auswendig zu lernen und der manchmal mit seiner Taschenuhr die Verspätungen der vorbeifahrenden Züge kontrollierte. Er hieß Fritz Ott und mit seiner ungarischen Frau Bözsi, die ich Tante nannte, verkehrte er bei allen unseren Verwandten. Er war der erste arbeitslose Herr, den ich kennenlernte — bis dahin hatte ich geglaubt, Arbeitslose gebe es nur unter Leuten, die von vornherein arm waren. Obwohl es ihm sicher sehr schlecht ging, war der Fritz Ott sehr lustig („witzig“ nannten es die Erwachsenen), und wenn ich zurückdenke, scheint es mir unbegreiflich, daß die, mit denen er verkehrte, ihm keinen Posten verschaffen konnten. Als er schließlich einen fand — in Linz, bei einem Reisebüro — war es zu spät: die Deutschen marschierten ein und er und seine Frau begingen Selbstmord, um Schlimmerem zu entgehen. In seinem Abschiedsbrief vermachte er uns seinen Dackel, der Wurschtel hieß, mit dem Wunsch, daß dieser Hund den anderen überleben möge. Sein Wunsch ging in Erfüllung. *
Wann immer es ging, nahm mich mein Großvater auf seine langen Spaziergänge im Wienerwald mit. An Sonntagen standen an den belebteren Wegkreuzungen Bettler im Wald, an Wochentagen stieß man an gewissen Plätzen auf Gruppen Arbeitsloser, die beim „Kreuzerl-schupfen“ waren. Der Hofrat Felix, ein hoher Richter, der uns mit seinem Airdale-Terrier oft begleitete, argwöhnte aber, das dieses Kreuzerlscbupfen — das verboten war — nur ein Vorwand sei und hier in Wirklichkeit geheime Treffs der — ebenfalls verbotenen — Sozialisten stattfanden. Im übrigen sprach man viel von Gesfürel und POldihütte, ungarischem Zucker und jugoslawischem Bauxit, alles Aktien, die man kaufte, weil sie steigen oder verkaufte, weil sie fallen würden. Manchmal sprach der Hofrat Felix auch vom Anschluß, der ihm unvermeidlich schien. Als er dann kam, erschoß er sich. Er war — aber das erfuhr ich erst viel später — ein Onkel Bruno Kreiskys.
Den Sommer verbrachten wir in Altaussee. Wann immer es ging, war ich mit meinem großen „Freund“, dem Hansl Angerer, dem Bauernsohn, im Stall. Eines Abends war der Hansl verschwunden und am nächsten Tag hörten wir im Radio, daß der Bundeskanzler Dollfuß ermordet worden sei. Mein Großvater erhielt ein Telegramm, er möge Wien anrufen. Als er von der Post zurückkam, erzählte er, man habe ihm das Justizministerium angeboten, aber er fühle sich zu alt, und außerdem wolle er mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Noch weniger aber wollte er mit Leuten wie dem Hansl Angerer zu tun haben, der unter den Nazis war, die losgeschlagen hätten, wenn ihr Plan aufgegangen wäre. Wir packten die Koffer und fuhren nach Mödling zurück.
Dort schloß ich eine neue Freundschaft, wieder mit einem Erwachsenen. Es war der Bettier Wallner, der jeden Donnerstag zu uns kam und auf den Stufen, die zum Garten führten, sein Mittagessen bekam. Herr Wallner trug bei jedem Wetter einen langen Mantel und in einem Jutesack auf dem Rücken seine gesamte Habe. Er wohnte in einem der Vösendorfer Ziegelöfen und sagte, was er nicht mitnehme, werde ihm gestohlen. Was in dem Sack war, ob er eine Familie hatte, ob er je einen Beruf ausgeübt hatte, erfuhren wir nie — es fragte ihn auch niemand danach —, aber ich bewunderte ihn, denn er wußte alles über Schusterkäfer und Ameisen, Regenwürmer und Engerlinge und erzählte stundenlang die erstaunlichsten Geschichten von den Leuten, die mit ihm in den Ziegelöfen wohnten. Und am Ende jeder dieser Geschichten sagte er: „Trotzdem — die Viecher haben's besser.“
Im Herbst durfte ich zum erstenmal ins Burgtheater gehen. Man gab ein Stück, das am Heiligen Abend spielte. Im ersten Stock wohnte eine reiche Familie, deren Kinder sich vom Christkind eine riesige Spielzeugeisenbahn wünschten, und im Souterrain wohnte eine arme Familie, deren Kinder sich eine Riesensalami wünschten. Weil aber eines der Englein des Christkinds nicht aufpaßte, wurden die beiden Geschenke vertauscht und alle Kinder Im Theater lachten, bis sie Seitenstechen hatten, und das Christkind die Sache in Ordnung brachte: die oberen Kinder bekamen die halbe Salami, die unteren Kinder die halbe Spielzeugeisenbahn und auch ihre Eltern, die bis dahin verfeindet gewesen waren, versöhnten sich. Es war, wie gesagt, für Kinder, die ins Burgtheater geführt worden waren, ein rasend lustiges Stück.
Als dann Weihnachten wirklich kam, gab es bei uns am Vormittag eine Bescherung für den Oberhuber, den Ehn und noch ein paar von den ganz Armen. Sie bekamen unsere alten Spielsachen und unsere alten Kleider, denn da sie alle dünner und kleiner waren als mein Bruder und ich, paßten sie in unsere alten Sachen hinein. Zum Oberhuber, der weitaus der Ärmste war, begleitete ich meine Mutter noch am Vormittag hin. Er wohnte mit seinen vier Geschwistern und seinen Eltern in einem unbeschreiblichen Kellerraum. Da die Mutter auch noch Wäsche nach Hause zum Waschen nahm — und davon die ganze Familie ernährte —, war überhaupt kein Platz in dem Zimmer. Von einer nackten Glühbirne am Plafond hing an einem Spagat ein kleiner Christbaum herab, den ihnen jemand geschenkt hatte, ohne Kerzen, ohne Schmuck. Meine Mutter hatte Essen mitgebracht und anderes Nützliche. Die Frau Oberhuber weinte über die Güte der „gnä“ Frau“ und erzählte, die Schwester meines ehemaligen Banknachbars Kratochwil liege im Sterben. Auch sie hatte die Schwindsucht.
Das Mädel starb zu Silvester. Es war ein hartes Jahr für die Kratochwils.