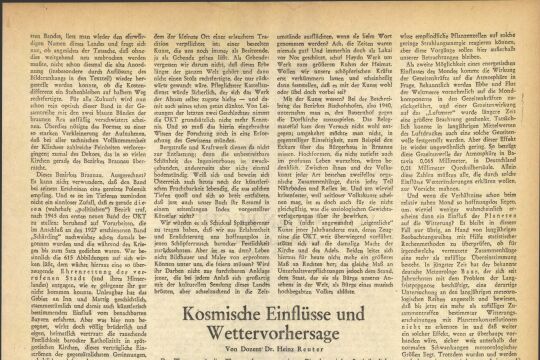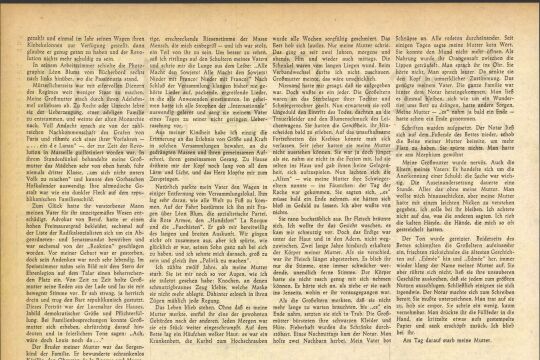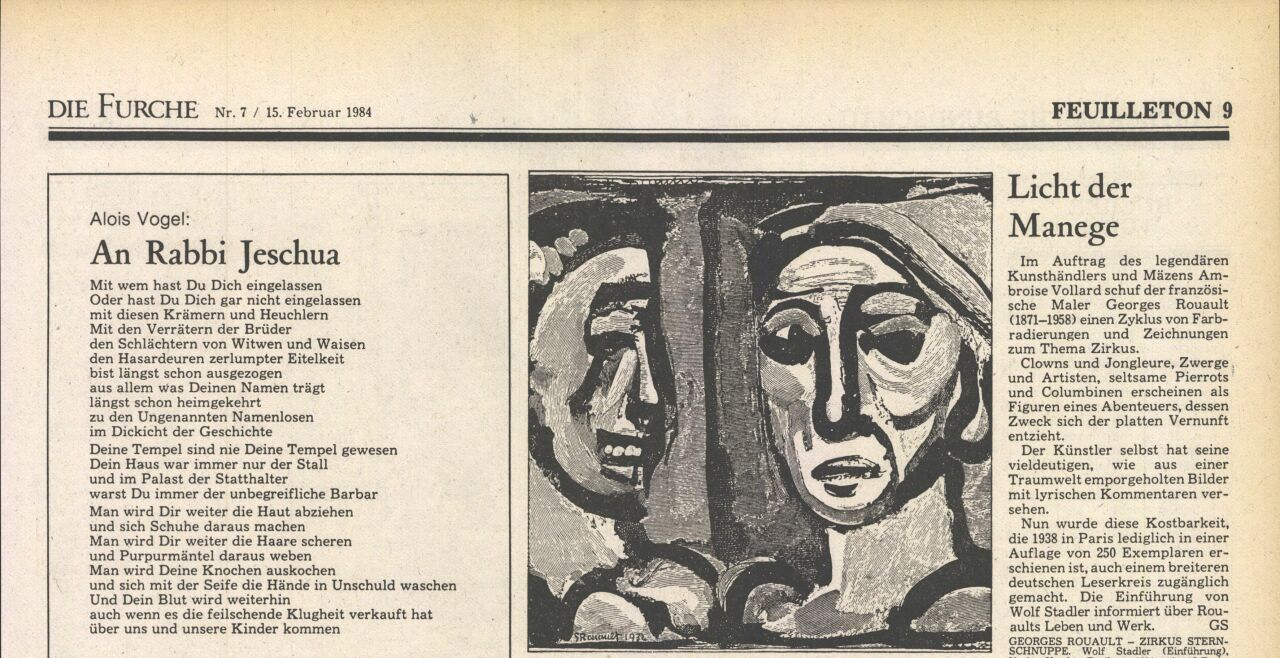
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Scheue Zuneigung, Bücher, Worte, Tod
„Albino" ist der Titel von György Sebestyens neuem Roman, den wir durch den Abdruck dieses Kapitels vorstellen wollen. Das Buch erscheint in diesen Tagen im Verlag Styria, Graz.
„Albino" ist der Titel von György Sebestyens neuem Roman, den wir durch den Abdruck dieses Kapitels vorstellen wollen. Das Buch erscheint in diesen Tagen im Verlag Styria, Graz.
Seit dem ersten Besuch im Buchgeschäft hatte sich für mich einiges geändert. Ich sah Lieselotte mit anderen Augen. Mich störte ihre Ruhe, die Langsamkeit ihres Ganges, die gleichmäßige Freundlichkeit ihrer Blik-ke. Sie fragte etwas, und ich fand nicht gleich die Antwort. Ich mußte nachdenken darüber, warum sie dies und jenes wissen wollte. Es war nicht einleuchtend. „Willst du zur Pasta asciutta die großen Teller oder die kleinen?" Mir war's gleich. „Sonntag geh' ich auf den Friedhof. Kommst du mit?" Sie hatte ihre Toten, die sie dann und wann besuchte.
Auch bei den Verkaufsgesprächen in den Parfümerien fehlten mir plötzlich die Worte. Ich lief erte und ging. Man schien sich über mein verändertes Benehmen nicht zu wundern. Das Geschäft ging auch so. Ob ich gesprächig war oder den Mund hielt, war der Kundschaft offenbar egal.
Seitdem ich mich, vor dem Tod von Alfred Wrangel, betrunken hatte, war ich nie mehr allein in einem Wirtshaus gewesen. Jetzt stand ich nach dem Ende meiner Rundfahrt vor dem Schanktisch. Ich trank ein Viertel und dachte nach. Wenn der Schanktisch feucht war, zeichnete ich mit Wein einen großen Achter in die Nässe, oder ich zählte auf dem Fliegenpapier die toten Fliegen. Danach ging ich nach Hause. Auf die zehn Minuten kam es nicht an. Während das Fernsehen lief, dachte ich an Stephan Berliner.
Ich besuchte ihn regelmäßig, mindestens zweimal in der Woche. Kunden kamen selten in den Laden, und ich konnte nicht begreifen, wie man sich bei einem derart dürftigen Geschäftsgang über Wasser halten konnte. „Ich lebe von den Toten", sagte Stephan Berliner. An das feuchte Blubbern seiner Stimme hatte ich mich gewöhnt. Ich fragte nicht weiter. Mit der Zeit erfuhr ich, daß Stephan Berliner nachgelassene Bibliotheken kaufte, für wenig Geld, von Erben, die die alten Bücher rasch loswerden wollten. Im Bücherberg gab es hin und wieder Schätze: alte Bücher mit berühmten Kupferstichen, seltene Erstausgaben, die ein Sammler suchte, oder Bücher aus Epochen, die gerade jetzt in Mode gekommen waren.
Ich lernte viel. Der Büchermarkt war still, aber unersättlich. Die Nachfrage hatte ihre Launen. Plötzlich kaufte man Bücher aus der Romantik. Jahrelang hatte der Jugendstil Konjunktur, und wenig später riß man sich um Bücher aus der Biedermeierzeit. Das eine Mal grub man die alten Rebellen aus, das andere Mal die alten Herrscher. Neureiche kauften schöne Buchrücken, schenkten einander zierliche kleine Bändchen. Lüstlinge kauften vergilbte Pornographie. Die Zeit nach Ladenschluß verbrachte Stephan Berliner in fremden Wohnungen über alten Büchern. Verstorbene Büchersammler gab es in großer Zahl, tote Schriftsteller in jeder Menge.
Für das Auffinden entsprechender Verlassenschaften hatte er einen sechsten Sinn. Er studierte die Todesanzeigen und besuchte regelmäßig die zuständigen Ämter, um die Liste der Todesfälle zu durchstöbern. Er notierte sich Adressen, trat mit den Erben in Verbindung und irrte sich verhältnismäßig selten. Er tippte richtig. Er stützte sich auf entsprechende Erfahrung, aber damit war sein Erfolg nicht geklärt. Er kombinierte klug. Als Detektiv wäre er vermutlich berühmt geworden. „Glück braucht man auch, junger Freund." Er verglich sich mit einem Kartenspieler. „Sagen wir, ich habe Glück." Er blickte links und rechts an meinen Ohren vorbei. „Da haben Sie den Fall vor sich, in dem die Sprache lügt. Glück und glücklich. Ja, ich hab Glück, aber bin ich deshalb glücklich?" Er war nicht glücklich, aber er hatte für wertvolle Bücher eine gute Nase.
Er hatte keine Scheu, über sich zu reden. Er war zu alt, zu müde oder zu weise, um die Regeln des guten Benehmens zu beachten. Beim Teetrinken aß er seine Honigbrote. Von der Brotrinde, die er nur schwer zerkauen konnte, sog er schmatzend die letzten Zipfelchen des weichen Teigs. Er erzählte, daß er sich vor dem Schlafengehen vor den Spiegel stellte, um den altersbedingten Verfall seines Körpers zu betrachten. „Jede Veränderung ist interessant. Und wer sagt Ihnen, was schön ist? Sind Ruinen nicht schön? Zum Beispiel die Akropo-lis von Athen! — Vielleicht wird sie von Tag zu Tag schöner." Er meinte sich selbst. Er sprach von sich oft in der dritten Person, wie die Kinder. Wenn er von seinen Ansichten oder Erfahrungen erzählte, sagte er „ich". Von einem „er" sprach er nur bei Bedürfnissen des Körpers.
Er hatte sich offenbar längst daran gewöhnt, mit seinem Körper uneins zu sein, so als hielte er sich für ein Wesen, das in einem fremden Leib hausen mußte. Als mir in dieser Hinsicht ein Licht aufging, fragte ich ihn, ob er der Ansicht wäre, wir hätten eine Seele. „Nach Sigmund Freud oder nach Thomas von Aquin?" Da ich nicht wußte, was ich sagen sollte, grinste ich schweigsam und verlegen. Wenn ich verwirrt war, sah er die Gelegenheit zum Monologisieren gekommen. „So ein kleines unsichtbares Ding, das Sie unter der Westentasche tragen, mit unsichtbaren Flügeln und Hosianna? Oder Seelenwanderung? Gestern noch Prinz, morgen Ameise, übermorgen Amöbe und danach Geist? Oder gleich unterhalb der Hintertreppe im Kohlenkeller der Hauspolyp mit der siebenarmigen Menorah, und das Ganze dann .Unterbewußtsein' betitelt? Oder wie?" Er schüttelte sich. Er lachte. „Nein, so nicht." Er zitierte den Werbetext: „Der Sarg klappt zu, die Witwe kichert, hoffentlich Allianz versichert." Hätte ich nicht gespürt, daß er mich mochte - ich wäre aufgestanden und gegangen.
Ich fragte nochmals, ob er an die Existenz einer Seele glaubte. „Mitnichten", sagte Stephan. Berliner. „Wenn ich von mir so rede, als wäre ich ein Tier, dann tu ich es, weil ich ein Tier bin." — „Aber woher wollen Sie wissen, daß Sie ein Tier sind?" fragte ich. Er schloß die Augen. Ich sah zum ersten Mal, daß er lange Augenwimpern hatte, die vor den Pupillen wie ein unruhiger Vorhang bebten. Der Vorhang hob sich. „Gewonnen", sagte Stephan Berliner. „Vielleicht hab' ich tatsächlich eine Seele. Aber wenn ich eine Seele habe, dann haben auch Sie eine Seele. Und wenn wir alle wirklich eine Seele haben, dann müßte es eigentlich eine Oberseele geben." Ich fragte: „Gott?" - „Ein schreckliches Wort", sagte Stephan Berliner, „aber irgendwie müssen wir das Ding wohl benennen."
Wir tranken Tee. Stephan Berliner erzählte von seinen Gefühlen, von seinen Ansichten, von seinen Geschäften. Es gab zwei Themen, über die er nicht sprach: über seine Vergangenheit und über mich. Ich fragte ihn, woher er gekommen und ob sein Akzent, wie ich annahm, ein polnischer sei. Und ob er vielleicht Jude sei. Er schüttelte den Kopf. „Man hat mich oft für einen Juden gehalten, und weil ich Berliner heiße, für einen Berliner Juden, aber ich bin kein Jude, nicht einmal nach dem Nürnberger Gesetz. Arisch, wohin man sieht." Als ich über meine wachsenden Schwierigkeiten mit Lieselotte erzählte, begann er anstelle einer Antwort den Tee aus der Tasse laut zu schlürfen. Stephan Berliner war in dieser Hinsicht zu keiner Äußerung bereit. „Was kann ich Ihnen schon raten? Sie haben Ihren Kompaß."
Ich hielt solche Bemerkungen für geschmacklos. Aber Stephan Berliner gehörte nicht zu den Menschen, die Geschmack haben mußten. Ich verzieh ihm, ich verzieh ihm alles. Ich liebte ihn, und es könnte sein, daß er meine Liebe erwiderte. Manchmal dachte ich, ich hätte einen Mann wie Stephan Berliner gerne als Vater oder als Großvater gehabt.
Die Buchhandlung und das kleine Zimmer dahinter, und außerhalb dieses Kreises überall nur Schatten. Sie huschten vorbei. Sie waren unwichtig und unbeständig. Nur die Brücken sind wichtig. Ich las im Buch von Montaigne, das mir Stephan Berliner gegeben hatte. „Und auf dem höchsten Thron der Welt sitzen wir doch nur auf unserem Hintern." Ich schrieb den Satz auf ein Stück Papier und bewahrte es in der Brieftasche auf, gleich neben meinem Führerschein.
Stephan Berliner starb eines friedlichen Todes. Die näheren Einzelheiten sind mir unbekannt, und trotzdem weiß ich, wie es gekommen war.
Am Nachmittag tranken wir Tee und sprachen über Surinam. Einen Monat im Sommer, Jahr für Jahr, verbrachte Stephan Berliner als Passagier auf einem Frachter. Er kannte Dalmatien, Skandinavien und Teile der Küste Südamerikas. Er hatte vor, einmal zum Kongo zu reisen und im Jahr danach zu den Balearen.
In Surinam roch die Armut nach süßem Tabak. Unter Wellblechdächern hausten bettelarme Menschen. Abends machten sie Musik. Sie lebten im Schmutz und waren r^in, wie von dünner Goldhaut überzogen. Manche betranken sich gern, hatten im Handumdrehen das Messer in der Hand, aber das Blut, das aus den Wunden quoll, hatte einen besonderen Glanz, und die Trauer machte die Gesichter schön. Die Wunden dei Uberlebenden vernarbten übei Nacht. Kleine Mädchen prostituierten sich; ihre mageren Körper sahen wie getrocknete Früchte aus. Surinam war der Ort, den Europäer aufsuchen mußten, wenn sie für die Sünden ihrer Väter büßen wollten, und es gab keine innigere Wollust als das Erlebnis, die eigene Erniedrigung als einen Akt der Gerechtigkeit zu erleben.
Stephan Berliner hielt seine Bücher für die Grenadiere, die ihr letztes Schießpulver verbraucht hatten und nun nichts Besseres mehr zu tun hatten, als im beglük-kenden Gefühl ihrer Sinnlosigkeit lautlös zu sterben. Er hielt sich für die lebendige Stimme seiner dem Tod anheimfallenden Bücher, für ein letztes Stammeln über das Schlachtfeld, wie er sagte.
Nachdem wir den Tee ausgetrunken hatten und die Kanne leer war, zog er sich zu seinem nächtlichen Ritual zurück: Er ging in seine Zimmer-Küche-Wohnung in das Stockwerk über dem Laden, verriegelte die Tür hinter sich, zog sich aus, besah seinen nackten Körper im Spiegel und überzeugte sich davon, daß es für ihn an der Zeit war, aus dem Leben zu gehen. Der Anblick brachte ihm die Ruhe, die er brauchte, um dem sinnvollen Durcheinander der Bilder, die ihm nach dem Zubettgehen durch den Schädel tanzten, ein Ende zu setzen. Er tat das jeden Abend. Er nahm kein Gift. Er wollte sterben, und das genügte. Am nächsten Morgen wachte er nicht wieder auf.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!