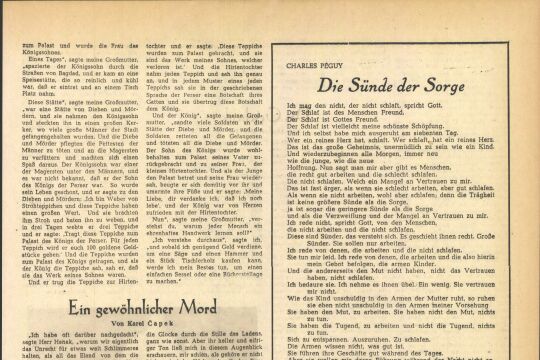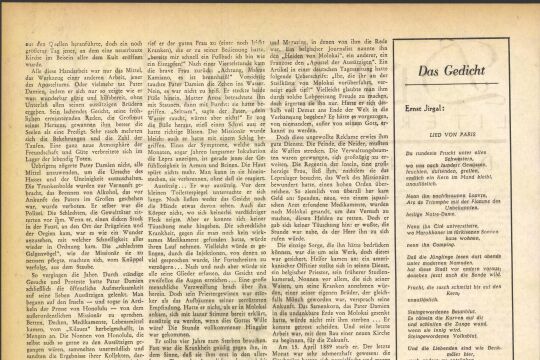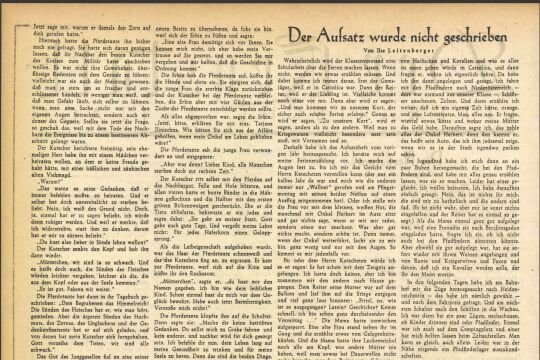Und dann erzählte ich die Geschichte von dem Mann, der nicht glauben wollte, daß es Konzentrationslager gegeben habe. Ich spielte des öfteren Schach mit ihm in unserem Stammcafe, wir waren ungefähr gleich stark, einmal gewann er, einmal ich. Ansonsten sprachen wir nicht viel miteinander, ein wenig vom Wetter, ein wenig von den vielen Autos in den Straßen. Er war ein stiller, älterer Mensch, der alles, was ihn selbst betraf, bei sich behielt, und er schien mir, ehrlich gesagt, auch nicht interessant genug, mich näher mit ihm zu beschäftigen. Einmal aber, ich weiß nicht, wie es dazu kam, waren wir unvermittelt auf das Thema Krieg gekommen, auf das Rassenproblem und die Verfolgungen. Wir redeten eine Weile so hin und her, und plötzlich merkte ich, daß mir der Mann das von den Konzentrationslagern nicht glauben wollte.
Im ersten Moment hielt ich ihn für einen hoffnungslos Unbelehrbaren — viele von denen glauben das ja heute noch nicht — dann auch für einen Antisemiten und wollte schon eine neue Partie vorschlagen, um das unerquickliche Gespräch abzubrechen. Aber dann sagte er etwas, das mich stutzig machte. Er sagte: „So etwas können Menschen nicht tun.“ Jetzt glaubte ich wiederum, einen jener vor mir zu haben, die noch immer an die Entwicklung der Menschheit zum Guten glauben und das 20. Jahrhundert für die Krönung des fortgeschrittenen 19. halten. Aber er sagte nicht: „Im 20. Jahrhundert —“ sondern ganz allgemein: „Menschen können so etwas nicht tun.“ Ich verwies ihn darauf, daß Menschen zu allen Zeiten ähnliches hatten tun können, im Mittelalter etwa, Inquisition, Hexenverbrennungen usw., aber er unterbrach mich bald. Einzelne Fälle gebe es natürlich immer, im übrigen könne man das heute gar nicht mehr kontrollieren. Ich wendete ein, daß man das, was in den KZ geschehen war, sehr wohl kontrollieren könne und erwartete nun eine der üblichen Entschuldigungen jener Leute, etwa: „Im Krieg ist so etwas eben notwendig“ oder „Es wa-
ren nicht sechs Millionen, es waren ja nur ...“ Manche wagen ja allen Ernstes von „nur einer Million“ zu reden. Er war aber nicht einer von denen, er kam mit einer ganz anderen, überraschenden Frage: „Haben Sie etwas davon selbst erlebt?“ Ich mußte verneinen, besser gesagt, ich durfte verneinen. „Also“, sagte er, „woher wissen Sie es dann?“ — Das wisse doch heute jedes Kind, meinte ich. Da gab er zurück, man solle nicht schon Kindern solche Lügen erzählen. Er sagte es tief bekümmert, er scheint Kinder zu lieben, und mir begann aufzudämmern, daß er es ehrlich meinte und wirklich nicht daran glauben konnte. Ich fragte ihn: „Haben Sie sich nie Gedanken gemacht, was mit den Juden, die den gelben Stern tragen mußten, später geschehen ist?“ Er sagte, er sei alle die Jahre an der Front gewesen und habe nie einen mit diesem Stern gesehen. — Ob er nie den „Stürmer“ gelesen habe? — Er sagte: „Nein. Ich habe nur Goethe gelesen und Schiller und Eichendorff.“ Und dann setzte er hinzu: „Das mit dem ,Stürmer' ist doch nur eine Erfindung.“ Jetzt hätte ich ihn beinahe wieder für einen alten Unbelehrbaren — allerdings von einer etwas sonderbaren Abart — gehalten. Ich brachte ihm ein Buch, in dem eine Anzahl von besonders gehässigen und typischen „Stürmer“-Nummern gesammelt ist. Er wies auf das Erscheinungsdatum des Buches hin und sagte: „Das ist doch erst jetzt gedruckt worden. Zwanzig Jahre später.“ Ich blätterte zu den Photokopien zurück, er aber schüttelte nur den Kopf: „Das ist technisch leicht zu machen. Haben Sie ,1984' von Or-well gelesen? Dort wird genau geschildert, wie man alte Bücher und Zeitungen umschreibt.“ Da fuhr ich auf: „Sie wollen mir doch nicht einreden, daß man das alles einfach fälschen kann!“ Er sah mich mit seinen hellen, gütigen Augen an, wie man einen Schwachsinnigen- ansieht, der das kleine Einmaleins nicht begreifen will. „Heute kann man so viel“, sagte er. Wir saßen wieder einmal in unserem Stammlokal, rings um uns Menschen, die ihren Kaffee tranken,
ein ganz normales Lokal. Aber ich dachte plötzlich, wenn sich jetzt der Boden unter unseren Füßen auftäte, ich würde mich gar nicht wundern. Er saß ruhig auf seiner Plüschbank und rührte mit dem Löffel in seiner Tasse. Er trank keinen Alkohol.
Ich brachte ihm daraufhin andere Bücher, ich ließ mir in der Nationalbibliothek etliche Jahrgänge des „Stürmer“ und andere Hetzschriften, offizielle Berichte von den KZ-Greueln, Prozeßakten ausheben und zeigte sie ihm. Er kam geduldig mit mir, ein wenig nachsichtig sah er meinem Bemühen zu, wie einen Kinder manchmal ansehen, wenn man ihnen den Wurstel vormacht. Ein Blick, vor dem man sich schämen möchte, so weise und überlegen scheint er. Er blätterte durch, was ich ihm vorlegte, dann fragte er. „Kennen Sie einen von denen, die das geschrieben haben? Damals.“ — „Ja, einen kenne ich.“ — „Dann hat er Sie angelogen.“
Ich wollte ihn mit jenem Mann nicht zusammenbringen, der hätte sich nur gefreut, in meinem seltsamen Bekannten einen so lauteren Verteidiger seiner Vergangenheit zu finden. Ich hätte ihn auch etlichen Opfern gegenüberstellen können, aber ich wollte ihn nicht der Lächerlichkeit preisgeben. Er hätte womöglich zu dem einen, der bei einem Kälteexperiment beide Beine verloren hatte, gesagt: „Reden Sie mrr nichts ein! Das war doch ein Unfall.“ Ja, das traute ich ihm bereits zu. Es hätte ihm vielleicht gar nichts ausgemacht, verlacht, verhöhnt oder angeschrien zu werden — aber ich wollte ihm eine solche Szene doch ersparen. Ich lud ihn also eines Morgens zu einem Ausflug mit meinem Wagen ein. Er dankte mir herzlich dafür: „Ich fahre gern mit dem Auto, ich komme nur selten dazu.“ Er war ein kleiner Angestellter gewesen, Buchhalter, glaube ich, und wohnt jetzt als Pensionist im 8. Bezirk.
Wir fuhren nach Mauthausen. Als das Ortsschild herankam, glaubte ich ihm anzumerken, daß ihm der Name geläufig war, aber er sagte nichts. Als wir von der Hauptstraße abbogen und die Serpentinen hinauffuhren,
blickte er interessiert zu dem burgartigen Bau empor, sooft dieser in einer Kehre zu sehen war. Ich zeigte ihm den großen Appellhof, die Todesstiege, die Wachttürme, Barakken, Gaskammern, Verbrennungsöfen — schließlich die Gedenktafel mit den Zahlen der Ermordeten. Hätte ich meinen seltsamen Begleiter nicht schon einigermaßen ge-
kannt, mich hätte die Wut gepackt, wie unberührt er alle meine Erklärungen aufnahm. Er erinnerte mich an einen Leser von Kriminalromanen, für den die gräßlichsten Morde nur Spannungsmomente sind, die nichts mit seinem, nichts mit dem wirklichen Leben zu tun haben. Nur einmal, als ich merkte, daß er mir nicht gefolgt war, und mich umwandte, sah ich, wie er an eine mit großen Blöcken zusammengefügte Mauer trat. Er betastete sie mit den Fingern, den Stein und die Fugen, als wollte er sich vergewissern, ob das auch echte Blöcke waren oder nur monumentale Verkleidung einer Ziegelmauer. Nach einer Weile schüttelte er den Kopf, blickte die Mauer hoch und sagte mehr zu sich selbst: „Die haben sich viel Mühe gemacht.“
Etwas wie Achtung, ja Bewunderung lag in seinen Worten. Ich war völlig konsterniert, unfähig, ein Wort herauszubringen.
Dann sah er mich an: „Wann hat man das gebaut?“ Ich wußte es nicht genau. „So zwischen 1940 und 43 wahrscheinlich.“ Da lächelte er. „Würden Sie es erkennen, wenn man das erst 1950 gebaut hätte? Alles steht im Freien. Der Stein verwittert rasch. Und die Baracken — billiges Holz.“ Und plötzlich glitt ein verschmitztes Lächeln über sein Gesicht: „Monumentalität des Dritten Reiches“, sagte er, fast stolz auf sein Stilgefühl. „Aber unser Parlament ist auch nicht von den Griechen erbaut. Und das Rathaus und die Vo-tivkirche und die Museen an der Ringstraße...“
Ich begann allmählich die Nerven zu verlieren: „Wer sollte ein Interesse haben, das alles jetzt erst aufzubauen? Nur um Ihnen und mir und den Schulklassen, die hierhergeführt werden, einen Bären aufzubinden?“ Er zuckte leicht zusammen
— ich hätte nicht so schreien sollen
— und ließ die Hand, die die Mauer noch einmal berührt hatte, fallen. „Wer —“, murmelte er. „Ja, wer
— — es wird schon alles seinen Grund haben...“ Ich war, ehrlich gesagt, schon zu erschöpft, um den letzten Satz ganz aufzunehmen.
Erst später, als wir schon heimwärts fuhren, kam er mir richtig zu Bewußtsein und mit ihm alles andere. Der Mann schien tatsächlich zu glauben, daß das alles im Nachhinein aufgebaut worden war, die Türme, die Gaskammern, die Öfen — zu glauben, daß man alles, was hier geschehen war, erst erfunden habe. Aber wozu erfunden? Welche Phantasie war dessen überhaupt fähig? Und die unzähligen Bücher, die die gesammelten Fakten enthielten, dieser ungeheure Apparat von Druckereien, Verlagen, Reportern, Wissenschaftlern, Lager voll von Prozeßakten, Massengräber und gemeißelte Grabsteine, eine Unzahl bestochener Zeugen, die zu nichts sonst da waren, als angebliche Geschehnisse von damals im Bewußtsein der Menschen wachzuhalten — alles das nur — ich sprach aus, was ich dachte: „Alles
das nur, um Sie zu belügen? Das ist doch absurd!“ Er blickte nachdenklich auf den Scheibenwischer, es hatte zu regnen begonnen. „Sagen Sie nicht Lüge!“ bat er dann sanft.
— „Sie haben doch selbst dieses Wort gebraucht.“ — „Es war vielleicht ein unpassendes Wort“, gab er willig zu. „Aber es ist zu hart. Schon das Wort Notlüge wäre zu hart. Lüge aus Not — Lüge zu einem guten Zweck — man müßte ein besseres Wort dafür finden...“ Ich ließ ihn weiterreden, ich mußte auf den Verkehr achten, hatte auch nicht mehr die Geduld, näher hinzuhören. Das alles war so wirr und abstrus und
— und doch, er schien mir keiner dieser verrückten Einzelgänger zu sein, die sich mit allerlei' sinnlosen Erfindungen, Philosophien und WeU-verbesserungsplänen abgeben.
An einem der nächsten Tage fand ich in der Zeitung einen Bericht über den großen Auschwitzprozeß. Ich fuhr zu seiner Wohnung und warf ihm das Blatt auf den Tisch. „Da! Ist das auch Erfindung?“ Er las den Artikel aufmerksam durch, unterbrach nur einmal, um mir eine Zigarette anzubieten, dann las er zu Ende und schob mir die Zeitung wieder zu. Und schüttelte wieder den Kopf. Diese durch nichts zu erschütternde, nirgendwo angreifbare Sicherheit, mit der dieser Mann alles, selbst die erdrückendsten Beweise still, manchmal nachsichtig lächelnd von sich schob, machte mich rasend. „Wenn Sie also nur glauben, was Sie selbst kontrollieren können“, schrie ich ihn an, „dann gibt es die Nachbarwohnung, in der Sie noch nicht gewesen sind, vielleicht auch nicht! Und die Menschen, die Sie nicht sehen, leben nicht! Und Amerika ist überhaupt noch nicht entdeckt!“
Er war sehr höflich, er überging meine Grobheit. Er hätte mir ohne weiteres die Türe weisen können. Aber er schob mir nur das Zigarettenpäckchen aufmunternd zu. „Ich kann nichts Böses daran finden, daß man Amerika entdeckt hat“, sagte er leise. Wieder wollte ich hochfahren, aber diesmal bezwang ich mich. Ich erinnerte mich an seine Worte vom ersten Mal: Menschen können so etwas nicht tun. Und weil er das nicht xglauben konnte, darum existierte es nicht. Zugegeben, das hatte seine Logik. Darum mußte alles, was so böse war, daß es sein Fassungsvermögen überstieg, erfunden sein. Und alle die Zehntausend, die damit beschäftigt waren, die Vergangenheit zu registrieren, aufzuhellen, nicht vergessen zu lassen, taten das nur, um ihm dieses grauenvolle Märchen immer wieder neu zu erzählen, durch immer neu entdeckte Einzelheiten, Zahlen und Daten zu ergänzen. In der ganzen Welt war man dauernd an der Arbeit, um ihm — er unterbrach mich mit einer leichten Handbewegung. Er wisse gar nicht, ob nur für ihn, ja ob überhaupt für ihn, er kenne die Absichten dieser Leute nicht. Wer sei er denn schon? Es wäre durchaus möglich, daß es andere gäbe, für die das alles bestimmt sei. Mehrere. Viele.
Ich schwieg eine Weile, sah ihn nur aufmerksam an. Der Mann mit Goethe und Eichendorff im Tornister hatte sicher noch nie etwas von Kafka gelesen, den würde er wohl auch ablehnen. Nein, diese Gedanken kamen ganz aus ihm selbst. Und sie waren ehrlich, davon war ich jetzt überzeugt. So sehr überzeugt, daß ich sogar imstande war, auf seine Gedanken einzugehen, als wären sie die meinen. „Und was glauben Sie“, fragte ich behutsam, „weshalb die Leute das alles tun?“ Er blickte vor sich hin und schwieg. „Sie haben sich doch sicher schon Gedanken darüber gemacht“, bohrte ich vorsichtig weiter. Er nickte. „Ja, ja, natürlich.“ Er schwieg wieder, und ich wollte ihn noch einmal aufmuntern, da sagte er bedächtig. „Vielleicht tun sie es, damit wir nicht übermütig werden.“ — „Wer — wir?“ fragte ich noch einmal. „Ich“, sagte er. „Und die anderen vielleicht, ich kenne nur wenige, aber —“ Er nahm wieder eine Zigarette, er rauchte mehr als sonst an diesem Vormittag, vielleicht glaubte er, es könne seinen Gedanken nachhelfen. Seine Stirn war voll tiefer Falten. Schließlich aber schüttelte er den Kopf, es wurde ihm wohl zu schwer, und blickte mich an. „Sie verzeihen, daß ich Ihnen nicht mehr sagen kann —“ Er zuckte die Achseln. „Ich muß noch viel darüber nachdenken.“ Er bot mir noch eine Zigarette an. Er war sehr höflich.