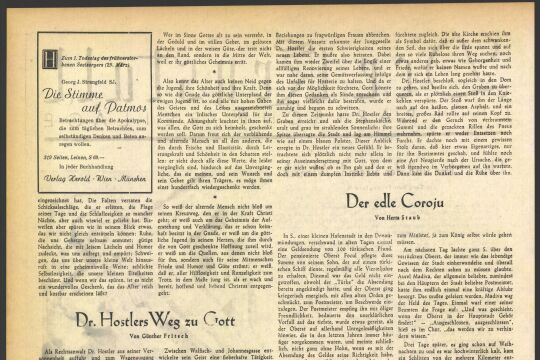Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
WIE ICH IHN SAH
Mödling, am 7. Jänner 1917
Gestern besuchten wir meine alte Freundin Minni de le Beau, die seit Beginn des Krieges mit ihrer Mutter und den Töchtern in der Badener Villa (Epsteingasse 7) lebt. Wir hatten musiziert, wobei ich die beiden Mädchen, die zusammen Violine und Klavier spielten, auf einer mit zwei Saiten bespannten Geige aus dem Stegreif begleitete, und saßen eben bei der Jause. Da kam das Dienstmädchen und meldete den Besuch des Feldmarschalls Conrad von Hötzendorf, der der Schwager des Herrn von le Beau ist. Meine Freundin eilte ihm in den Salon entgegen, auch die Töchter begaben sich dahin, um den Onkel zu begrüßen. Meine Frau und ich, die mit noch zwei Damen in dem kleinen Speisezimmer zurückgeblieben waren, standen eben im Begriff — um nicht zu stören — wegzugehen, als die Türe aufging und zunächst meine Freundin und ihre Töchter, dann aber aus dem unbeleuchteten Nebenzimmer auch der Feldmarschall in den Lichtkreis unseres Zimmers eintraten. Es war ein eigentümliches, überraschendes und fast traumartiges Gefühl, sich diesem Antlitz, dessen kleinste Falte man aus Hunderten von Bildern kennt, leibhaftig gegenüber zu sehen.
Nachdem die Damen mit ihm bekanntgemacht waren, trat er sofort auf mich zu, nachdem er mich schon früher mit einem freundlich-forschenden Blick angesehen hatte, reichte mir die Hand und hielt die meine fest, während er sich des längeren wegen eines Vorfalles entschuldigte, der mich um seine persönliche Danksagung für ein ihm von mir übersendetes Buch der „österreichischen Gedichte” gebracht hatte. Er: sagte: „Es freut midi, Sie zu treffen. Mit Ihnen habe ich eine gahz besondere Angelegenheit au erledigen. Es dst’elfiö Taktlosigkeit vorgefallen. Sie habert’ mir ein Büch gesbhÄRt.’ Mein damaliger Adjutant hat mir vorgegriffen, er hat statt meiner geantwortet. Ich mache dies hiemit persönlich gut.” — Seine Hand ruhte warm und fest, während er dies sagte, in der meinen, und ich dankte ihm mit einigen verlegenen Worten für seine Güte. Er nahm nun in unserem Kreise Platz, und das Gespräch wurde zumeist von ihm und meiner Freundin geführt.
Ich ließ keinen Blick von ihm und nahm sein Wesen vollkommen in mich auf.
Ich hatte ihn lange vor dem Krieg einmal auf der Straße gesehen. Es war damals, als der Krieg mit Serbien zum letzten Male vermieden wurde, im Jahre 1912. Jener Begegnung entsprang die Anregung zu dem Gedicht: „Ein Feldherr”, das bald darauf, allerdings ohne die persönliche Widmung, in der „Muskete” erschien. — Bei der Buchhandlung von Gil- hofer und Ranschburg in der Bognergasse war es, wo er damals, auf dem Wege zum Kriegsministerium, an mir vorbeikam. Ein kleines, fast verhutzeltes Männchen, in einem Mantel, der ihm viel zu weit und zu lang zu sein schien, die Kappe tief ins Gesicht gedrückt, so daß man von der Stirne fast nichts sah. Das Gesicht war fast so grau wie sein Schnurrbart und die Augenbrauen, unter denen zwei unheimlich scharfe Augen vor sich hinsahen. Die Impression, die ich damals von ihm hatte, ist ja in meinem Gedicht hinlänglich ausgedrückt, und ich brauche daher nichts weiter zu sagen.
Meine Freundin und ihre Töchter behaupten, daß der Feldmarschall während des Krieges stark gealtert sei. Ich hatte im Vergleich zu jener meiner ersten Begegnung die gegenteilige Empfindung. Sein Gesicht ist jetzt frisch gefärbt, die Haut ist gespannt, sein Nacken straff und gesund aussehend. Die Bewegung des Fünfundsechzigjährigen sind von freier soldatischer Eleganz, besonders die weitausholenden Gesten der rechten Hand, mit denen er seine Rede an lebhaften Stellen begleitet.
Sein Gespräch mit seiner Schwägerin handelte zuerst in heiterer Weise von familiären Angelegenheiten, besonders von seinen Söhnen. Ich weiß von früher her, daß sie das Alles seines Lebens sind. Nun kam die Rede auf jenen seiner Söhne, den sie in der Familie „Schiesl” oder so ähnlich nannten, und meine Freundin fragte ihn, ob er ihn wohl bald Wiedersehen werde. „Im Frühjahr, hoffe ich”, sagte er und setzte hinzu: „Das heißt, wenn er wiederkommt. Das kann man ja nicht wissen. Er ist im vordersten Schützengraben. Anders tut er es nicht. Keiner meiner Söhne tut es andern. Sie sind Berufsoffiziere, und da ist es ja auch recht so.” Ein nervöses Zucken seines Gesichtes, das ihn immer befällt, wenn er aus innerer Erregung heraus spricht, verriet mir aber, daß sein Vaterherz darüber anders dachte. Einen seiner Söhne hat er ja auch bereits im Kriege verloren.
Wir kamen dann auf den Anfang des Krieges zu sprechen, und er sagte: „Es wird ja vielleicht niemals anerkannt werden, aber ohne uns wären die Kosaken damals nach Breslau und vielleicht sogar nach Berlin geritten. Was wir damals von unserem lebendigen, besten Kapital geopfert haben, ist weit mehr, als was uns dann später in Raten (von Deutschland — er vermied das Wort in diesem Zusammenhang) zurückgezahlt wurde. Das waren vielleicht nicht einmal die Zinsen jenes Kapitals. Es weiß ja niemand, wie im Anfang speziell unsere Kavallerie gelitten hat. Von unseren braven Schwadronen ist ja so gut wie nichts übrig geblieben. Und die Infanterie…” — Hier schwieg er. In seinem Gesicht zuckte es wieder mehrmals blitzartig schnell auf, Tief in seinen Augen war etwas wie ein ganz verstohlenes feuchtes Leuchten.
Nach irgendeinem Gesprächsübergang fuhr er fort: „Die Deutschen machen es ganz anders als wir. Sie machen sich Götter und stellen sie hin zur Verehrung für das Volk und die Geschichte. Bei uns ist es umgekehrt. Der Österreicher fühlt sich nur wohl, wenn er schimpfen kann. Und vor allem: die Deutschen sagen nur, was sie fördert. Ihre Heeresberichte sind Meisterwerke im Herausstreichen der Erfolge und im Verschweigen der Mißerfolge. Von der Marneschlacht, die die größte Niederlage dieses Krieges war, erfuhr man aus ihren Berichten so gut wie nichts.”
Von den deutschen Heeresberichten sagte er ferner: „Die Deutschen haben es leicht, wenn sie zum Beispiel in ihren Berichten erwähnen: ,Das tapfere Holstein’sche” oder ,das bewährte Brandenburgische Infanterieregiment’. — Wenn wir einmal hervorheben: ,Das tapfere Kroatische Infanterieregiment Nr. X. Y.’ — so kommen gleich am nächsten Tage die Ungarn und sagen: ,Was? Die Kroaten? Und wir?!” “
Alle diese Bemerkungen machte er in einem leichten, lebhaften Konversationston, der von jener über dem Schein der Dinge stehenden Heiterkeit des Österreichers erfüllt war.
Man kam dann darauf zu sprechen, daß ihn die Leute schon seit geraumer Zeit in Baden gesehen haben wollten, während er in Wirklichkeit doch erst am heutigen Tage hier eingetroffen sei. „Ja”, sagte er lächelnd, „das beweist nur, daß es in unserer Armee viele Generäle mit meinem Gesicht gibt, und daß an dem meinen nichts Besonderes ist.” Uber den Widerspruch der Damen ging er lächelnd hinweg. Mein Eindruck war, daß er diesen Widerspruch sicher nicht hatte heraufbeschwören wollen — um so weniger, als er in der Tat recht hatte. Insofern nämlich:
Das Soldatische ist in seinen Zügen wirklich nicht außergewöhnlich ausgeprägt. Ich habe sogar österreichische Subalternoffiziere gesehen, die soldatischer aussahen als er. Alles „Martialische” ist seinem Antlitz vollkommen fremd. Um so lebhafter wirkt das Geistige und — Menschliche darin. Marmor und Erz werden dieses Gesicht niemals wiedergeben können, auf diese Materien hin läßt es sich nicht stilisieren. Nur der Pinsel eines gewaltigen Meisters (wie etwa Lenbach) könnte das Nervös-Geistige, das Denkerische, das Empfindsame dieses Antlitzes festhalten und einigermaßen fortleben lassen. (Von den deutschen Heerführern ähnelt ihm dm Prinzip am meisten Mackensen.)
Ich erwähnte bereits, daß ich, ihn unverwandt anblickend, sein Wesen vollkommen in mich aufgenommen habe, wobei mir allerdings manches zugute kam, was ich früher schon von seiner Schwägerin über ihn gehört hatte. Diese meine Beobachtungen und Eindrücke will ich nun zusammenzufassen suchen:
Der Feldmarschall ist Österreicher im besten Sinne. Seine Energie, zweifellos- groß und unerbittlich in der Sache, ist praktisch mehr geistiger Natur und nicht so sehr auf die tatsächliche Durchführung in der Wirklichkeit gerichtet. Sein klarer Geist ist weit vorausschauend, er beherrscht die Szene des Krieges wie ein genialer Schachspieler das Brett der 64 Felder. Aber wenn ihn Kiebitze stören, so besitzt er nicht die Brutalität, ihnen zu bedeuten, daß sie das Maul zu halten haben. Hart, fest, unbeirrbar in der Sache, ist er sicherlich dem Menschlichen, dem Gefühlsmäßigen in einem Grade zugänglich, daß er gegen seine sachliche Überzeugung zuläßt, wenn ein anderer einen Zug statt seiner machen möchte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!